 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
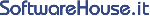
|
Herman Grimm
Das Leben Michelangelos
Erstes Kapitel
I
Es gibt Namen, die etwas von einer Zauberformel in sich tragen. Man spricht sie aus, und wie der Prinz in dem Märchen der Tausend und eine Nacht, der das Wunderpferd bestieg und die magischen Worte rief, fühlt man sich vom Boden der Erde in die Wolken steigen. Nur »Athen!« – und was im Altertume an großen Taten geschah, liegt wie ein plötzlicher Sonnenschein über unserem Herzen. Nichts Bestimmtes, keine einzelnen Gestalten erblicken wir, aber Wolkenzüge, aus herrlichen Männerscharen gebildet, ziehen am Himmel hin, und ein Hauch berührt uns, der wie der erste laue Wind im Jahre mitten in Schnee und Regen den Frühling schon zu gewähren scheint. »Florenz!« – und die Pracht und leidenschaftliche Bewegung der italienischen Blütezeit duftet uns an wie volle blütenschwere Äste, aus deren dämmernder Tiefe flüsternd die schöne Sprache redet.
Nun aber treten wir näher und wollen die Dinge deutlicher betrachten, deren Sammlung mit einem Blicke überflogen die Geschichte von Athen und von Florenz genannt wird. Da erkalten die glühenden Bilder und werden trübe und nüchtern. Wie überall gewahren wir auch hier den Kampf der gemeinen Leidenschaften, das Märtyrertum und den Untergang der besten Bürger, die dämonische Widersetzlichkeit der großen Menge gegen das Reine und Erhabene und die energische Uneigennützigkeit der edelsten Patrioten mißtrauisch verkannt und hochmütig zurückgewiesen. Ärger, Wehmut und Trauer stehlen sich ein an die Stelle der Bewunderung, die uns zuerst bewegte. Und dennoch, was ist das? Indem wir uns abwendend von weitem einen Blick zurückwerfen, da liegt der alte Glanz wieder auf dem Bilde, und eine schimmernde Ferne scheint das Paradies trotzdem zu entfalten, zu dem es uns von neuem hinzieht, als sollten wir es zum letzten Male betreten.
Athen war die erste Stadt Griechenlands. Reich, mächtig, mit einer Politik, die sich beinahe über die ganze Welt ihres Zeitalters ausspannte, – es begreift sich, daß von hier ausging, was Großes geleistet wurde. Florenz aber, in seinen schönsten Tagen nicht einmal die erste Stadt Italiens, erfreute sich in keinem Betracht außerordentlicher Vorteile. Es liegt nicht am Meere, nicht einmal an einem jederzeit schiffbaren Flusse; denn der Arno, zu dessen beiden Seiten sich die Stadt erhebt, an dem Punkte seines Laufes, wo er aus engen Tälern in die zwischen den sich ausbreitenden Armen des Gebirges gelegene Ebene heraustritt, bietet im Sommer oft kaum Wasser genug, um den Boden seines breiten Bettes damit zu überströmen. Neapel liegt schöner, Genua königlicher als Florenz, Rom ist reicher an Kunstschätzen, Venedig besaß eine politische Macht, gegen welche der Einfluß der Florentiner gering erscheint. Endlich, diese Städte und andere, wie Pisa oder Mailand, haben eine äußere Geschichte durchgemacht, der gegenüber die von Florenz nichts Außerordentliches enthält: und trotzdem ist alles, was zwischen 1250 und 1530 in Italien geschieht, farblos im Vergleich zu der Geschichte dieser einzigen Stadt. Ihre inneren Bewegungen überbieten an Glanz die Anstrengungen der anderen nach innen und außen. Die Schicksale, durch deren Verirrungen sie sich mit jugendlicher Unverwüstlichkeit durcharbeitet, die Männer, die sie hervorbringt, erhöhen ihren Ruhm über den von ganz Italien und stellen Florenz Athen wie eine jüngere Schwester an die Seite.
Die ältere Geschichte der Stadt vor den Tagen ihres höchsten Glanzes verhält sich zu den späteren Ereignissen wie die Kämpfe der homerischen Helden zu dem, was in historischen Zeiten in Griechenland geschah. Der unaufhörliche Sturm der feindlichen Adelsparteien gegeneinander, der Jahrhunderte ausfüllt und mit der Vernichtung aller endete, hat im großen wie in den Einzelheiten den Gang eines Heldengedichtes. Mit dem Streit zweier Familien, durch eine Frau herbeigeführt, mit Mord und Rache im Gefolge, beginnen diese Kämpfe, in die die gesamte Bürgerschaft hineingerissen wird, und immer ist es die Leidenschaft der Führer, welche die sinkenden Flammen zu neuem Leben entfacht. Aus ihrer Asche endlich entwuchs das eigentliche Florenz. Es hatte jetzt keinen kriegerischen Adel mehr wie Venedig, keine Barone und Päpste wie Rom, keine Flotte, keine Soldaten, kaum ein Territorium. Innerhalb seiner Mauern saß ein launiges, geiziges, undankbares Volk von Parvenüs, Handwerkern und Kaufleuten, das bald hier, bald dort von der Energie oder den Intrigen fremder und einheimischer Tyrannei unterjocht worden wäre und endlich erschöpft seine Freiheit wirklich dahingab; – und gerade die Geschichte dieser Dinge von solchem Glanze umgeben und diese Begeisterung des eigenen Volkes heute noch beim Andenken an seine Vergangenheit!
Was in der Natur uns und in der Kunst, dieser höheren Natur, die der Mensch geschaffen hat, anzieht, das gilt auch von den Taten der einzelnen Menschen und Völker. Eine unbegreifliche, verlockende Melodie, die aus den Begebenheiten ausströmt, macht sie bedeutend und begeisternd. So möchten wir leben und handeln, das miterrungen, dort mitgekämpft haben. Es wird uns klar, dieses sei das wahre Dasein. Die Ereignisse reihen sich zum Kunstwerk aneinander, ein wunderbarer Pfad verbindet sie allgesamt, es sind keine abgerissenen, erschütternden Schläge, daß wir erschrecken wie beim Sturze eines Felsens, durch den der Boden aufzittert, der Jahrhunderte lang still dalag und dann wieder auf Jahrhunderte vielleicht in die alte Ruhe zurücksinkt. Denn nicht die Ruhe, die Ordnung, das gesetzmäßige Fortschreiten auf geebneten Wegen des Friedens verlangen wir zu gewahren oder darauf dann den erschreckenden Bruch des Altgewohnten und das Chaos, das ihm nachfolgt, sondern Taten und Charaktere ergreifen uns, deren Anfang eine Folge verspricht und einen Abschluß ahnen läßt, wo die Kräfte der Menschen und Völker sich spannen, und unser Gefühl von den Dingen einem harmonischen Ziele entgegenstrebt, das wir erhoffen oder fürchten und das wir sie am Schlusse erreichen sehen.
Unser Wohlgefallen an den Begebenheiten hat keine Ähnlichkeit mit der Genugtuung, in der sich etwa ein moderner Polizeibeamter über die vortrefflichen Zustände eines Landes ausspräche. Es gibt sogenannte ruhige Zeiten, innerhalb deren dennoch die besten Handlungen wurmstichig erscheinen und ein geheimes Mißtrauen einflößen, wo Friede, Ordnung und unparteiische Gerechtigkeitspflege Worte ohne echten Inhalt sind und Frömmigkeit sogar wie Blasphemie klingt, während in anderen Epochen offen daliegende Verdorbenheit, Fehler, Unrecht, Laster und Verbrechen nur die Schatten eines großen erhebenden Gemäldes bilden, dem sie erst die rechte Wahrheit verleihen. Je schwärzer die dunklen Stellen, je heller die leuchtenden. Eine unverwüstliche Kraft scheint beide zu bedingen und zu bedürfen. Wir werden nicht hinters Licht geführt, das ist unsere innige Überzeugung. Es ist alles so klar, so deutlich, so verständlich. Der Kampf der unabwendbaren finsteren Notwendigkeit mit dem Willen, dessen Freiheit nichts besiegen kann, ergreift uns. Auf beiden Seiten sehen wir große Kräfte sich erheben, die Ereignisse gestalten, in ihnen untergehen oder sich über ihnen emporhalten. Wir sehen das Blut fließen, die Wut der Parteien durchzuckt uns wie ein Wetterleuchten noch von längst verrauschten Gewittern, wir stehen hier oder dort und kämpfen mit in den alten Schlachten noch einmal. Aber Wahrheit wollen wir, keine Verheimlichung der Zwecke und der Mittel, mit denen man sie erreichen wollte. So sehen wir die Völker kochen, wie die Lava im Krater eines feuerspeienden Berges sich in sich selbst empört, und aus dem Kessel klingt das zauberhafte Lied, an das wir uns erinnern, wenn »Athen« oder »Florenz« ausgesprochen wird.
II
Wie arm erscheint jedoch der Inhalt der italienischen Stadt gegen den Reichtum der griechischen. Ganze Reihen großer Athener treten auf, wo nur einzelne Florentiner sich zeigen könnten. Athen übertrifft Florenz so weit als die Griechen die Romanen übertrafen. Aber uns steht Florenz näher. Bei der Geschichte Athens gehen wir weniger sicher, und die Stadt selbst ist bis auf geringe Trümmer von ihrem alten Felsenboden fortgefegt. Florenz lebt noch. Wenn man heute von der Höhe des alten Fiesole, das nördlich über der Stadt am Gebirge klebt, herabsieht, liegen der Dom von Florenz, Santa Maria del Fiore oder Santa Liparata genannt, mit seiner Kuppel und dem schlanken Glockenturm und die Kirchen, Paläste und Häuser und die Mauern, die sie einschließen, noch so vor unseren Blicken in der Tiefe, wie sie vor langen Jahren getan – alles aufrecht und unverfallen. Die Stadt ist wie eine Blume, die in dem Momente, wo der Trieb des Wachstums am vollsten war, statt zu verwelken, gleichsam in Versteinerung überging. So steht sie heute, und wer der alten Zeiten nicht gedenkt, dem scheint auch nicht das Leben und der Duft zu fehlen. Manchmal möchte man glauben, es sei noch wie vordem, wie uns der Mondschein zuweilen in den Kanälen Venedigs die alte Zeit des Glanzes zurücklügt. Aber die alte Gesinnung ist verschwunden, und der Nachwuchs großer Männer ist lange ausgeblieben, der frisch aufschoß Jahr für Jahr vor alters.
Dennoch lebt das Andenken an die Männer und an die alte Freiheit. Mit andächtiger Sorgfalt wird ihre Hinterlassenschaft aufbewahrt. Mit Bewußtsein in Florenz zu leben, ist für einen gebildeten Mann nichts anderes als ein Studium der Schönheit eines freien Volkes bis in ihre feinsten Triebe. Die Stadt hat etwas die Gedanken Durchdringendes, Beherrschendes. Man verliert sich ganz in ihrem Reichtum. Indem man fühlt, wie alles sein Leben aus der einen Freiheit sog, gewinnt die Vergangenheit in den geringsten Beziehungen einen Zusammenhang, der für das übrige Italien fast verblenden kann. Man wird ein fanatischer Florentiner im alten Sinne. Die schönsten Bilder Tizians fingen an uns gleichgültig zu werden über dem Verfolgen der florentinischen Kunstentfaltung in ihrem fast minutenweise erkennbaren Fortschritte vom unbeholfensten Anfang bis zur Vollendung. Die Geschichtsschreiber zogen mich in die Verwickelungen ihrer Zeit, als würde ich in die Geheimnisse lebender Personen eingeweiht. Man geht in den Straßen noch, wo sie gingen, überschreitet die Schwellen, die sie betraten, sieht aus den Fenstern herab, an denen sie gestanden. Florenz ist niemals erstürmt, zerstört oder durch eine allverheerende Feuersbrunst verändert worden; die Bauten, von denen berichtet wird, fast wie sie Stein auf Stein heranwuchsen, stehen da und reizen und belohnen unsere Augen. Wenn mich, den Fremdling, das so magnetisch an sich zog, wie stark muß das Gefühl gewesen sein, mit dem die alten, freien Bürger an ihrer Vaterstadt hingen, die für sie die Welt bedeutete. Ihnen schien es unmöglich, anderswo zu leben und zu sterben. Daher die tragischen, oft wahnsinnigen Versuche der Verbannten, in die Heimat zurückzukehren. Unglücklich, wer abends nicht auf diesen Plätzen seinen Freunden begegnen durfte, wer nicht in der Kirche San Giovanni getauft war und seine Kinder dort taufen lassen durfte. Sie ist die älteste Kirche der Stadt und trug in ihrem Innern die stolze Inschrift, erst am Tage des Weltgerichts werde sie zusammenstürzen. Ein so guter Glaube wie der der Römer, denen die Dauer des Kapitols die Ewigkeit war. Horaz sang: so lange würden seine Lieder dauern, als die Priesterin die Stufen dahinanstiege.
Ihre Freiheit hat Athen und Florenz so groß gemacht. Frei sind wir, wenn unserer Sehnsucht Genugtuung geschehen darf, alles, was wir tun, zum Besten des Vaterlandes zu tun, selbständig aber und freiwillig, uns als einen Teil des Ganzen zu gewahren und, indem wir fortschreiten, seinen Fortschritt zugleich zu befördern. Dies Gefühl muß stärker sein als jedes andere. Bei den Florentinern überragte es die blutigste Feindschaft der Parteien und der Familien. Die Leidenschaften beugten sich ihm. Die Stadt und ihre Freiheit lag jedem zunächst am Herzen. Um dieser Freiheit willen die unendlichen Kämpfe. Keine äußere Gewalt sollte sie unterdrücken, keine im Innern der Stadt selbst berechtigter sein als andere, jeder Bürger verlangte mitzuwirken für das allgemeine Beste, kein Dritter sollte erst den Vermittler abgeben, um diese seine Teilnahme zu ermöglichen. Solange diese Eifersucht auf das persönliche Recht am Staate in den Gemütern der Bürger dominierte, war Florenz eine freie Stadt. Mit dem Erlöschen dieser Leidenschaft sank die Freiheit zu Boden, und vergebens wurden so viele Kräfte angespannt, sie emporzuhalten.
Was Athen und Florenz vor anderen Staaten aber, die gleichfalls durch ihre Freiheit zur Blüte kamen, dennoch erhaben hinstellt, ist ein zweites Geschenk der Natur, durch welches die Freiheit, man könnte beides sagen, beschränkt oder erweitert wurde: die Fähigkeit einer ebenmäßigen Entwickelung aller menschlichen Kräfte in ihren Bürgern. Einseitige Stärke vermag viel zu schaffen, mögen Menschen oder Völker sie besitzen – Ägypter, Römer, Engländer sind großartige Beispiele dafür – die Einseitigkeit ihres Charakters aber findet sich in ihren Unternehmungen wieder und entzieht dem, was sie gestalteten, das Lob der Schönheit. In Athen und Florenz steigerte sich keine Regung in der Individualität des Volkes dauernd so sehr, um das Übergewicht über die andere zu erlangen. Geschah es zuweilen für kurze Zeit, so führte ein baldiger Umsturz der Dinge das Gleichgewicht zurück. Die florentinische Verfassung beruhte auf den momentanen Beschlüssen der stimmfähigen Bürgerversammlung. Jede Gewalt konnte auf gesetzliche Weise vernichtet und ebenso gesetzlich eine andere an ihrer Stelle errichtet werden. Es bedurfte nichts als einen Beschluß des großen Bürgerparlamentes. Es wurde dabei einfach abgestimmt. So lange die große Glocke läutete, welche die Bürger auf den Platz vor dem Regierungspalaste zusammenrief, durfte auf offener Straße jede Sache, die einer etwa gegen den anderen auf dem Herzen hatte, mit bewaffneter Hand zum Austrag kommen. Das Parlament war die gesetzlich eingerichtete Revolution für den Fall, daß der Wille des Volkes mit dem der Regierung nicht mehr stimmte. Die Bürgerschaft verlieh dann einem Ausschuß diktatorische Befugnisse. Die Ämter wurden neu besetzt. Alle Ämter waren allen Bürgern zugänglich. Jeder war zu jeder Stelle befähigt und berufen. Was für Männer mußten diese Bürger sein, die bei so beweglichen Institutionen einen festen Staat bildeten! Herzlose Kaufleute und Fabrikanten: aber wie kämpften sie um ihre Unabhängigkeit! Egoistische Politik und Handel ihr einziges Interesse: aber wie dichteten sie und schrieben die Geschichte ihres Vaterlandes! Geizige Krämer und Geldwechsler: aber in fürstlichen Palästen! Und diese Paläste von eigenen Meistern erbaut und mit Malereien und Bildhauerarbeiten geschmückt, die gleichfalls innerhalb der Stadt gewesen waren! Alles treibt Blüten, jede Blüte bringt Früchte. Das Geschick des Vaterlandes ist wie eine Kugel, die in ewiger Bewegung dennoch immer auf dem richtigen Punkte ruht. Jedes florentinische Kunstwerk trägt ganz Florenz in sich. Dantes Gedichte sind ein Produkt der Kriege, der Unterhandlungen, der Religion, der Philosophie, des Geschwätzes, der Fehler, der Laster, des Hasses, der Liebe, der Rache der Florentiner. Alles arbeitete unbewußt mit, es durfte nichts fehlen. Nur aus einem solchen Boden konnte ein solches Werk emporsprießen. Nur aus athenischem Geiste konnten die Tragödien des Sophokles und Äschylus hervorgehen. Die Geschichte der Stadt hat ebensoviel Anteil an ihnen als das Genie der Männer, in deren Geiste die Phantasie und die Leidenschaft nach Worten suchte.
Es ist ein Unterschied, ob ein Künstler der selbstbewußte Bürger eines freien Landes oder der reichbelohnte Untertan eines Herrschers ist, in dessen Ohren Freiheit wie Aufruhr und Verrat klingt. Frei ist ein Volk, nicht weil es keinem Fürsten gehorcht, sondern weil es aus eigenem Antriebe die höchste Autorität liebt und aufrecht hält, mag diese nun ein Fürst oder eine Aristokratie mehrerer sein, die die Herrschaft in Händen halten. Ein Fürst ist immer da; in den freiesten Republiken gibt ein Mann zuletzt den Ausschlag. Aber er muß dastehen, weil er der Erste ist und alle seiner bedürfen. Nur wo jeder einzelne sich als einen Teil der allgemeinen Basis empfindet, auf der das Staatswesen beruht, kann von Freiheit und Kunst die Rede sein. Was haben die Bildsäulen in der Villa des Hadrian mit Rom und den Wünschen Roms zu schaffen? Was die gewaltigen Säulen der Bäder des Caracalla mit dem Ideale des Volkes, in dessen Hauptstadt sie erstanden? In Athen und Florenz aber, konnte man sagen, sei keine Quader auf die andere gelegt worden, kein Bild, kein Gedicht entstanden, ohne daß die ganze Bevölkerung Gevatter stand. Ob Santa Maria del Fiore umgebaut, ob die Kirche San Giovanni ein paar goldene Tore erhalten, Pisa belagert, Frieden geschlossen oder ein toller Karnevalszug gefeiert werden sollte: jedermann ging das an, es war dasselbe allgemeine Interesse, das sich dabei betätigte. Die schöne Simoneta, das schönste junge Mädchen in der Stadt, wird begraben; ganz Florenz folgt ihr, die Tränen in den Augen, und Lorenzo Medici, der erste Mann im Staate, dichtet ein klagendes Sonett auf ihren Verlust, das in aller Munde ist. Eine neu gemalte Kapelle wird eröffnet: Keiner darf dabei fehlen. Ein Wettrennen durch die Straßen veranstaltet: Teppiche hängen aus allen Fenstern herunter. Wie einzig schöne Menschengestalten stehen die beiden Städte vor uns da, ganz von weitem betrachtet, – wie Frauen mit dunkelen, traurigen Blicken und lächelnden Lippen dennoch; treten wir näher, so scheint es eine große, einige Familie; sind wir mitten darunter, so ist es wie ein Bienenkorb von Menschen: Athen und sein Schicksal ein Symbol des gesamten griechischen Lebens, Florenz ein Symbol der italienisch-romanischen Blütezeit. Beide, so lange ihre Freiheit währte, ein Abglanz des goldenen Zeitalters ihres Landes und Volkes, nachdem die Freiheit verloren war, ein Bildnis des Verfalls beider bis zu ihrem endlichen Untergange.
III
Es ist nichts darüber bekannt, wie das antike Florentia in das moderne Fiorenza oder Firenze überging und ob es aus den römischen Zeiten den Charakter einer Fabrikstadt mitgebracht. Nicht einmal aus der hohenstaufischen Epoche wissen wir, in welchem Verhältnis die Bevölkerung sich in Adel und gewerbetreibenden Bürgerstand teilte. Damals lag die Stadt am nördlichen Ufer des Arno, innerhalb gering umfassender Mauern, zwischen denen und dem Flusse ein breiter Raum war. Dahinaus aber vergrößerte man sich bald, schlug Brücken hinüber und setzte sich an der anderen Seite fest.
Die Besiegung Fiesoles war die erste große Tat der florentinischen Bürgerschaft. Die Fiesoleaner mußten sich in der Tiefe ansiedeln. Pisa jedoch, das nach Westen hin am Meere lag, war größer und mächtiger. Pisa besaß eine Flotte und Häfen, der florentinische Handel war abhängig von dem seinigen. Nirgends hatte Florenz freien Zusammenhang mit dem Meere, Lucca, Pistoia, Arezzo, Siena, lauter neidische und kriegerische Städte, umkränzten es mit ihren Gebieten. In ihnen aber, wie in Florenz, saßen mächtige Adelsgeschlechter, in deren Händen die Herrschaft lag.
Die Kämpfe dieser Herren im einzelnen und die der Parteien, in die sie sich der Masse nach teilten, bilden das Schicksal Toskanas, solange die Hohenstaufen die Welt regierten. Florenz gehörte zu der Erbschaft der Gräfin Mathilde, die der Papst beanspruchte, weil ihm das Land vermacht worden sei, der Kaiser, weil über kaiserliches Lehen so nicht verfügt werden dürfe. Dieser Streit gab den Parteien in Toskana feste Anhaltspunkte. Ein Teil des Adels stand auf für die Rechte der Kirche, der andere, um die des Kaisers zu verteidigen. Die Zukunft der Stadt fiel dem Ausgang des Krieges anheim, der zur Entscheidung der brennenden Frage alsbald in gewaltsamen Taten aufloderte.
War die kaiserliche Partei in Italien siegreich, so triumphierten auch in Florenz ihre Anhänger; hatten die Nationalen die Oberhand, so siegte auch in Toskana die Partei des Papstes. Als die lombardischen Städte von Barbarossa gedemütigt wurden, brachen die kaiserlich Gesinnten los in Florenz und versuchten die öffentlichen Behörden, die von ihren Gegnern befestigt worden waren, aus ihrer Stellung zu treiben. Als das Glück des Kaisers dann einen Umschlag erfuhr, kehrte die Macht seiner Feinde auch in Toskana zurück. Unter der Protektion des Papstes schlossen sich die tuskischen Städte zu einem Verband zusammen, dessen Vorort Florenz war.
So lagen die Dinge zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, als die Namen Guelfen und Ghibellinen aufkamen und, was bisher ein dumpfer Widerstreit gewesen, zu einem Kampfe mit ausgebildeten Prinzipien ward. Im Jahre 1213 begannen die Guelfen und Ghibellinen in Florenz sich zu befehden. Im Jahre 1321 starb Dante. Das Jahrhundert zwischen beiden Ziffern bildet den Inhalt seiner Gedichte, deren Verse der heldenmütigen Epoche, die sie schildern, ebenso natürlich entsprechen wie die reine Sprache Homers den Taten der Hellenen vor Ilion.
Verzeichnisse der Familien, wie sie hüben und drüben standen, sind aufbewahrt. Wir kennen die Lage ihrer Paläste, kleiner Kastelle, die auf Abwehr von Sturm und Belagerung eingerichtet waren. Wir verfolgen von Jahr zu Jahr die unheilvollen Verhältnisse. Alte berühmte Häuser kommen herab, neue erheben sich aus kleinen Anfängen zu Macht und Ansehen. Ununterbrochen neben dem innerlichen Zwiespalt Kriege mit den Nachbarn, mit Pisa voran, das den Weg zum Meere in der Hand hatte, bald mit der ganzen Nachbarschaft. Im Moment der Gefahr vereinigen Versöhnung, Waffenstillstände und Verträge die sich zerfleischenden Parteien zu gemeinsamer Kraft gegen die Feinde des Vaterlandes. Nach dem Siege aber erwacht in den eigenen Mauern der alte Hader zu neuem Unheil.
Meistens lag der Grund der äußeren Verhältnisse in den inneren selber. Die Guelfen von Florenz, wenn sie die Leitung der Dinge in Händen hatten, drängten zum Kriege gegen die Ghibellinen von Pisa oder Pistoia. Die Florentiner Ghibellinen verweigern dann, mit auszuziehen gegen die eigenen Parteigenossen. So stand Toskana in Flammen, die nicht zu dämpfen waren. Denn gelang es der einen Partei, die andere aus der Stadt hinauszudrängen, so lagen die Vertriebenen draußen in ihren Kastellen, bis dicht vor den Toren, um den günstigen Moment der Rückkehr zu erwarten. Geschlagen sein war nicht überwunden sein. Im schlimmsten Falle kam Zuzug und Geld aus der Ferne. Der Kaiser selbst sandte den unterdrückten Ghibellinen deutsche Ritter zu Hilfe.
Dem gewerbetreibenden Bürgerstand jedoch kam dieser Zustand der großen Herren wohl zustatten. Aus heraufgekommenen Kaufleuten bildete sich ein drittes Element, das in die Kämpfe des Adels mächtig eingriff und ihn zu Konzessionen nötigte. Die städtischen Behörden erstarkten; mitten in den verderblichsten Unruhen nahm Florenz zu an Umfang und Bevölkerung. Im Jahre 1252 war Pisa schon nicht halb so bedeutend mehr. Ein Handelsvertrag mit den Pisanern wurde abgeschlossen, sie nahmen florentinisches Maß und Gewicht an. Um diese Zeit war es, wo Manfred, der letzte hohenstaufische König von Neapel, allein die Ghibellinen in Toskana hielt. Als er zum letzten Male Hilfe sandte, machten seine achthundert Ritter, meistens Deutsche, mit den Ghibellinen von Florenz, Siena, Pisa, Prato, Arezzo und Pistoia vereint dreitausend gewappnete Ritter aus.
Die Guelfen unterlagen und räumten das Land. Bald aber nach dem Untergange Manfreds ziehen sie wieder auf Florenz los, das nun von den Ghibellinen verlassen wird. Karl von Anjou, der französische neue König von Neapel, übernimmt die Protektion der Stadt, und die Bürgerschaft gibt sich eine neue Verfassung, die Grundlage ihrer späteren Unabhängigkeit. Mochte der Adel Frieden schließen oder neu in den Kampf gehen, immer war es ein Signal für die Bürgerschaft, zur Erweiterung ihrer Rechte einen frischen Anlauf zu tun.
Damit diese Rechte aber ein um so sicherer Besitz wären, strebte man danach, die Kastelle des Adels außerhalb der Stadt zu zerstören, zu kaufen und sie durch Verbote auf einen weiten Umkreis von der Stadt ab zurückzudrängen. In Florenz selber mußten die gefährlichen Türme abgetragen werden, von denen herab man auslugte und Geschosse schleuderte. Zu spät empfanden die großen Herren die Folgen ihrer wütenden Selbstvernichtung. Die Ghibellinen waren unterdrückt, aber der siegreiche guelfische Adel stand geschwächt einer stolzen Bürgerschaft gegenüber, deren reiche Familien sich rittermäßig wie der Adel hielten. Neue Verfassungen gaben den Zünften, die sich zu bilden anfingen, größeren und größeren Raum, und zuletzt stand als Ziel dieser mächtigen Demokratie die Absicht da, denjenigen allein Anteil am Staate zuzugestehen, die Mitglieder der Zünfte wären. Der alte Adel sollte sich aufnehmen lassen oder völlig ausgeschlossen sein.
Alles dies jedoch ging langsam vor sich, große Erschütterungen führten stets nur kleine Schritte vorwärts. Es gab Epochen der Ruhe, glücklichere Zeiten, in denen sich die Parteien zu friedlichem Nebeneinanderleben vereinigten. Eine solche Stille trat ein in den letzten Jahrzehnten des dreizehnten Jahrhunderts, als mit dem Untergange der Hohenstaufen die Idee des alten Kaiserreiches sich aufzulösen begann und die neue Grundlage des europäischen Staatenlebens immer lebendiger in den Gemütern ward: die getrennten Völker sollten von nun an ihre eigenen Wege verfolgen. Damals wurde der Bann des alten römisch-byzantinischen Wesens zuerst gebrochen. Nationales Bewußtsein durchdrang Kunst und Literatur und äußerte sich in neuen Formen. Diese Zeiten sind es, in die Dantes Geburt und Jugend fällt.
Florenz erweiterte zum dritten Male die Ringmauern. Arnolfo, der berühmte Architekt, begann die Kirchen zu errichten, die heute noch als die größten und schönsten der Stadt dastehen, Santa Maria del Fiore die vornehmste. Er baute in einem neuen Stile, dem gotischen, oder, wie die Italiener sagten, dem deutschen, dessen freie, hochstrebende Verhältnisse an die Stelle der mehr gedrückten und in die Breite sich ausdehnenden Dimensionen traten, in denen bis dahin gebaut worden war. Wie die Herrschaft der Hohenstaufen als die äußerste Entwickelung des antiken Römerreiches anzusehen ist, so erscheint auch die Kunst bis auf ihre Zeiten als die letzte Blüte der antiken Anschauungen.
Dante redet von den Tagen seiner Jugend wie von seinem verlorenen Paradiese. Aber er war kein Dichter, der in einseitige Träumereien versunken ein abgeschlossenes Dasein geführt hätte. Er war Soldat, Staatsmann und Gelehrter. Er kämpfte in Schlachten mit, nahm teil an wichtigen Gesandtschaften und schrieb gelehrte und politische Werke. In seiner Jugend ein Guelfe, wurde er zum wütenden Ghibellinen und schrieb und dichtete für seine Partei, die noch einmal auf die Ankunft eines deutschen Kaisers überschwenglich ideale Hoffnungen setzte. Heinrich von Luxemburg erschien im Jahre 1311. Aber für ihn hatten die alten Parteinamen den alten Inhalt verloren. Er sah, daß Guelfen und Ghibellinen ihn für die eigenen Zwecke zu benützen wünschten, und hielt sich, gleichfalls die Richtung verfolgend, die ihm für die eigene Politik am nützlichsten dünkte, auf einem Mittelwege, der ihn siegreich weiterführte, ohne einer von den streitenden Parteien den Sieg zu verleihen. Bald machte der Tod seinem Wirken ein Ende, und nach seinem Verschwinden blieb im Lande kaum eine Spur seines Daseins zurück.
Sein Zug durch Italien ist von Dino Compagni, einem Florentiner und Freunde Dantes, beschrieben worden. Die Chronik dieses Mannes in ihrer einfach schönen Prosa bildet ein Seitenstück zu Dantes Gedichten. Der Zusammenklang zweier Welten, der antiken und modernen, erfüllt ihrer beider Werke. Sie gebrauchen die Sprache, wie die besten alten Autoren die ihrige, naiv und ohne Mißbrauch ihrer Gelenkigkeit. Dante nennt die Dinge und Gefühle schlechthin, wie er sie erblickt und empfindet. Wenn er den Himmel beschreibt und den Auf- und Niedergang der Gestirne, ist es der Himmel Hesiods, oder wenn er uns an den Strand des Meeres führt, scheint es dasselbe Gestade zu sein, an dem Thetis den verlorenen Sohn betrauerte oder dessen Wellen zu Odysseus' Füßen rollten, als er von der Insel der Kalypso hinausblickte und bei den ziehenden Wolken an den aufsteigenden Rauch seiner Heimat dachte. Dante vergleicht unbefangen die kaum geöffneten lichtscheuen Augen der wallenden Gespensterscharen in der Unterwelt mit den zusammengekniffenen Augen eines Schneiders, der seine Nadel einfädeln will.
Sein Gedicht ist die Frucht arbeitsamer Versenkung in den Geist der italienischen Sprache. Ihre Worte mußte er wie eine Schar wilder Pferde, die noch niemals im Geschirr gegangen waren, mühsam einfangen und zusammenhalten. Sein stolzes vollwichtiges Italienisch sticht wunderlich ab gegen das abgeschliffene konventionelle Latein, in dem er bequemer schrieb. Da ist er scharf, gebildet und elegant, während seine italienischen Sachen klingen, als hätte er sie selbst im Traume geschrieben. In seinen lichten Versen liegt etwas von der Wehmut, zu der uns oft der Anblick der Natur stimmt, von jener Trauer ohne Ziel, die ein kühler glühender Sonnenuntergang im Herbste in uns herauflockt. Dantes Schicksal steht vor uns wie das Leiden eines verbannten Hellenen, der am Hofe eines Barbarenfürsten Gastfreundschaft genießt, während Haß und Sehnsucht an seinem Herzen nagen. Man sieht mehr zu Zeiten, als man vielleicht zu sehen ein Recht hat: wenn ich Dantes Kopf betrachte, wie ihn Giotto mit wenigen wundervollen Linien in der Kapelle des Bargello auf die Wand malte, da scheint in den sanften Zügen sein ganzes Leben zu liegen, als überschattete seine jugendliche Stirn eine Ahnung, wie die Zukunft sich ihm gestalten sollte.
Dante starb in der Verbannung, keines seiner politischen Ideale gestaltete sich zur Wirklichkeit. Die Nationen steckten zu tief in ihrer eigenen Unordnung, um für die allgemeine europäische Politik Kraft und Begeisterung übrig zu haben. Die Päpste zogen nach Avignon, Rom stand leer, Italien blieb sich selbst überlassen. Die hundert Jahre, welche dieser Zustand dauerte, sind die zweite Epoche in der Entwicklung der florentinischen Freiheit und bilden zugleich das erste Säkulum der erblühenden Kunst, die in Giotto ihren ersten großen Arbeiter findet.
IV
Man pflegt Cimabue den Gründer der neuen Malerei zu nennen. Seine Tätigkeit fällt in die Zeit, wo Dante geboren wurde. Seine Werke erregten Staunen und Bewunderung. Cimabue malte in der Weise der byzantinischen Meister starre umfangreiche Madonnenbilder. Man möchte heute diesen Einfluß der byzantinischen Kunst auf die frühitalienische auf das geringste Maß beschränkt wissen und einer mit der antiken Kunst in direkter Verbindung stehenden inländischen Entwickelung das Wort reden. Sei dem so für Cimabue; Giotto aber, den er der Legende nach als Hirtenjungen auf dem freien Felde antraf, wie er sein Vieh auf große flache Steine abbildete, ihn seinem Vater abforderte, mit nach Florenz nahm und unterrichtete, darf dennoch kaum als sein Schüler bezeichnet werden. Von Cimabue zu Giotto geht es steil in die Höhe. Giotto scheint seinem Meister fremd und fast zusammenhanglos gegenüberzustehen.
In den Zeiten, in denen er arbeitete, lag der geistige Schwerpunkt Europas nicht in Italien. Dante, der in Paris seine Studien gemacht, emanzipierte sich mühsam von der Herrschaft des provenzalischen Dialekts und des Lateins. Französischen Einfluß dürfen wir annehmen auch bei Giotto. Seine zarten Gestalten, die der naivsten Naturbetrachtung entsprossen scheinen, tragen dennoch zu viel der Miniaturmalerei in sich, um die Schule ganz zu verleugnen, in der ihr Meister, scheint es, zeichnen lernte.
Es ist nicht leicht, von seiner Tätigkeit eine klare Vorstellung zu haben. Sie umfaßte den ganzen Bereich der Kunst. Es muß viel Handwerksmäßiges dabei im Spiele gewesen sein. Dennoch ermangelt er nicht individueller Kraft. Dantes Porträt, jetzt wohl Giottos berühmteste Arbeit, bewahrt in dem traurigen Zustande, in dem es sich befindet, etwas großartig Persönliches im Schwunge der Linien. Der Umriß scheint der Ausfluß einer starken Hand, die in reinen Strichen nachzog, was die Augen sahen und der Geist empfunden hatte. Kein Künstler würde inhaltsreicher den nackten Umriß eines solchen Gesichts zu zeichnen vermögen, das, obgleich verdorben, restauriert und teilweise ganz erneuert, durchdrungen und verklärt von der Würde dessen ist, dem es angehörte. Die Madonnen, die man Giotto zuschreibt, tragen den Ausdruck trauriger Lieblichkeit im Antlitze. Gedrückte, kaum geöffnete, langgeschlitzte Augen, ein Nachklang des byzantinischen Madonnentypus, ein wehmütig lächelnder Mund sind ihnen eigentümlich. Seine Hauptarbeiten waren jedoch nicht seine Tafelbilder mit wenigen Figuren in oft sehr geringem Formate, sondern Freskogemälde, mit denen er ganz Italien versorgte. Vom Könige von Neapel in seine Hauptstadt berufen, malte er dort Kirchen und Paläste, in der Lombardei führte er große Werke aus, nach Rom und vielleicht Avignon verlangten ihn die Päpste. Überall, wo man ihn begehrte, war er rasch zu Diensten. Er arbeitete als Maler, Bildhauer und Architekt. Er stand mit den großen Herren auf gutem Fuße und gab ihnen derbe Antworten. Boccaccio zeichnet seine Persönlichkeit nicht allzu idealisch. Giotto war klein, unansehnlich, ja häßlich, gutmütig, aber mit scharfer Zunge begabt, wie alle Florentiner. Auch Dante konnte beißende Antworten geben. Villani, sein Zeitgenosse, erzählt, wie er Dummheit und Anmaßung hart abzufertigen wußte, während man dem Eindrucke seiner Verse und seines traurigen Schicksals nach glauben sollte, er habe sich in vornehmem Schweigen abgewandt, wenn unter ihm stehende Naturen seinen Stolz auf die Probe stellten.
Dante und Giotto blieben Freunde bis zu Ende ihres Lebens. Als Giotto auf der Rückreise von Verona durch Ferrara kam, und Dante in Ravenna hörte, daß er ihm so nahe sei, brachte er es dahin, daß er nach Ravenna berufen wurde. Die Malereien aber, die er im dortigen Dome ausgeführt hat, sind zugrunde gegangen.
Das Schicksal war seinen Werken nicht günstig. Dem Bildnisse Dantes hatte man gerade ins Auge einen Nagel eingeschlagen. Noch im vorigen Jahrhundert wurden Kirchenwände in Neapel übertüncht, die von Giotto gemalt waren. Ein Florentiner Bild, dem Vasari das höchste Lob erteilt, kam während der Zeit zwischen der ersten und zweiten Auflage seines Buches aus der Kirche abhanden, in der es befindlich war. Es stellte den Tod der Maria dar mit den Aposteln ringsumher, während Christus die auffliegende Seele in seine Arme aufnimmt. Michelangelo soll es besonders geliebt haben. Es ist nie wieder zum Vorschein gekommen.
Das berühmteste Denkmal aber, das der Meister sich selbst gesetzt hat, bleibt der Glockenturm, der neben Santa Maria del Fiore wie ein alleinstehender schlanker Pfeiler von kolossaler Größe in die Luft steigt, viereckig und von oben bis unten mit Marmor bekleidet. So wenig Arnolfo den Schluß des ungeheuren Dombaus selber erlebte, der noch anderthalb Jahrhunderte nach seinem Tode zur Vollendung bedurfte, ebensowenig war es Giotto vergönnt, seinen wunderbaren Turm zu Ende zu führen. Er hinterließ wie Arnolfo ein Modell, nach welchem weitergearbeitet wurde, wenn man auch daran änderte und am Schlusse des Werkes die gotische pyramidale Spitze fortließ, weil das Ende des Baues in Zeiten fiel, wo der deutsche Stil längst wieder aufgegeben und in Verachtung gefallen war.
Wie die Kirche, neben der er steht, alles an Größe übertreffen sollte, was auf Erden jemals gebaut worden wäre, so erhielt auch Giotto den Auftrag, einen Turm aufzurichten, der alles überragte, was griechische und römische Kunst hervorgebracht hätten. Die aus schwarzen und weißen Marmortafeln zusammengesetzte Oberfläche ist mit den schönsten Ornamenten und Bildhauerwerken bedeckt, die bis zur Höhe in bewunderungswürdigem Reichtum stichhalten. Die Gliederung der verschiedenen Etagen, die Fenster, die Skulpturen, wohin man blickt und aufmerksamer die Augen suchen läßt, bilden ein unvergleichliches Ganzes. Giotto verdiente die Ehre und die Geldbelohnung, die er dafür einerntete. Das Bürgerrecht, das er erhielt, war damals eine große Sache und der jährliche Gehalt von hundert Goldgulden keine Kleinigkeit.
Er starb 1336 .
Bis zum Ende des Jahrhunderts blieb sein Stil die formende Gewalt in der
florentinischen Kunst. Die Namen seiner Schüler und Nachahmer bieten nichts,
das über ihn hinausgeht. Es waren unerquickliche Zeiten, in denen keine höhere
Gewalt sich geltend macht in Italien als trüber kampfbegieriger Egoismus. Das
Land ist der Schauplatz unendlicher Streitigkeiten, deren verworrenes Wesen
durch keine hervorleuchtende Männergestalt edlere Bedeutung empfängt.
.
Bis zum Ende des Jahrhunderts blieb sein Stil die formende Gewalt in der
florentinischen Kunst. Die Namen seiner Schüler und Nachahmer bieten nichts,
das über ihn hinausgeht. Es waren unerquickliche Zeiten, in denen keine höhere
Gewalt sich geltend macht in Italien als trüber kampfbegieriger Egoismus. Das
Land ist der Schauplatz unendlicher Streitigkeiten, deren verworrenes Wesen
durch keine hervorleuchtende Männergestalt edlere Bedeutung empfängt.
V
Im Norden saßen die Visconti als die Herren von Mailand, wo sie Kaiser Heinrich bestätigt hatte. Durch sie blieb das ghibellinische nördliche Italien mit den Kaisern und Deutschland in Verbindung. Ihre besten Soldaten waren deutsche Ritter und Landsknechte.
Nach Osten hin war Venedig den Visconti zu stark, sie wandten sich nach Süden und brachten Genua in ihre Gewalt; damit war die ganze toskanische Küste, Lucca und Pisa, einst das Ziel der genuesischen Wünsche, nun ein Gegenstand der lombardischen Bestrebungen geworden. Das aber brachte Mailand mit Florenz zusammen, für welches der Besitz der beiden Städte notwendig war. Dazu der Gegensatz der politischen Gesinnung: Mailand der Mittelpunkt des deutsch-kaiserlich ghibellinischen Adels in Italien, Florenz das Nest des päpstlich nationalen Bürgertums in engster Verbindung mit dem französischen Neapel und mit Frankreich selber, dessen Könige die römische Kaiserwürde an sich zu reißen hofften. Toskana lag zwischen dem Norden und dem Süden wie der natürliche Kampfplatz der feindlichen Mächte, auf dem sie aneinanderstoßen mußten.
Florenz war eine von unruhigen Massen bewohnte Fabrikstadt. Es stellte sich bald heraus, daß eine unabhängige starke Gewalt die Stadt nach außen schützen müsse. Von den eigenen Bürgern konnte und durfte keiner so mächtig werden, um so viel zu vermögen; wir finden Florenz daher in den Händen fremder Fürsten, meist neapolitanischer Prinzen, die für schweres Gold mit ihren Truppen herbeigeholt werden. Es kam denen wohl der Gedanke, sich zu ständigen Herren aufzuwerfen. Dann aber zeigte sich die Gewalt der Bürgerschaft, die kein anderes Joch duldete als das, das sie freiwillig zu übernehmen gewillt war. Florenz blieb frei durch seine Demokratie, wie Venedig durch seinen Adel frei blieb.
Die anderen Städte Italiens fielen durch ihre Parteiungen einzelnen Familien oder fremder Herrschaft anheim. Die Dinge nahmen ihren naturgemäßen Verlauf in solchen Fällen. Zwei Parteien des Adels befehdeten sich, jede mit einer Familie, die die mächtigste innerhalb ihres Kreises war, als Oberhaupt. Hatte eine der Parteien dann gesiegt, so suchten sich diejenigen, welche ihre Führer gewesen waren, als Herren an der Spitze des ganzen Staates zu erhalten. Verschwägerungen, Mord und dadurch herbeigeführte Erbschaften, Verbindungen mit auswärtigen Häusern, die Ähnliches beabsichtigten oder bereits erreicht hatten, befestigten die neue Stellung. Diese Herrschaft ausdrücklich in eine erbliche zu verwandeln, war kaum notwendig, da es sich von Anfang an um die ganze Familie handelte, deren Fortbestand durch Todesfälle der Oberhäupter nicht unterbrochen wurde.
In Florenz waren seit den ältesten Zeiten solche Attentate an der Freiheitsliebe des Volkes gescheitert, auch in jenen Tagen, als es noch einen Adel in der Stadt gab. Merkte die siegreiche Partei, daß es nicht bloß auf die Niederwerfung ihrer Gegner, sondern auf die Erhebung ihres eigenen Chefs zur Herrschaft abgesehen sei, so versagte sie den Dienst. Alle Feindschaft schwand in solchen Momenten. Die Vertreibung des Herzogs von Athen, der 1343 zum Herrn der Stadt gemietet worden war und den es leicht dünkte, sie unter seine Botmäßigkeit zu bringen, ist eine der glänzendsten Taten der Florentiner. Verführt durch die Feindschaft der Parteien, glaubte er sich mit Hilfe der Aristokraten oben zu erhalten. Aber er trieb es nur kurze Zeit. Ein Aufstand brach aus, an dem sich jedermann ohne Unterschied der Farbe beteiligte, und der Herzog flüchtete vor dem empörten Volke, dem er nicht zu trotzen wagte. In jenem selben Jahre noch war es, wo dann in Florenz der letzte Kampf gegen die adligen Geschlechter gekämpft wurde, die nach der Vertreibung des Herzogs alsbald von neuem einander feindlich gegenübertraten. Es waren ihrer nicht viele mehr, sie wurden vernichtet, aber sie verkauften ihren Untergang teuer genug. Eine gewaltige Straßenschlacht entspann sich, das Volk eroberte die Paläste der Familien, wunderbar weiß Macchiavelli die Wut der Bürger und den verzweifelten Widerstand der Herren zu schildern, wie eine Familie nach der anderen hinsank und dann, als die Zünfte gesiegt hatten, diese nun selber bald darauf zu erneuten Kämpfen sich zu spalten begannen. Die höheren Zünfte waren jetzt »die Großen«, die Unterdrücker, gegen welche die niederen Zünfte, »das Volk«, die Waffen ergriff. Wiederum mächtige alte Familien, die die Partei der Großen bilden, während andere, die emporzukommen strebten, die ungeduldigen Wünsche des niederen Volkes zur Empörung reizen.
Diese Revolutionen sind es, aus denen endlich die Medici auftauchen. Gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts begannen sie sich zu erheben. Ihr Wachstum war ein natürliches und deshalb unaufhaltsam. Aus dem Zusammenwirken zweier unüberwindlicher Mächte: der Eigentümlichkeit des florentinischen Volkes und des eigenen Familiencharakters, sog es seine Nahrung, und eine Herrschaft bildete sich, die mit keiner anderen Füstenherrschaft verglichen werden kann.
Die Medici waren Fürsten und doch Privatleute. Sie herrschten unumschränkt und schienen niemals einen Befehl zu geben. Man könnte sie erbliche Ratgeber des florentinischen Volkes, die erbliche florentinische Vorsehung nennen, Inhaber, Erklärer und Vollstrecker der öffentlichen Meinung. Sie regierten ohne Titel und Mandat, ihre einzige Berechtigung floß aus ihrer Unentbehrlichkeit.
Der Reichtum der Familie war nur das äußerliche Werkzeug, mit dem sie arbeitete, die eigentlich treibende Kraft, welche sie zur Höhe steigen ließ, lag in dem Talente, Vertrauen zu gewinnen, ohne es zu fordern, den Willen durchzusetzen, ohne zu befehlen, und ihre Feinde zu besiegen, ohne sie anzugreifen. Ans Tageslicht traten nur ihre Erfolge, selten die Wege, auf denen sie sie erlangten. Hier scheuten sie kein Mittel. In einer Verteidigungsschrift, in welcher der Charakter des ersten Cosimo mit Leidenschaft oder vielmehr mit Wut in Schutz genommen wird, lesen wir zum Lobe dieses Vaters des Vaterlandes, er habe den römischen Kaiser vergiftet, um Italien vor seinem Einbruche zu retten! Verräterei und Gewaltsamkeit waren ihnen geläufig wie irgendeiner anderen Fürstenfamilie ihrer Zeiten, was sie aber auszeichnete vor ihnen, war die nationale, echt florentinische Weise, in der sie damit zu verfahren wußten. Sie waren feiner als die Feinsten in Florenz, fügsamer als die Schlausten, packten ihre Feinde mit unvermeidlicher Akkuratesse und verstanden es meisterhaft, sie in das Gefühl der Sicherheit einzuschläfern, in dem befangen sie sich greifen ließen. Kaltes Blut in den schwierigsten Momenten nützt ihnen mehr noch als die Bravour, die ihnen niemals fehlte, mit beiden aber ging ein wunderbares Glück Hand in Hand, und was sie wahrhaft verklärt, ist ihr auf höhere Kultur gerichteter Geist, die Freude am Schönen und die edelmütige Art und Weise, wie sie denen sich befreundeten, die in Kunst und Wissenschaften die Ersten waren. Ihre Verdienste und wiederum ihr Glück – denn das Schicksal begünstigte die edle Neigung in vollem Maße – sind hier so großartig, und dafür, daß die ganze Welt davon erfahre, hat der Genius der Geschichte so schön Sorge getragen, daß die Medici einzig dastehen als die Beschützer von Kunst und Wissenschaft.
Der erste Medici, dessen Schicksal sich in durchgreifender Weise in die Geschickte der Stadt einmischt, war Salvestro, im Jahre 1370 Gonfalonier von Florenz. Der Gonfalonier, die höchste Behörde, saß ein Jahr im Amte. Man kann es schlechthin und allgemein mit dem Titel Regierender Bürgermeister übersetzen, dem Wortlaut nach heißt es Bannerträger; der Gonfalonier führte das Banner der Gerechtigkeit zum Zeichen der obersten Gewalt, die in seinen Händen lag.
Salvestro, zugleich Anführer der demokratischen Partei, stürzte die Bürgerschaft in eine der gefährlichsten Revolutionen. Ohne sich offen zu kompromittieren, reizte er die Leute so lange, bis der Aufruhr ausbrach. Inmitten der Bewegung stand er darauf als loyaler Mann außerhalb allen Streites und offenbarte in seinen Manövern jenen Geist der Schlauheit und Energie, durch welchen seine Familie in späteren Zeiten immer siegreich blieb, sooft sie nur ihn rücksichtslos anzuwenden Kraft und Kühnheit besaß.
Der Zweck der demokratischen Partei, an deren Spitze sich die Medici stellten, war die Bekämpfung derjenigen Familien, welche sich innerhalb der reinen Zunftverfassung durch gemeinsame Reichtümer zur herrschenden Minorität aufgeworfen hatten. Die Medici nahmen unter ihnen den Rang nicht ein, welchen sie einzunehmen wünschten. Ihre Familie war keine von den angesehensten und ältesten. Statt nun jedoch innerhalb jener Aristokraten, denen sie gleichstellen wollten, sich eine Partei zu bilden, mit deren Hilfe sie dann vielleicht die großen Familien und das ganze Volk in Abhängigkeit gebracht hätten, machten sie die Sache des Volkes zu der ihrigen, vernichteten vereint mit ihm die Großen und traten dann ihre Erbschaft an.
Sosehr nun auch der Weg, den sie einschlugen, und die Hilfsmittel, deren sie sich bedienten, den schließlichen Erfolg als das siegreiche Spiel kalt angezettelter Intrigen erscheinen lassen konnten, so sehr bedurfte es dennoch der größten Geisteskraft, um als Sieger hervorzugehen. Eine Reihe der gefährlichsten Momente treten ein, in denen sich die Medici mit fürstlichem Takte benehmen. Das Aufsteigen dieser königlichen Bürger besteht aus einer Folge politischer Ereignisse, die immer umfassender werden. Das Reinmenschliche aber gab am Ende doch den Ausschlag, und Edelmut und Geistesgröße öfter als heimlich berechnende Hinterlist. Die Medici herrschten nicht bloß dadurch, daß sie die bösen Eigenschaften ihrer Mitbürger in der größten Potenz besaßen, sondern auch, weil sie das Vortreffliche des florentinischen Nationalcharakters stärker in sich trugen als irgendwer. Das Nachteilige tritt überall stark hervor, weil es deutlicher zu erkennen ist und sich in einzelnen Fällen mit Schärfe zeigt; das Gute, das mehr in einer allgemeinen Stimmung beruht und das selbst da, wo man es anerkannt hat, dennoch als etwas sich von selbst Verstehendes leicht übersehen wird, erblaßt dagegen und scheint kaum ein Verdienst zu sein. Deshalb mag auch wohl bei Salvestro weniger augenscheinlich ins Gewicht fallen, daß die Sache, der er diente, an sich eine gute und gerechte war. Man glaubt in zu hohem Grade zu erkennen, daß er sie nur benutzte. Er ging aus den Stürmen, die er angeblasen, mit dem Ruhme eines Demokraten hervor, den das Volk liebte, zugleich blieb er der Mann, den die Großen nicht entbehren konnten. 1388 starb er. Nach seinem Tode ward Veri dei Medici das Haupt der Familie. Die Streitigkeiten der höheren und niederen Zünfte um den Anteil an der Regierung dauerten fort. Die Aufstände nahmen kein Ende. Man mordete, man stürmte den mißliebigen Großen die Paläste, plünderte und steckte sie an. Hinrichtungen, Verbannungen, Konfiskationen oder Anrüchigkeitserklärungen, durch welche bedenklichen Persönlichkeiten auf gewisse Zeit die Ausübung der politischen Rechte entzogen ward, waren an der Tagesordnung. In ganz Italien herrschte um diese Zeit ein prinzipienloser Krieg aller gegen alle. Kaiser und Papst mischen sich hinein, kümmern sich aber, wie die übrigen, nur um niedere Vorteile. Die großen Gedanken sind in Vergessenheit geraten. Es mangelte in geistigen und politischen Dingen die letzte Instanz, bei der eine Entscheidung zu suchen wäre. Der Trieb, zu unterjochen und materielle Güter zu sammeln, war der einzige Grund der Ereignisse.
Vergleicht man unsere Tage, die von vielen verwirrt und haltlos gescholten werden, mit den damaligen Zeitläuften, so scheint der heutige Zustand ein ideal harmonisches Gefüge, wo Wahrheit, Würde und Langmut das Szepter führen, wo alle unedle Leidenschaft ihr Gift und selbst das Geld seinen Zauber verloren hat. Wir bilden uns manchmal ein, für Geld wäre heut alles zu haben: wie wenig aber scheinen wir mit diesem Werkzeuge ausrichten zu können, wenn wir jene verflossenen Strömungen der Geschichte betrachten. Welcher Fürst dürfte heutigen Tages so mit allem Handel treiben, was seiner Macht zugänglich ist, wie es damals geschah? Die Gewalt der öffentlichen Meinung, die heute mit finsterer Stirn auf die Handlungen der Fürsten und Völker herabblickt, existierte nicht. Das zwingende Gefühl politischer Sittlichkeit, das in den Gemütern erwacht ist, war etwas, das auch nicht die fernsten Ahnungen der Menschen berührte.
Die Herrschaft Cosmos dei Medici fällt zusammen mit dem Aufschwunge, der Italien aus dieser Versunkenheit aufriß. Wie rettende Inseln tauchten die Gedanken des antiken Geistes in der allgemeinen Sündflut empor; zu ihnen flüchtete man. Der Einfluß der griechischen Philosophie wurde neu lebendig. Die Medici sind aufs innigste beteiligt bei ihrem Wiederaufblühen. Von der Kunst jener Tage ist, ohne ihren Namen zu nennen, nicht zu erzählen. Die Vorteile, welche Florenz und seinen Bürgern von der Natur verliehen waren, wurden durch Cosmo erkannt und gesteigert, und so ist die Stadt zum Mittelpunkt Italiens gemacht, das jetzt an Bildung die übrigen Länder Europas überflügelte.
VI
Vier bedeutende Künstler treten auf in Florenz mit dem Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts: Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Masaccio. Märchenhaft ausgedrückt könnte man sagen, daß sie vier Brüder gewesen seien, die sich in ihres Vaters Giotto Erbschaft teilten und deren jeder die Grenzen seines Anteils zu einem großen Reiche ausdehnte. Diese vier sind die Gründer einer neuen Kunst, die nach vielen Jahren dann die Grundlage derjenigen ward, über deren Blüte keine folgende hinauswuchs.
Ghiberti begann als Goldschmiedslehrling. Zuerst arbeitete er in Giottos Manier. Den Übergang zu eigener Eigentümlichkeit lassen die Türen von San Giovanni am besten erkennen, welche heute noch, die bis auf wenige Spuren aufgezehrte Vergoldung ausgenommen, rein und unberührt an ihrer Stelle stehen.
Drei offene Tore hat die Kirche, das vierte nach Westen hin liegende ist zugemauert. Das östliche Haupttor war von Andrea Pisano mit erzenen Flügeln ausgefüllt, zu denen Giotto die Zeichnungen machte. Im Anfang des Jahrhunderts beschloß die Zunft der Kaufleute, eines der anderen beiden Tore ausführen zu lassen, und schrieb eine Konkurrenz der Künstler aus, welche auf die Ehre und den Gewinn ihre Ansprüche erheben wollten.
Ghiberti war damals 20 Jahre alt. Er hatte Florenz verlassen, wo die Pest herrschte, und malte in Rimini für Pandolfo Malatesta die Gemächer eines Palastes aus. Jetzt kehrte er in seine Vaterstadt zurück. Sechs Künstler beteiligten sich an dem Wettkampfe, unter ihnen Brunelleschi, der drei Jahre älter als Ghiberti, ihm hier zum ersten Male den Rang streitig machte.
Die Aufgabe war so gestellt, daß die eine vorhandene Tür als Muster dienen sollte. Jeder Flügel ist hier in eine Reihe übereinanderliegender Felder eingeteilt, jedes Feld enthält ein Bild in Basrelief. Die Herstellung eines einzigen solchen Bronzefeldes wurde gefordert und dafür die Zeit eines Jahres zugestanden. Vierunddreißig fremde und einheimische Meister hatte man als entscheidende Kommission hingestellt.
Ghiberti erfreute sich der Hilfe seines Vaters, bei dem er gelernt hatte und der ihn beim Guß des Erzes unterstützte. Es kam in dieser Konkurrenz nicht so sehr darauf an, sich durch eine geniale Erfindung etwa als den würdigsten Meister zu bewähren, sondern es sollte erprobt werden, wer, auf welche Weise immer, das vollendetste Stück Erzguß zu liefern imstande sei. Es handelte sich um Erfahrung und geschickte Behandlung des Materials. Ghibertis Arbeit wurde von tadelloser Ausführung befunden und ihm am 23. November 1403 das Werk übertragen. Eine Anzahl anderer Künstler gab man ihm zu Mitarbeitern. Wie viel jedes Jahr fertig werden mußte, war im Kontrakte genau festgestellt. Einundzwanzig Jahre dauerte die Arbeit. Am 19. April 1424 wurden die beiden Flügel in die Angeln gehoben, während Andreas Türe nach Norden hin an ihre heutige Stelle gebracht worden war. Ghibertis Ruhm verbreitete sich jetzt in ganz Italien, seine Tätigkeit ward von allen Seiten in Anspruch genommen, in Florenz aber faßte man den Entschluß, ihm auch die dritte Tür zu übertragen.
Er war an kein Vorbild mehr gebunden, die einzige Bedingung stand im Kontrakte, daß er, solange an der Tür gearbeitet würde, ohne Zustimmung der Zunft der Kaufleute keinen anderen Auftrag übernehmen dürfe; übrigens, was Zeit und Kosten anbeträfe, sei alles seinem Belieben anheimgestellt. Man erwarte jedoch von ihm, daß er, wie er mit der bereits vollendeten Tür alle anderen Meister besiegt habe, bei dieser neuen sich selbst übertreffen würde. Am 16. Juni 1452 ward auch dieses Werk, nun als Haupteingang, an Ort und Stelle geschafft. Am ersten hatte ihm noch sein Vater geholfen, diesmal konnte ihm sein Sohn Vittorio bei der Vergoldung zur Hand gehen, welche nachträglich vorgenommen wurde. Nicht lange danach starb Lorenzo Ghiberti; sein ganzes Leben, das er auf vierundsiebzig Jahre brachte, ist diesen beiden Hauptwerken geweiht gewesen.
Die zweite Tür übertrifft die erste in jeder Hinsicht. Wie ihm geboten war, folgte der Meister frei dem bildenden Genius. Seine Arbeit ist im höchsten Sinne geschmackvoll, das Erhabenste, was das künstlerische Handwerk zu leisten vermochte. Die Kompositionen der einzelnen Felder sind in einer Weise effektvoll zur Darstellung gebracht, die ohne eine so durchdringende Kenntnis und Ausbeutung aller der Vorteile, die das Material nur irgend gestattete, unmöglich gewesen wäre. Man könnte diese Tür eine kolossale Goldschmiedsarbeit nennen, man könnte aber auch sagen, die einzelnen Felder seien ins Relief übertragene Gemälde, wie sie nur der geschickteste Maler zu erfinden befähigt sei. Die Tür ist ein Werk für sich, das spätere Nachahmung niemals zu erreichen imstande war. Der die Fenster umschließende Rand, das eigentliche Gerippe der beiden Flügel, ist mit ungemeinem Reichtum an Figurenschmuck ausgestattet, mit liegenden und stehenden Statuetten, die beinahe frei gearbeitet und in Nischen postiert sind, mit vorspringenden Porträtköpfen und anderen Ornamenten, deren keines von geringerer Sorgfalt als das andere zeugt. Diese Tür ist die erste bedeutende Schöpfung florentinischer Kunst, deren Einfluß auf Michelangelo erkenntlich scheint. Die Erschaffung Adams an der Decke der Sixtinischen Kapelle, die Trunkenheit Noahs, die Tötung Goliaths ebendaselbst beruhen in ihren ersten Gedanken auf den kleinen Gestalten der Ghibertischen Kompositionen. Michelangelo übersetzte sie ins Riesenhafte. In einigen Figuren der Einfassung finden wir bereits Körperwendungen, die Michelangelo mit Vorliebe anwendet. So die gestreckte Lage, bei der sich die aufgerichtete Brust seitwärts auf den eingeknickten anliegenden Arm stützt, daß die Schulter ein wenig heraufgedrängt wird, eine Auffassung der menschlichen Gestalt, die bei Michelangelos Nachahmern zu einer beinahe stereotypen Erscheinung wird. Michelangelo sagte von diesen Türen, sie wären würdig, die Türen des Paradieses zu sein.
Was Ghiberti den Vortritt in einer neuen Richtung gegeben hat, war das Studium der Antike. Ein Gefühl für den Wert, welcher den Überresten der alten Kunst innewohnte, war nie ganz erloschen gewesen in Italien. Der Nation aber fehlte die Ehrfurcht und das Verständnis. Petrarca klagt, daß die aus der Art geschlagenen Römer mit den Trümmern ihrer alten Größe einen schmählichen, die Stadt beraubenden Handel trieben. Um das Jahr 1430 gab es in ganz Rom sechs antike Statuen, die genannt zu werden verdienten. Ghiberti hat Aufzeichnungen über die Kunst hinterlassen, er spricht von der Entdeckung antiker Marmorwerke wie von seltenen Ereignissen. Er beschreibt einen Hermaphrodit, den er 1440 in Rom sah, wo ihn ein Bildhauer, der das Grabmal eines Kardinals zu erarbeiten hatte und nach brauchbaren Marmorstücken suchte, acht Fuß unter der Erde auffand, eine liegende Figur, die mit der glatten Seite ihres Postaments über eine Kloake gestellt als Deckstein diente. In Padua sah er eine zweite Statue, die in Florenz entdeckt wurde, als man den Grund zu einem Hause ausgrub. Die dritte in Siena, von dieser aber habe er nur eine Zeichnung gesehen, die Ambrosio Lorenzetti (ein Schüler Giottos) von ihr angefertigt hätte und die ihm in Siena von ihrem Besitzer, einem alten Kartäuser Mönche, der ein Goldschmied war, gezeigt worden sei. Dieser habe ihm auch erzählt, wie beim Funde der Statue alle Gelehrten, Maler, Bildhauer und Goldschmiede der Stadt zusammengekommen wären, sie betrachtet und beratschlage hätten, wo sie aufzustellen sei. Dazu hätte man endlich den Marktbrunnen ausersehen. Die Statue sei ein wunderbar schönes Werk gewesen, mit einem Delphin an dem einen Beine, auf dem sie aufstand, an ihrem Fußgestell habe der Name Lysippos gestanden.
Kurze Zeit nach Aufstellung der Statue aber nimmt der Krieg, den Siena mit Florenz führte, eine böse Wendung. Es muß ums Jahr 1390 gewesen sein, wo Siena mit Visconti gegen die Florentiner verbündet war. Das Ratskollegium der Stadt überlegte hin und her, wodurch dies plötzliche Einbrechen des Unglücks verschuldet sein könnte, und gelangt zur Ansicht, durch Aufrichtung des Götzenbildes, das allem Christenglauben zuwider sei, habe man den Zorn des Himmels herabbeschworen. Das arme Werk des Lysippos wird heruntergestürzt und in tausend Trümmer zerschlagen, die man, um aus der bösen Sache sogar noch Vorteil zu ziehen, heimlicherweise auf florentinisches Gebiet schafft und da in die Erde gräbt. Hier haben wir das vielleicht letzte Opfer des erbitterten Kampfes, in welchem die Christen der römischen Kaiserzeit sich gegen die heidnischen Götterbilder gewandt hatten. Man sah sie als Wohnstätten der Dämonen selber an und befahl ihre Vernichtung als ein gottgefälliges Werk. Auch dann noch, als dieser erste Haß verschwunden war, weil längst keine Statuen mehr zu vernichten waren, wirkte der fest eingewurzelte Glaube fort. Die wenigen Bildwerke, welche an den römischen Säulen und Triumphbogen noch zutage standen, galten immer als Werke der Zauberei, und die an sie geknüpften Sagen lassen die Scheu erkennen, mit der das Volk sie betrachtete. Langsam trat hier ein Umschwung ein.
Ghiberti wußte die Vorzüge der antiken Arbeit wohl zu schätzen. Von einem in Florenz gefundenen Torso sagt er, er sei mit so großer Zartheit ausgeführt, daß man diese Feinheiten weder bei vollem noch bei gedämpftem Lichte mit dem Auge allein zu erkennen vermöge, man müsse sie mit den Fingerspitzen heraustasten, wenn man sie ganz und gar entdecken wolle.
Wenn er in dieser Richtung den alten Meistern ihre Geheimnisse ablernte und sie der Skulptur zu Nutzen anzuwenden bemüht war. so bestrebte sich Brunelleschi mit gleich glücklichem Erfolge, die Schönheit der antiken Architektur zu Ehren zu bringen. Als ihm, erzählt Vasari, in jener Konkurrenz der Preis nicht zuerkannt worden war, machte er sich mit Donatello, seinem jüngeren Freunde, nach Rom auf Auch dieser hatte als Goldschmied angefangen, sich aber bald dem Studium der Architektur ergeben. Indessen, so gut wie Ghiberti auch Architekt war, so gut war Brunelleschi Maler, Bildhauer und Erzarbeiter. Diese Studien bildeten ein Ganzes, das man Kunst nannte, wie alle geistige Arbeit nach jeder Richtung hin ein Ganzes bildete, das man Wissenschaft nannte. Diese Universalität finden wir schon bei Giotto, der zu dem Übrigen auch Gedichte zu machen verstand.
In Rom begannen die beiden Freunde die Überbleibsel der antiken Bauwerke auszumessen. Den Römern war diese Interesse an den Ruinen ihrer Stadt durchaus unverständlich, man glaubte von den jungen Florentinern, sie grüben nach Gold und Silber in dem Gemäuer der Tempel und Kaiserpaläste, und nannte sie die Schatzgräber. Damals stand noch manches, das heute in Trümmern liegt oder ganz und gar verschwunden ist. Erst lange nach jenen Zeiten, über fünfzig Jahre später, zerstörte der Kardinal von San Marco das Kolosseum, um aus den Werkstücken den venezianischen Palast zu bauen. Brunelleschi erwarb sich in Rom die Anschauungen, mit denen er später den gotischen Stil völlig besiegte. Seine Erkenntnis des antiken Kuppelbaues, die er sich durch die genaue Vermessung des Pantheons erwarb, setzte ihn in den Stand, die Kuppel des Domes in Florenz zu wölben, nach welcher dann endlich Michelangelo die von Sankt Peter auftürmte. So führen die Wege der florentinischen Kunst auf diesen einzigen Größten hin.
Nach Florenz zurückgekehrt, befand er sich zeitweise unter den Künstlern, deren Hilfe Ghiberti zu seinem großen Werke bedurfte. Auch Donatello arbeitete hier mit. Sie gingen zum zweiten Male nach Rom, wo erneute Studien des Altertums vorgenommen wurden; jetzt aber trat Brunelleschi zu Hause mit seinem Projekte für Santa Maria del Fiore auf. Ihm gegenüber stand wiederum Ghiberti, der den Ruhm auf seiner Seite hatte und gewohnt war, in Sachen der Kunst das große Wort zu führen.
Der Dom war längst fertig, nur seine Mitte stand frei und ohne Dach. Niemand wußte, wie die ungeheuere Öffnung zu schließen sei. Eine Konkurrenz ward ausgeschrieben. Die florentinischen Handlungshäuser in Deutschland, Burgund, Frankreich und England hatten die Weisung erhalten, den Abgang bedeutender Meister nach Florenz zu bewirken. 1420 wird die Versammlung eröffnet. Allerlei Meinungen kommen zutage. Der eine schlägt vor, freie Pfeiler aufzuführen, welche das Kuppelgewölbe tragen sollten. Ein anderer will die Wölbung aus Bimsstein aufmauern, der Leichtigkeit wegen. Ein einziger mächtiger Tragpfeiler in der Mitte des Gewölbes wird proponiert. Der tollste Vorschlag ging dahin, die ganze Kirche mit Erde zu füllen, um eine einstweilige feste Stütze für das Gewölbe zu gewinnen. Damit diese Erde nach Vollendung des Baues dann um so schneller wieder fortgeschafft würde, sollten kleine Silberstücke hineingemischt werden: was Hände hätte, würde dann auf das eifrigste davon fortschleppen.
Brunelleschis Projekt war ein freies Gewölbe. Er wolle es aufführen, ohne nur ein Gerüst zu brauchen. Die enormen Kosten der anderen reduzierte er auf eine geringe Summe. Doch je mehr er versprach, um so unglaublicher schienen seine Worte. Niemand hörte ihn, und schon war er auf dem Sprunge wieder nach Rom, hinweg aus seiner undankbaren Vaterstadt, als den Leuten zuletzt das Verständnis kam, es könne doch etwas hinter dem Manne stecken. Er hatte sein Modell den vereinigten Architekten nicht vorzeigen wollen, in der Stille ließ er es nun diejenigen sehen, von deren Stimme der Zuschlag abhing. Eine neue Versammlung wird berufen; abermaliger Streit, abermalige Weigerung, das Modell zu zeigen. endlicher Sieg Brunelleschis dennoch, der durch ein Gleichnis seinen überragenden Verstand dartut. Er verlangt von den Herren, sie sollten ein Ei auf die Spitze stellen, und es folgt die Geschichte vom Ei des Kolumbus, das alle vereinten Baumeister nicht aufzustellen vermögen und das Brunelleschi, lange Jahre ehe eine Seele an Kolumbus dachte, nach seiner Methode zum Stehen bringt.
Jetzt, nachdem er den Bau erhalten hat, erwacht die Eifersucht Ghibertis. Vasaris Erzählung wird bei dieser Gelegenheit offenbar mythisch. Es gab zwei Parteien in Florenz, deren jede im Interesse des einen oder anderen der beiden großen Architekten die Tatsachen entstellte, und Vasari folgte den Anhängern Brunelleschis. Indessen, wie dem nun sei, was er vorbringt, gewährt Einblick in das Leben und Treiben der florentinischen Künstlerschaft und zeigt, wie da nicht nur Kunst gegen Kunst, sondern auch List gegen List auftrat. Berichten wir also in Vasaris Sinne weiter. Ghiberti stand in der Blüte seines Ruhmes. Er bringt es dahin, daß ihm und Brunelleschi zusammen der Bau der Kuppel übertragen wird. Brunelleschi, wütend und außer sich über den Streich, will wiederum alles im Stich lassen. Donatello aber und Luca della Robbia, letzterer ebenfalls ein vortrefflicher Bildhauer, bewegen ihn, statt seine Zeichnungen zu zerreißen und ins Feuer zu werfen, wie er tun wollte, lieber mit den Vorstehern des Baues sich zu verständigen, kurz, er läßt sich zureden, und die Arbeiten nehmen ihren Anfang. Sein Modell jedoch, das er größer in Holz ausführen läßt, hält er vor Ghiberti sorgfältig verschlossen, der seinesteils nicht minder ein Modell anfertigt, für welches er dreihundert Lire in Anschlag bringt, während Brunelleschi nur fünfzig beansprucht. Sieben Jahre wird so in Gemeinsamkeit fortgebaut, bis man an den bedenklichen Punkt kommt, wo Ghibertis Weisheit zu Ende war. Die eigentliche Wölbung begann. Es kam darauf an, das richtige Prinzip zur Anwendung zu bringen, nach welchem die Steine ineinandergefügt wurden. Nun stellt sich Brunelleschi krank. Ghiberti, erst verlegen, dann ratlos. kann allein nicht weiter und muß zurücktreten. Anfänglich behält er seine drei Goldgulden monatlich, die er wie Brunelleschi bezog, dann wird diesem der Gehalt auf acht erhöht, während Ghibertis Anteil ganz fortfällt. Ebenso klug weiß Brunelleschi die Arbeiter zu behandeln, die ihm nicht immer zu Willen sind. Seine Stellung in der Stadt war eine bedeutende. Schon 1423 trat er in die Signorie ein. Neben dem großen Bau der Kuppel beschäftigten ihn zahlreiche andere Aufträge. Nicht minder jedoch Ghiberti und um sie her andere Meister, deren Werke und Namen aber nur für diejenigen Bedeutung haben, die ihnen an Ort und Stelle nachzugehen imstande sind.
Brunelleschi starb 1446; als Architekt nicht gerade Urheber der neuen Richtung, die das Gotische verdrängte, wohl aber der Meister, der mit den größten Mitteln ihre Übermacht zu einer Tatsache stempelte. Dennoch war auch er, wie Ghiberti, mehr Handwerker im großen Stile, wie denn überhaupt die Tage noch in der Zukunft lagen, in denen die Männer auftraten, deren eigenstes Wesen den erkennbaren Mittelpunkt ihrer Kunst bildet. Besonders für die Maler gilt diese Bemerkung, denen doch eine solche Freiheit am ehesten erreichbar ist.
Die Arbeiten der einzelnen Meister sind mehrenteils in Fülle vorhanden, wir vermögen deren Eigentümlichkeit, vielleicht sogar ihre Neigungen zu unterscheiden. Der eine ahmt hier, der andere dort nach, der ist um eine Spur zarter, der andere derber; es ist ein Genuß, die Reihen der Sammlungen und die Gemälde der Kirchen, Paläste und öffentlichen Gebäude mit geübterem Blicke anzusehen und die Meister fest zu erkennen oder annähernd zu bestimmen. Eine große Anzahl geschichtlicher Zeugnisse, an deren Vervollständigung noch unablässig gesammelt wird, Korrespondenzen, Kontrakte, Testamente bestätigen oder korrigieren das ästhetische Urteil und verleihen den Kunstwerken höheren Wert, die alle dadurch auch in historischer Weise nochmals in Zusammenhang geraten; trotzdem aber wäre im höchsten Sinne die florentinische Kunst bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts der Betrachtung weniger wert, wenn nicht später die Erscheinungen einträten, die als ihre endliche Blüte sich entfalteten. Selbst Masaccios Arbeiten, der zu Ghiberti und Brunelleschi als der dritte große Wiedererwecker der Kunst gerechnet wird, berühren die höhere Kunst kaum, halten sie immer noch innerhalb der Grenzen des edelsten Handwerks. Diese Männer wirken für bestimmte Zwecke in ausgezeichneter Weise, aber dem so Entstandenen fehlt das, was einem Kunstwerke eigen sein muß, um seinen Meister ein Genie und seine Art zu arbeiten Stil nennen zu dürfen. Jedes Werk eines großen Künstlers muß bei aller Vollendung des Geleisteten geistig gleichsam die Aussicht auf ein noch größeres Werk eröffnen, das unsichtbar darüber schwebt und uns, ohne daß wir wissen, woher sie stamme, mit jener ewig unbefriedigten Neugier erfüllt, die, nachdem sie alles erschöpft zu haben glaubt, dennoch im Momente, wo sie sich abwendet, fühlt, sie habe erst das wenigste gesehen.
Als ein Mann, der es versucht, solche Werke hinzustellen, erscheint Donatello. Er lebt nicht mit sich im Frieden. Er will mit seinen Arbeiten nicht das bewirken, daß kein anderer ihn übertreffe, sondern er strebt danach, eine Idee auszudrücken, die zu verfolgen ihm mehr dünkt, als technische Vollkommenheit zu zeigen. Das heitere Genügen in der Ausübung hoher Geschicklichkeit, das aus Ghibertis Arbeiten herausblickt, geht den seinigen ab. Sie haben meist etwas Unfertiges, Rauhes, aber sie sind lebendig, und es ist der Geist ihres Meisters, der ihnen dies Leben eingehaucht hat.
Auch für Donatello war Ghiberti ein mächtiger Nebenbuhler, doch schlugen sie beide verschiedene Wege ein. Während Ghiberti seinen Figuren eine gewisse allgemeine Grazie, seinen Ornamenten gefällige Zierlichkeit zu geben weiß und ein Ineinandergreifen aller Teile zum günstigsten Totaleffekt durch gleichmäßige Vollendung der Einzelheiten erzielt, wirft sich Donatello kräftig auf die rücksichtslose Nachahmung der Natur, wie sie ihm vor die Augen trat.
Über dies Bestreben bringt Vasari wieder eine jener kleinen Geschichten vor, deren Glaubwürdigkeit auf schwachen Füßen steht, die aber wahrhaft in sich und wichtig erscheint, weil sie die Natur des Künstlers kennzeichnet. Noch in den Anfängen begriffen, soll er seinen Freund Brunelleschi einmal um ein offenes Urteil über ein von ihm gearbeitetes Kruzifix gebeten haben. »Was du da gemacht hast«, sagte dieser, »ist kein Christus, sondern ein ans Kreuz genagelter Bauer.« »Tadeln ist leichter als besser machen«, antwortete Donatello. Brunelleschi steckt das ruhig ein und arbeitet für sich in der Stille ein Kruzifix, das er eines Morgens in die Werkstätte mitnimmt. Donatello kommt gerade vom Markte und hat ihr beiderseitiges Frühstück, Früchte, Käse, Eier usw. in der Schürze. Brunelleschi hält ihm das Kruzifix hin, und Donatello ist so verblüfft bei diesem Anblick, daß er staunend die Hände erhebt und alles, was in der Schürze war, auf die Erde fallen läßt. »Wie sollen wir nun frühstücken?« ruft Brunelleschi. »Hebe du dir vom Boden auf, was du Lust hast«, antwortete Donatello, »ich für mein Teil habe heute mein Frühstück vorweg; ich sehe wohl, daß du für Christusse gemacht bist, und meine Kunst für nichts weiter, als Bauern taugt.« Vasari erzählt die Anekdote zweimal an verschiedenen Stellen und nicht ganz übereinstimmend.
Brunelleschi hatte nicht unrecht. Ein Zug derber Wirklichkeit geht durch die Gestalten seines Freundes, auch die zartesten nicht ausgenommen. Was für ein Mann ist der heilige Georg in der Nische der Kirche Or San Michele! In voller Rüstung steht er da, strack auf beiden Beinen, die etwas gespreizt sind, mit gleichmäßiger Wucht auf beiden ruhend, als wolle er so ausharren, und keine Gewalt sollte ihn von seinem Posten bringen; den hohen Schild hat er gerade vor sich hingestellt, beide Hände rühren seinen Rand an, halb um ihn zu halten, halb um daran zu ruhen; Stirn und Augen voll erwartender Kühnheit. Auch Ghiberti hat in die Nischen der äußeren Wände von Or San Michele Statuen geliefert, deren Vortrefflichkeit erfreut; kommt man aber an diesen Georg heran, so verwandelt sich das bloß ästhetische Interesse plötzlich in lebendigeren Anteil an der Person des Meisters. Die Technik wird Nebensache. Wer ist das gewesen, fragt man, der einen solchen Kerl so schlagfertig dahingestellt hat?
Ghiberti und Brunelleschi standen zu den Medici in engen Beziehungen. Donatello, scheint es, in höherem Maße als beide; er war der erste große Künstler, dessen Schicksal auf dem der Familie beruhte. Sie verehrten ihm ein kleines Landgut und verwandelten, als ihm dessen Bewirtschaftung zu viel Mühe machte, das Geschenk in eine jährliche Rente. Cosmo dei Medici empfahl ihn sterbend seinem Sohne Piero, der sich liebevoll seiner annahm und ihn in San Lorenzo ehrenvoll begraben ließ.
Donatello war ein einfacher Mann von wenig Bedürfnissen. Einen von Cosmo geschenkten Mantel wollte er nicht tragen, weil er zu prachtvoll sei. Sein Geld soll immer offen dagelegen haben in einem Korbe, der von der Decke herabhing. Seine Freunde durften jederzeit hineingreifen, wenn sie es brauchten. Uralt und gelähmt lag er die letzte Zeit seines Lebens in einem kleinen Häuschen, dessen Lage Vasari noch genau angibt, von dem aber heute keine Spur mehr vorhanden ist. Die ganze Stadt folgte der Leiche, als er begraben wurde.
Zehn Jahre nach Donatellos Tod erst wurde Michelangelo geboren. Zwischen beiden fand eine auffallende geistige Verwandtschaft statt. Äußerlichen Zusammenhanges eines früheren Meisters zu Michelangelo wurde bereits gedacht, hier aber war die Ähnlichkeit der Natur so stark, daß einer von den geistreichen Florentinern jener Zeit die Bemerkung machte: entweder buonarrotisiere Donatello oder es donatellisiere Buonarroti. Auch meißelte Donatello den Marmor kühn und mit Leichtigkeit wie Michelangelo, lieferte dabei aber, wie dieser gleichfalls, wenn es darauf ankam, die zarteste, glatteste Arbeit. Sein heiliger Georg ist kühn modelliert und auf kräftige Gesamtwirkung angelegt, dagegen befindet sich in der Kartause bei Florenz das Grabdenkmal eines Bischofs, das unübertrefflich fein vollendet ist. Mitten in einem Gemache liegt die auf dem Rücken ruhende, lang ausgestreckte Gestalt auf dem Steinboden, ohne andere Unterlage als nur ein Kissen unter dem Haupte. Geschützt durch die heilige Stille und Abgeschiedenheit des Klosters, unangetastet von Zerstörung, kaum vom Staube angeflogen, hat das Marmorbild Jahrhunderte lang seine erste Frische bewahrt.
Hier gewinnt man die Überzeugung, daß, wenn der Meister an anderen Stellen in größeren Zügen arbeitete, es sein Wille war und nicht weil die Hand ihm die feinere Arbeit versagte. Ebensogroß als seine Kunst beim Marmor war die Geschicklichkeit beim Erzguß. Die Kirche von San Lorenzo, die Brunelleschi für die Medici neu erbaute, ist in ihrer inneren Ausschmückung das Werk Donatellos und seiner Schüler. Michelangelo vollendete zuletzt, was noch fehlte. Und doch ist diese Kirche, angefüllt von einer Reihe von Werken beider Künstler, deren jedes einzelne seinem Urheber einen Namen gemacht hätte, nur ein Ort unter den vielen, die durch den Reichtum ihrer Phantasie verherrlicht wurden.
Florenz ist voll von Donatellos Werken, das übrige Toskana und Italien besitzen daneben ihren guten Anteil. Betrachtet man die Arbeiten hier und da vereinzelt, so erblickt man nur die Kunst eines einsamen Mannes; überschlägt man aber die gesamte Summe, die Mühe, den Umfang, die Kostbarkeit, so sieht man im Geiste den Meister inmitten einer großen Werkstatt und von ausgezeichneten, zahlreichen Schülern umgeben, die alle unter seinem Namen tätig sind. Man bringt nun die vortrefflichsten Werke allein auf Donatellos eigene Rechnung, während man das Gleichgültigere nur seiner Werkstatt zuerteilt. Eine solche Tätigkeit aber ist nicht zu denken ohne ein Volk, das nicht müde wird, seine Künstler zu erneuten Anstrengungen anzuspornen.
VII
Donatello lebte schon in Zeiten hinein, wo größerer Reichtum an Werken der alten Kunst sich eingefunden hatte. Er brachte Cosimo auf den Gedanken, antike Statuen zu sammeln und öffentlich aufzustellen. Zerbrochene oder verstümmelte ergänzte er ihm. Dies waren die Anfänge des mit so viel Schätzen ausgestatteten Gartens von San Marco, in dem Michelangelo als Kind seine Studien machte. Was in Donatellos Jugend mehr eine unverstandene Liebhaberei einzelner gewesen war, hatte sich allmählich zum Geschmack des großen Publikums erhoben, und die Vorteile, welche er, und die anderen mit ihm, sich in der Jugend, ihrem Instinkt nachgehend, mühsam zusammenerwarben, wurden von nun an den folgenden Künstlern als eine unumgängliche aber bequem zu erreichende Übung überliefert.
Der Umschwung, der sich in Italien während des Lebens und Wirkens der vier Künstler vollbrachte, war ein alles durchdringender. Das Altertum brach in frischen Quellen aus der Erde und befruchtete die Welt. Die Päpste widersetzten sich dem nicht, sie und der weltliche und der geistliche Adel Italiens strebten um die Wette danach, das Wiederaufleben der antiken Kultur sich selbst zum geistigen Genusse auszubeuten. Die Buchdruckerkunst erweiterte die Wirkung der römischen und griechischen Autoren ins Unendliche. In Florenz fällt der Einbruch dieser Zeiten und die vollendete Herrschaft der Medici mit der Ausdehnung des Territoriums und bedeutender Erweiterung der Handelsbeziehungen zusammen. Aus allen Enden der Welt strömt Reichtum in die Stadt. Die Familien der großen Bürger haben fürstliche Mittel in Händen. Eine neue Generation wächst auf, aber es zeigen sich nun auch die ersten Spuren jener Weltanschauung, für welche der schöne Genuß des Lebens höher stand als die rasende Vaterlandsliebe und die Befriedigung des Triebes, sich frei zu fühlen, welche bis dahin die Geschicke der Stadt geleitet hatten.
Diese Zeiten aber sind uns bekannter und verständlicher. Sie haben nichts Mythisches mehr an sich wie die vorhergehenden, sie sind erfüllt von Charakteren, deren Handlungsweise wir verfolgen und begreifen, und die drei großen Künstler, welche in ihnen aufstehen und durch ihre Arbeiten sie verherrlichen, stehen als lebendige Menschen vor uns. Cimabue, Giotto und sogar Dante sind kaum mehr als große schwankende Schatten von Männern, deren gesamte Tätigkeit wir mit ihren Namen belegen; Ghiberti, Brunelleschi und Donatello erscheinen bereits voller und lebendiger, Donatello beinahe als erkennbarer Charakter, Leonardo da Vinci aber, der älteste der drei, von denen nun die Rede sein wird, streift alles Nebelhafte von sich, und obgleich wir, verglichen mit den beiden anderen, am wenigsten von seinen Schicksalen wissen und seine Wege oft versteckt und dunkel sind, empfinden wir doch in seinen Werken sein ganzes Herz und stehen ihm nah, als wären wir ihm begegnet.
Leonardo ist kein Mann, an dem man nach Belieben vorübergehen könnte, sondern eine Gewalt, deren Fesseln wir tragen und deren Zauber sich niemand wieder entzieht, der einmal von ihm berührt worden ist. Wer die Mona Lisa lächeln sah, den begleitet dieses Lächeln für immer, wie Lears Wut, Macbeths Ehrgeiz, Hamlets Trübsinn und Iphigeniens rührende Reinheit ihn begleiten.
Sind Künstler einmal so groß wie er, dann werden ihre Werke zu persönlichen Taten, und was irgendwie mit deren Entstehung auch im entferntesten in Zusammenhang steht, gewinnt höhere Bedeutung. Ihre Reisen sind keine bloßen Geschäftsreisen mehr, ihre Feindschaften oder Verbindungen keine äußerlichen Verhältnisse, keine ihrer Erfahrungen scheint ohne Einfluß auf ihr Schaffen geblieben zu sein. Mag Donatello in Venedig, Padua oder Neapel, in Kriegs- oder Friedenszeiten arbeiten, er ist überall derselbe. Ob Ghiberti, während er an seinen Türen modellierte, goß und vergoldete, glücklich oder unglücklich geliebt habe, ist eine Frage, deren genaueste Beantwortung uns wenig berühren würde. Selbst bei den lieblichen Frauenprofilen des Filippo Lippi steigt derartige Neugier nicht auf. Wir betrachten mit Rührung das Bildnis der schönen Simoneta, des jugendlich ermordeten Giuliano dei Medici junggestorbene Geliebte, aber wir denken nicht daran, mit welchen Augen Botticelli selbst sie angeblickt, als er diese zarten Linien zog. Dagegen die Frauen Leonardos – welch eine Luft umweht diese Gestalten, welch eine Begier erwacht, zu wissen, wieviel nur die bewußte Kunst hier getan, wieviel das eigene Herz des Malers an dem Reize des Bildnisses schuldig sei. Jene grübelnde Neugier wird tätig in unserem Geiste, die alsbald zu fragen und Vermutungen zu schmieden beginnt. So war uns gerade zumute bei Goethes Gedichten. So scheint unmöglich, daß sie nicht ganz und gar als Teile seines gelebten Lebens entstanden seien. Dieses rätselhafte Wesen, dies aller Erklärung spottende, unseren Scharfsinn dennoch stets wieder aufreizende Geheimnis ist der ausschließliche Besitz der Werke, die von großen Künstlern geschaffen worden sind. Das zieht uns mächtig an, und was bei geringeren Künstlern als eine so große Hauptsache gilt: ihre Technik, ihr Lernen, ihre Fortschritte in Auffassung und Behandlung, wird zu Nebensachen, die geringerer Betrachtung würdig scheinen.
Leonardo ist 1452 geboren, als der natürliche Sohn eines reichen Adeligen. Liest man Vasaris Nachrichten über sein Leben, so wird man versucht, sie für eine Reihe liebenswürdiger Geschichten zu halten, die sich auf Rechnung eines großen, aber ziemlich unbekannten Mannes in Florenz gebildet hatten. Denn Leonardo war die meiste Zeit seines Lebens weit abwesend von seiner Vaterstadt. Aber seine Werke stimmen mit den Seltsamkeiten überein, die Vasari mitteilt. In London, Florenz und an anderen Orten werden eine Fülle von seinen Zeichnungen aufbewahrt; es ist kaum zu beschreiben, welche Höllenfratzen hier auf das sauberste und in sorgfältiger Durchführung von Leonardos Hand gezeichnet zu sehen sind. Karikaturen mit wissenschaftlicher Genauigkeit erfunden. Eine nach der anderen, die folgende immer ungeheuerlicher als die vorhergehende. Einen Zweck, wie etwa die verzerrten Gesichter, welche Michelangelo in Zieraten anbrachte nach Art der Grotesken, können diese Bildungen nicht gehabt haben. Es sind bloße Versuche, das Häßliche so weit zu treiben als möglich wäre, fixierte Träume gleichsam einer auf Auswüchse menschlicher Formen gerichteten Phantasie. Da glaubt man Vasari gern, wenn er erzählt, Leonardo habe Tage lang einem auffallenden Menschengesichte nachlaufen können, nur um es von Grund auf aufzufassen und zu Papiere zu bringen. Oder er lädt eine Schar Bauern zum Essen ein, macht ihnen Mut, sich recht behaglich zu fühlen, reizt sie zum Lachen und weiß sie mit Hilfe guter Freunde so lange darin zu erhalten, bis sich die grinsenden Gesichter aufs festeste in sein Gedächtnis eingegraben haben. Nun stürzt er fort und beginnt zu zeichnen, worauf dann ein Bild fertig wird, das kein Mensch, ohne selber zu lachen, ansehen kann. Es ist, als hätte Leonardo das Bedürfnis eines schreienden Gegensatzes in sich empfunden gegen jene wahrhaft himmlischen Gestalten, die er zu schaffen fähig war. Er selber, schön von Antlitz, stark wie ein Titan, freigebig, mit zahlreichen Dienern und Pferden und phantastischem Hausrat umgeben, ein perfekter Musiker, bezaubernd liebenswürdig gegen Hoch und Niedrig, Dichter, Bildhauer, Anatom, Architekt, Ingenieur, Mechaniker, ein Freund von Fürsten und Königen, – dennoch als Bürger seines Vaterlandes eine dunkle Existenz, die, aus ihrem Dämmerlichte selten heraustretend, keine Gelegenheit findet, einfach und frei ihre Kräfte für eine große Sache einzusetzen.
Solche Naturen, die bei eminenten Anlagen dennoch nur zum Abenteuerlichen geschaffen scheinen, die mit den ernstesten, tiefsten Arbeiten des Geistes den Trieb zu einer Art kindlichen Spielerei bewahren, sind seltene, aber mögliche Erscheinungen. Solche Männer werden an hoher Stelle geboren; genial, schön, unabhängig und von unbestimmtem Tatendrange, glühend, treten sie in die Welt. Alles steht ihnen offen, unter keiner Gestalt naht wirkliche, drückende Sorge, sie richten sich ein Leben ein, das niemand außer ihnen selbst versteht, weil niemand gleich ihnen unter den Bedingungen geboren wurde, die auf diese Sonderbarkeiten fast wie ein notwendiges Schicksal hinleiten, dem nicht zu entrinnen ist.
Alfieri war ein solcher Geist, mit ungemeiner, aber völlig unbedingter Energie sich selbst überlassen, unfähig einen anderen Weg zu gehen als den, welchen seine Natur blindlings auffand, Lord Byron ähnlich organisiert, durch den Willen einer dämonischen Unruhe hierhin und dorthin gestoßen. Wie kam ein Mann von Leonardos Genie, der eine große, mächtige Partei für sich hatte, zu dem Entschlusse, sein geliebtes Florenz auf so lange Jahre aufzugeben und endlich wie ins Exil nach Frankreich zu gehen? Allen anderen überlegen, verzichtet er darauf, seine Stellung geltend zu machen. Mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit in Kontakt, steht er doch zu keinem in natürlichen, offenbaren Verhältnissen. Leider ist Vasaris Beschreibung, in der ganze Epochen übergangen und die Dinge in Verwirrung gebracht sind, fast die einzige Quelle für die äußeren Schicksale Leonardos. Denn obgleich er selbst ganze Bände schriftlicher Arbeiten hinterlassen hat, empfangen wir daraus wenig Wissenswürdiges über die Wege, die er gegangen ist. –
Die gewöhnliche Laufbahn der florentinischen Künstler pflegte die zu sein, daß sie als Goldschmiedslehrlinge anfingen. Sie gewannen so die solideste Grundlage. Den Unterschied zwischen Kunst und Handwerk kannte man wohl, aber er bezog sich auf die Leistungen selbst, nicht auf die, welche die Werke hervorbrachten. In Frankreich unterschied man im vierzehnten Jahrhundert so: was für die Kirche und den König gearbeitet wird, ist ein Kunstwerk, das übrige Handwerkerarbeit. Die Absicht war in allen Fällen die, Geld zu verdienen.
Leonardo kam anders zur Kunst. Zeichnen und Modellieren machten ihm Vergnügen. Sein Vater, von dem er wie seine übrigen ehelichen Geschwister gehalten wurde, gab einige von seinen Zeichnungen dem Andrea Verrocchio, der Donatellos Schüler und nach dessen Tode der erste Künstler in Florenz war. Dieser drang in Messer Piero da Vinci, er müsse seinen Sohn Maler werden lassen, und nahm Leonardo in seine Werkstätte auf. Hier wurde gemalt, in Marmor gearbeitet, in Erz gegossen. Aus diesen ersten Zeiten will Vasari einige in Ton modellierte Frauenköpfe gesehen haben, deren Ausdruck ein lächelnder gewesen sei. Also gleich im Beginn dies Lächeln bei Leonardos Frauenantlitzen, das in so viel späteren Bildern wiederkehrt und endlich durch seine Schüler, Luini voran, zu einer stetigen Auffassung wurde, aus der sich gar kein Ausweg fand.
Neben den bildenden Künsten betrieb er mechanische und architektonische Studien. Sein Sinn war auf außerordentliche Dinge gerichtet, auf das Schwierige, auf Erfindung von künstlichen Mühlenwerken, Apparaten, um zu fliegen, Maschinen, um Tunnel durch Berge zu bohren oder ungeheure Lasten fortzuschaffen, Anstalten, um Sümpfe zu entwässern. Das großartigste von seinen Projekten war das, die Kirche von San Giovanni, welche durch die allmähliche Erhöhung des Pflasters ringsumher zu tief in den Boden hineingeraten war, emporzuheben, wie sie dastand, und einen Unterbau mit Stufen darunter zu setzen. Jeder wußte, daß dies unmöglich sei, bemerkt Vasari (der doch in solchen Dingen gern selber das Unmögliche geleistet hätte), allein wenn Leonardo vordemonstrierte, wie er zu Werke zu gehen gedächte, mußte man ihm Glauben schenken. Heute würde es sich bei dieser Sache vielleicht nur um die Kosten handeln.
Neben solchen Bestrebungen genoß Leonardo das Leben und seine Jugend. Besonders war er auf schöne Pferde und andere Tiere aus, an denen er seine Freude hatte. Diese Neigung für allerlei Getier finden wir wiederum bei Alfieri und Byron. Ich möchte sie einer ganzen Menschenklasse zuschreiben, mögen es nun geniale Geister oder unproduktive Ingenia gewesen sein. Es liegt ihr eine Art von Herrschbegierde zugrunde. Aus innerer Unruhe wissen sie geistige dauernde Gewalt über ihresgleichen nicht geltend zu machen, und weil sie weder Sklaven halten können noch als Fürsten geboren sind, so beschränken sie sich auf die unantastbare Herrschaft über ein Volk von Tieren, die in ihrer Fähigkeit, Treue zu bezeigen, ein Surrogat für die Menschen bilden, und weil sie niemals böse Behandlung nachtragen oder sonstwie ihre Persönlichkeit geltend machen, eine vorzüglichere Gesellschaft scheinen, mit der wohl auszukommen ist. Bei Vasari begegnen wir noch einigen Künstlern von geringerer Bedeutung, darunter Schülern Leonardos, die ähnliche Neigungen kultivierten.
Mit solchen Liebhabereien gingen Botanik, Anatomie, Astronomie und Astrologie Hand in Hand. Durch letztere besonders soll Leonardo sich dermaßen ketzerische Ansichten gebildet haben, daß ihn jedermann eher für einen Heiden als für einen Christen ansah. Doch findet sich diese Bemerkung nur in der ersten Ausgabe von Vasaris Werken. In der zweiten ließ er sie fort und tat, wie seine heutigen verdienstvollen Florentiner Herausgeber bemerken, wohl daran, da gewiß nur ein Mißverständnis an einer solchen Behauptung schuld gewesen sein könne. Unbefangen betrachtet, erscheint Leonardos Ketzerei im Einklang mit dem Charakter des Mannes und den Anschauungen seiner Zeit. Die klassischen Studien herrschten; als Sittenregel eine Auffassung der Dinge, die sich gegen Gut und Böse, Glauben und Unglauben im christlichen Sinne gleichgültig verhielt. Ihr huldigten der Adel und die höhere Geistlichkeit. Die Akademie von Florenz, dieser griechisch gebildete Hofstaat der Medici, erhob die platonische Philosophie zur zweiten Staatsreligion. Die, welche eine andere Richtung strenge bewahrten, standen als ein kleines Häuflein einsam mitten im Gewühl, und die Zeiten, wo dieser Zustand von Grund aus mit einer Tünche von anderen Gesinnungen überdeckt werden sollte, liegen weit hinter Leonardos Todesjahr. Wohl aber sind es die Jahre, in denen Vasari sein Buch verfertigte.
Bald übertraf Leonardo Verrocchio, seinen Meister. Auf einem Bilde, welches dieser für die Mönche von Vallombrosa malte und das die Taufe des Johannes vorstellte, stach ein Engel von der Hand Leonardos durch seine Schönheit dermaßen hervor, daß Verrocchio von der Zeit an das Malen ganz aufgegeben haben soll. Doch werden ähnliche Wendungen zu oft von Vasari erzählt, als daß man sie für buchstäbliche Wahrheit zu nehmen hätte. Die nächste Arbeit war die Zeichnung zu einem Teppich vor eine Tür zu hängen, der in Flandern für den König von Portugal gewebt werden sollte. Zu bemerken hierfür ist, daß die Verbindung zwischen Florenz, Lissabon und den nördlichen niederländischen Häfen längst eine gewöhnliche war; überall gab es florentinische Häuser. Auf diesem Teppich hatte Leonardo den Sündenfall dargestellt. Die Landschaft mit den Pflanzen und Tieren sowie der Baum mit dem Geäst und Blättern waren so fein und vollkommen ausgeführt, daß die Geduld des Künstlers ebenso bewunderungswürdig wie seine Kunst erschien. Zu Vasaris Zeiten war dieser Karton noch in Florenz vorhanden.
Man muß, wenn Sorgfalt und Ausführlichkeit in der Behandlung des Details hier besonders lobend hervorgehoben werden, die Arbeitender florentinischen Meister jener Zeit überhaupt vor Augen haben, bei denen miniaturartige Sauberkeit gewöhnlich ist. Leonardo leistete darin aber das höchste. Daher erscheint der Vorwurf, er sei mit seinen Bildern nie fertig geworden, er habe so viel angefangen und unvollendet stehen lassen, sehr natürlich. Die Sorgfalt, mit der er seine Farben und Öle bereitete, war eine außerordentliche.
Die Entstehung des furchtbaren Medusenhauptes, das ebenfalls eine seiner frühesten Arbeiten war, erzählt Vasari sehr anschaulich. Leonardo sammelt alles nur aufzutreibende giftige Krötengezücht, hält es in seinem Hause, reizt es zur Wut und beobachtet es, bis sich seine Phantasie für diese Malerei vollgesogen hat. Vollendet bringt er das Gemälde in ein verdüstertes Zimmer, schneidet ein Loch in den Fensterladen, so daß das rundeindringende Licht gerade den Kopf der Meduse trifft und mit leuchtender Helligkeit ausstrahlt. Damit werden dann die auf geheimnisvolle Weise hereingeführten Neugierigen in Schrecken versetzt. Sodann malt er für einen seiner Freunde den Gott Neptun. Auf diesem Bilde vereinte sich die Natürlichkeit der stürzenden Wellen, die Seltsamkeit der sie durchpeitschenden Seeungetüme und die prachtvolle Schönheit der Göttergestalt zu einem überraschenden Anblicke. Die Vorliebe für das Phantastische aber lag nicht sowohl im Charakter des Künstlers selbst, als sie überhaupt den Anschauungen der damaligen Welt eigen war, und manche Werke von Leonardos früheren Genossen entsprechen im Geiste den seinigen, wie sie von Vasari beschrieben werden, denn erhalten sind sie heute nicht mehr. Noch in seinen spätesten Bildern aber blieb er dieser märchenhaften Stimmung getreu, die aus ihnen herausredet wie aus den Versen Byrons, an den ich nicht denken kann, ohne daß mir Leonardo in den Sinn käme. So stark war das Launenhaft-Träumerische seiner Natur, daß er seinen Schülern ernsthaft rät, die feuchten Flecke alten Gemäuers, Asche und anderes zufälliges Naturgerümpel genau anzusehen: dabei stiegen die schönsten Gedanken für Gemälde auf. Und so groß war seine Kraft, die verborgene Tiefe eines Menschen zu erkennen und darzustellen, daß er mehr darin geleistet als irgendein anderer. Man muß den Frauenkopf des Augsburger Museums gesehen haben, um das zu ermessen, wo die Leidenschaft mit einer Wahrheit ausgedrückt ist, daß man die Schicksale zu kennen glaubt, die diese Züge gestalteten, und sich wie von einem furchtbar schönen Geheimnisse von dem Anblicke nicht losreißen kann.
Die Blüte seines Talentes entwickelte sich nicht in seinem Vaterlande. Er mochte etwas mehr als dreißig Jahre zählen, als er nach Mailand ging, wo Ludovico Sforza die Herrschaft inne hatte. Es wäre natürlich gewesen, daß man Leonardo einer bedeutenden künstlerischen Unternehmung wegen dahin gezogen hätte, doch davon wird nichts erzählt. Sforza liebte das Saitenspiel, er hatte gehört, welch ein Meister darin Leonardo sei, und ersucht ihn um seine Gegenwart. Dieser folgt dem Rufe. Er verfertigt sich eine silberne Leier, der er die Form eines Pferdeschädels gibt und zu deren Klange er im Gesang die Verse erfand, durch die er den Herzog und dessen prachtvollen Hof in Entzücken setzt. Dies war das erste Auftreten des schönen Florentiners in Mailand. Bald aber eröffnet sich ihm eine Tätigkeit, die ihn ebensosehr fesselt als die Zuneigung Sforzas. Er findet reichen Spielraum für seine Talente und nimmt als Künstler die erste Stelle ein. Wir verlassen ihn hier. Diese Jahre sind es, in die Michelangelos erste Entwicklung fällt.
Zweites Kapitel
I
Nach denselben Gesetzen, nach denen in unserem Gedächtnisse das, was wir erlebten, feste Formen annimmt, bildet sich im Bewußtsein der Völker die eigene Geschichte und in dem der ganzen Menschheit das Gefühl vom Inhalte ihrer Vergangenheit. Es wäre als Resultat der vergleichenden Wissenschaft vielleicht natürlich, die Schöpfungsfrage ganz beiseite zu lassen und ein in unabsehbare Jahre rückwärts sich verlierendes Menschengewimmel anzunehmen, dessen Entstehung einstweilen nichts aufklärt. Das aber widerspricht noch dem allgemeinen Geiste. Die Leute verlangen zu hören, daß ein Paar geschaffen sei, plötzlich, durch einen Willensakt Gottes, daß von ihm die Völker abstammen, die heute noch leben. Je weiter wir zurückschauen, um so leerer und lichter erscheinen die Länder. Stärkere, schönere, einsamere Menschen wohnten in ihnen. Immer volkreicher werden dann die Erdteile und gewöhnlicher ihre Bewohner, immer seltener die großen Männer, und diese selbst geringer der Qualität nach. Endlich kommen wir so auf die eigene Zeit, die keine Helden mehr gebiert, wo der erbärmlichste Kerl, der lebt, ißt und trinkt, wie der edelste seinen eigenen Namen hat, dem er mit gemeinen Mitteln ein Echo aus den vier Enden der Welt verschaffen könnte.
Diese Betrachtung der Begebenheiten scheint dem Gefühle des Volkes zu entsprechen. Wir begegnen ihr überall. So erzählen wir und lassen uns erzählen; das Reine, Heroische liegt in der Vergangenheit, das Gemeine in der Gegenwart.
Allein es greift eine andere Ansicht von den Dingen um sich.
In der Zeit, in welcher ein Vulkan erkaltet und sich aus seinen erstarrten Lavaströmen ein waldbewachsenes Gebirge bildet, während der Krater nun ein stiller, tiefliegender See ist, sterben Generationen auf Generationen hin. Es bedurfte drei- bis viertausend Jahre etwa, um diese Umwandlung zu vollenden. Sie ist heute so deutlich zu erkennen, daß gar kein Zweifel darüber waltet, wie sie vollbracht worden sei. Solcher Langsamkeit gegenüber erscheinen die längsten Kriege der Menschen wie das rasche Wegflackern eines Reisigfeuers und das durch Jahrzehnte hingezogene Leiden eines Mannes kurz wie der augenblickliche Tod eines Käfers, dem man mit dem Fuße gelegentlich sein bißchen Leben austritt; die fernsten mythischen Zeiten der Geschichte liegen in ganz behaglicher, handgreiflicher Nähe vor uns. Es lebten damals Menschen wie heute, aßen, tranken, liebten und zankten sich. Man hat in den Seen der Schweiz Überbleibsel von Völkern entdeckt, deren Dasein all dem vorauszugehen scheint, was wir heute die Geschichte Europas nennen. Man fand halbverbranntes Korn, Scherben, Handwerkszeug und allerlei Knochenwerk. Es erscheint so wenig riesenhaft wie die Werkzeuge und Schädel der Indianer, die heute wahrscheinlich unter denselben Bedingungen leben, wie jene Leute getan, von denen wir nicht wissen, wohin sie gegangen sind.
Was sind wir mit unseren Maßen von Raum und Zeit? Was bedeutet die Erde, wenn wir sie als den einen Stern unter unzähligen anderen betrachten? Wie viel Revolution erlebte sie, ehe Menschen da waren, wie lange waren Menschen da, ehe sie sich der Vergangenheit zu erinnern anfingen? Die paar tausend Jahre, die wir mit dem Namen Geschichte bezeichnen, sind ein spannenlanger Abschnitt von einer Strecke, die nach Meilen gemessen werden könnte. Nicht mehr lange, und es wird die richtige Ansicht über diese Verhältnisse in das Volk dringen. Den Römern waren noch die Teile von Deutschland, welche jenseits der Elbe liegen, ebenso nebelverhüllte Märchenländer wie dem Mittelalter zur Zeit der Entdeckung von Amerika die Inseln des stillen Ozeans. Heute spricht der gemeine Mann von Südamerika, Australien und Japan und von den Epochen der Erdbildung. Unserem Gefühl von heute liegt die Zeit des Heroismus schon nicht mehr in der Vergangenheit, sondern wir erwarten sie als die schönste Frucht der Zukunft, wir steigen empor, nicht abwärts. Wir befinden uns in einer Krisis der Anschauungen. Wir blicken mit Geringschätzung hinter uns und erwarten neue Offenbarungen des Menschengeistes, größere Dinge, als sie die Welt jemals gesehen hat.
So gewiß die Bahnen der Gestirne ineinandergehen, daß jedes den Weg des anderen bedingt und mit seinen geringsten Eigentümlichkeiten sich fühlbar macht, so gewiß bilden die Menschen, welche leben, gelebt haben und leben werden, in sich ein ungeheures System, wo die kleinste Bewegung jedes einzelnen unmerklich meistens, aber dennoch bedingend auf den allgemeinen unaufhaltsamen Fortschritt einwirkt. Die Geschichte ist die Erzählung der Schwankungen, die im Großen eintreten, weil im einzelnen die Kräfte der Menschen ungleich sind. Unser Trieb, Geschichte zu studieren, ist die Sehnsucht, das Gesetz dieser Funktionen und der sie bedingenden Kraftverteilung zu erkennen, und indem sich hier unserem Blicke Strömungen sowohl als unbewegliche Stellen oder im Sturm gegeneinander brausende Wirbel zeigen, entdecken wir als die bewegende Kraft Männer, große, gewaltige Erscheinungen, die mit ungeheurer Einwirkung ihres Geistes die übrigen Millionen lenken, die, niedriger und dumpfer, sich ihnen hinzugeben gezwungen sind. Diese Männer sind die großen Männer der Geschichte, die Anhaltspunkte für den in den unendlichen Tatsachen herumtastenden Geist; wo sie erscheinen, werden die Zeiten licht und verständlich, wo sie fehlen, herrscht unverwüstliche Dunkelheit; und werden uns Massen sogenannter Tatsachen aus einer Epoche mitgeteilt, der große Männer mangeln, es sind lauter Dinge ohne Maß und Gewicht, die zusammengestellt, so bedeutenden Raum sie einnehmen, kein Ganzes bilden.
Es gibt ein allgemeines Gefühl über das, was groß ist. Die Menschheit hat es immer gewußt, es braucht nicht erklärt zu werden. Jedes Menschen Wert und Einfluß hängt davon ab, inwieweit er fähig ist, selber groß genannt zu werden oder sich denen anzuschließen, die es sind. Nur was unter diesem Gesichtspunkte sichtbar wird vom Menschen, bildet seine unvergängliche Persönlichkeit. Ein Herrscher, der mit eiserner Willenskraft Nationen in das Fahrgeleise seiner Launen hineinzwängt, wird spurlos vergessen werden; nachdem er eine Zeitlang als eine Art Affe der Vorsehung genannt worden ist, verschwindet der Begriff seiner Person, und der Name folgt ihr. Ein elender, dunkler Sterblicher, der den Zustand seines Volkes tief empfindend einen fruchtbaren Gedanken faßte und aussprach, dessen das Volk bedurfte, um einen Schritt vorwärts zu kommen, ist unsterblich in seiner Wirksamkeit. Und wenn sein Name vergessen werden sollte, man wird immer fühlen, an jener Stelle muß ein Mann gestanden haben, der eine Macht war.
So erweckt in uns das Studium der Geschichte nicht mehr Trauer über den Hingang schönerer Tage, sondern Gewißheit ihrer zukünftigen Erscheinung. Wir schreiten fort, wir wollen die kennen lernen, die zu allen Zeiten vorangingen. Das Studium der Geschichte ist die Betrachtung der Begebenheiten, wie sie sich zu den großen Männern verhalten. Diese bilden den Mittelpunkt, von dem aus das Gemälde konstruiert werden muß. Der Enthusiasmus für ihre Person verleiht die Fähigkeit, den richtigen Standpunkt ihnen gegenüber einzunehmen. Man will betrachten und anderen die Gabe der Betrachtung mitteilen. So meinte es Goethe, als er sagte der einzige Nutzen der Geschichte sei die Begeisterung.
Unsere Sehnsucht ist, die edelste Ansicht von der Menschheit zu gewinnen. Wenn wir die großen Männer anschauen, ist es, als sähen wir eine siegreiche Armee als die Blüte eines Volkes einherziehen. So hoch als im Momente eines solchen Triumphzuges auch der niedrigste Soldat des Heeres über allen Zuschauern steht, so erhaben über der unübersehbaren Masse der Sterblichen steht auch der geringste unter jenen, die wir große Männer nennen. Es schmückt sie alle derselbe Lorbeer. Eine höhere Gemeinschaft findet statt unter ihnen. Sie schieden sich ihrem irdischen Auftreten nach: jetzt stehen sie dicht beieinander, Sprache, Sitten, Stand und Jahrhunderte trennen sie nicht mehr. Sie reden alle eine einzige Sprache und wissen nichts von Adel oder Pariatum, und wer heute oder zukünftig wie sie denkt und handelt, steigt hinauf zu ihnen und wird in ihre Reihen aufgenommen.
II
Aus der Zahl der Bürger von Florenz sind drei als große Männer zu bezeichnen: Dante, Leonardo da Vinci und Michelangelo. Raffael stammte aus Urbino; doch darf er dazu gerechnet werden, weil er als Künstler für einen Florentiner gelten könnte. Dante und Michelangelo stehen am höchsten. Es ist nicht die Folge einseitiger Vorliebe, wenn dies Buch, das sich mit der Blüte der florentinischen Kunst beschäftigt, Michelangelos Namen an der Stirn trägt. Ein Leben Raffaels oder Leonardos würde doch nur ein Bruchstück von dem des Michelangelo bedeuten. Seine Kraft überbietet die ihre. Er allein beteiligt sich an der allgemeinen Arbeit des Volkes. Samt seinen Werken ragt er empor wie eine Erscheinung, die sich von allen Seiten der Betrachtung bietet, wie eine Statue, während jene beiden mehr wie prächtige Bildnisse erscheinen, die stets dasselbe lebendige Antlitz, aber auch stets von derselben Seite zeigen.
Das Gefühl, daß Michelangelo so hoch stehe, bildete sich früh bei seinen Lebzeiten in Italien nicht allein, sondern verbreitete sich über Europa. Es kommen deutsche Edelleute nach Rom: das erste, was sie verlangen, ist Michelangelo zu sehen. Auch daß er so alt wurde und in zwei Jahrhunderten lebte, ist ein Teil seiner Größe. Wie Goethe genoß er im Alter die Unsterblichkeit seiner Jugend. Er wurde zu einem Elemente in Italien. Wie ein alter Felsen, um den man einen Umweg macht im Meere, ohne sich mit Gedanken aufzuhalten, was er daliege und die gerade Straße versperre, respektierte man in Rom seine politische Festigkeit. Man gestattete ihm, seiner eigenen Überzeugung nach zu leben, und begehrte nichts als den Ruhm seiner Gegenwart. Er hinterließ ein weites Reich, das seinen Namen trug, jedes seiner Werke war ein Samenkorn, aus dem zahllose andere erwuchsen. In der Tat, zahllos sind die Arbeiten, die im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert nach dem Muster der seinigen ausgeführt wurden. Wie sich in Dantes Persönlichkeit das dreizehnte Jahrhundert und der Beginn des vierzehnten spiegelt, so umfaßt der Name Michelangelos jene folgenden, und weil zu derselben Zeit in Deutschland Luther, in ganz anderer Weise freilich und auf anderem Gebiete, einen ähnlichen allumfassenden Einfluß gewann, so bildet das Leben Michelangelos zu dem Luthers einen Gegensatz, der den Unterschied der Nationen darlegt, in deren Mitte die beiden Kräfte tätig waren.
Nach dieser Richtung hin ist Michelangelo kaum bekannt. Mehr instinktmäßig fühlte man nur, daß sein Name das Symbol einer umfassenden Tätigkeit sei. Der Zusammenhang seiner Schicksale mit denen seines Landes und dem Inhalte seiner Werke ist noch nicht in das allgemeine Bewußtsein übergegangen. In dieser Hinsicht glaubte ich, sei mit einer Beschreibung seines Lebens eine nützliche Arbeit zu versuchen.
Zwei ziemlich umfangreiche Biographien Michelangelos besitzen wir, beide von Künstlern verfaßt, welche sich seine Schüler nennen, beide zu seinen Lebzeiten gedruckt. Die eine von Ascanio Condivi, der in seinem Hause lebte, die andere von Giorgio Vasari, bekannt als Maler, Architekt und Kunstliterat am Hofe der florentinischen Herzöge. Von ihm erschien 1550 ein Buch, genannt Lebensbeschreibungen der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister. Michelangelos Leben bildet den Schluß des dritten und letzten Teiles.
Über Vasaris Charakter ist Meinungsverschiedenheit kaum möglich. Seine Tugenden und Fehler verstecken sich zu wenig. Er war Hofmaler, Hofagent in Kunstsachen, was er getan hat, tat er im Hinblick auf die Gunst seiner Herren und Gebieter, deren er mehrere erlebte. Von sich selbst redet er unbefangen wie von einem Meister, der mit dem allerersten in einer Linie steht. Michelangelos und anderer Künstler Fehler bespricht er in einem Tone, als wolle er andeuten, daß er aus der Erkenntnis dieser Irrtümer den nötigen Nutzen gezogen und sie vermieden habe. Er lobt seine eigenen Werke mit einer Bescheidenheit, für die er Anerkennung zu finden hofft, und redet von sich und seinem gesamten Wirken wie von einer höchst verehrungswürdigen dritten Person. Diejenigen, welche ihm opponieren oder ihm persönlich mißfallen, behandelt er ohne Umstände schlecht, etwa wie ein Theaterrezensent einen Schauspieler, dem er zeigen will, daß er eine Macht sei, die nicht mit sich spaßen lasse. In dieser Beziehung erlaubt sich Vasari das Ärgste. Er hat Künstler, die er nicht mochte, auf eine Weise verketzert, daß sie mit Mühe wieder zu Ehren gebracht werden mußten. Auf die Genauigkeit seiner Daten ist kein Verlaß. Er gibt falsche Jahreszahlen an und beschreibt Bilder zuweilen so, daß seine Worte nicht mit dem stimmen, was darauf zu sehen ist. Wo man seine Behauptungen mit sicheren Dokumenten vergleicht, findet man viele Irrtümer; wo man die Quellen, die er benutzte, noch besitzt und nachlesen kann, gewahrt man, daß er fortließ oder zusetzte, was ihm genehm war.
Dennoch ist sein Buch eine verdienstvolle, unentbehrliche Arbeit. Er kannte die Urkunden nicht, die uns heute zu Gebote stehen. Ihm und seinem Jahrhundert fehlte der Sinn für die kritische Schärfe, mit der heute gearbeitet wird. Sein Buch ist und bleibt für den Kunstfreund ein Schatz, dessen Reichtum unerschöpflich scheint. Sein Stil ist klar und gedrängt, seine Weltansicht eine heitere und vernünftige. Im ganzen sind die Verdienste Vasaris so groß, daß sie durch keinen Tadel aufzuwiegen wären.
Gerade seinen tadelnswerten Eigenschaften aber verdanken wir es, daß wir über Michelangelo so gut unterrichtet sind. Vasari sandte sein Buch, als es fertig gedruckt war, dem alten Meister zu, der ihm darauf mit einem Sonette antwortete, in welchem die verbindlichsten Dinge gesagt sind. Eine andere Antwort jedoch, entgegengesetzten Inhalts, lag in dem Erscheinen der Condivischen Arbeit. Condivi lebte in seines Meisters unmittelbarer Nähe. Vasari, obgleich er es anders darstellen möchte, stand Michelangelo fern, dessen schmeichelhafte Briefe mehr dem Hofagenten als dem Künstler gelten. Wie fern in Wahrheit Vasari dem großen Manne stand, zeigt nichts so sehr als sein Buch, denn man kann sich nichts Flüchtigeres, Falscheres und Liederliches denken als diese Biographie in ihrer ersten Gestalt. Wichtige Ereignisse übergeht er, stellt die Tatsachen falsch an sich und in falscher Ordnung dar, weiß besonders in Betreff der Jugendzeit gar nichts oder hilft sich in Ermangelung inhaltreicher Wahrheit oft mit leeren lobenden Redensarten.
Offenbar wollte Michelangelo die Welt eines Besseren belehren, ohne Vasari wehe zu tun. Deshalb durfte Condivi in seiner Vorrede diesen nicht einmal bei Namen nennen, wo Vasari indirekt bezeichnet wird, weil dies nicht zu umgehen war, bedient Condivi sich des Pluralismus und spricht von mehreren unbestimmten Leuten, denen er Vorwürfe macht.
»Von der Stunde an«, lautet Condivis Vorrede, »in der ich durch Gottes besondere Güte würdig erachtet worden bin, über alle meine Hoffnung hinaus den einzigen Maler und Bildhauer Michelangelo Buonarroti nicht nur von Angesicht zu Angesicht zu erblicken, sondern auch seiner Zuneigung, seines täglichen Gespräches und Zusammenlebens teilhaftig zu werden, begann ich, im Gefühl, wie groß dieses Glück sei, und in der Begeisterung für meine Kunst und für die Güte, mit der er mich behandelte, seine Regeln und Vorschriften genau zu beobachten und zu sammeln. Was er sagte, was er tat, wie er lebte, alles mit einem Worte, was mir der Bewunderung, der Nacheiferung oder des Lobes wert schien, zeichnete ich auf und beabsichtigte es zu gelegener Zeit in einem Buche zusammenzustellen. Ich wünschte ihm damit für das, was er an mir getan hat, zu danken, so viel es in meinen Kräften läge; auch hoffte ich anderen durch meine Aufzeichnungen, in denen das Leben eines solchen Mannes als leuchtendes Beispiel aufgestellt wurde, Freude zu machen und ihnen nützlich zu sein, denn jedermann weiß, wie sehr unser Zeitalter und das zukünftige ihm für den Ruhm verpflichtet sind, der durch seine Werke über sie ausgebreitet wurde. Um zu fühlen, was er getan hat, braucht man es nur mit dem vergleichen, was andere taten.
Während ich so in meine Vorratskammern still einsammelte, deren eine für die äußeren Lebensumstände, die andere für die Kunstwerke bestimmt war, und in beiden der Stoff anwuchs, wurde ich in unvorhergesehener Weise dazu gezwungen, meine Arbeit nicht nur zu beschleunigen, sondern was die Lebensbeschreibung anbetrifft, sie sogar zu überstürzen. Es haben nämlich einige andere über diesen seltenen Mann geschrieben und, weil sie ihm, wie ich glaube, nicht so nahe standen als ich, einmal Dinge behauptet, die rein aus der Luft gegriffen sind, zweitens aber wichtige Umstände ganz ausgelassen. Außerdem aber haben andere, denen ich meine Arbeiten im Vertrauen mitgeteilt hatte, sich dieselben auf eine Weise angeeignet, aus der leider die Absicht hervorzugehen scheint, mir nicht nur die Früchte meiner Mühe, sondern auch die Ehre davon vorwegzunehmen. Um deshalb der Mangelhaftigkeit jener erstgenannten Autoren zu Hilfe zu kommen, andererseits aber dem Unrecht vorzubeugen, das mir von den letzteren bevorsteht, entschloß ich mich, meine Schrift unfertig, wie sie war, herauszugeben.«
Hierauf folgen Entschuldigungen des mangelhaften Stils wegen, er sei ein Bildhauer und kein Schriftsteller von Profession. Endlich das Versprechen, daß ein genauer Katalog der Werke Michelangelos nachfolgen werde. Leider ist davon keine Spur zu finden. Nicht einmal die Nachricht, ob er in der Tat geschrieben oder gedruckt worden sei. Die »einigen« und die »anderen«, von denen er spricht, scheinen nur den einzigen Vasari zu bedeuten.
Condivis Buch wurde dem Papste gewidmet, der es huldvoll entgegennahm und dem Autor persönlich dafür dankte. Michelangelo hat das wohl vermittelt. Vasari ließ die Sache beruhen, aber nach Michelangelos Tode rächte er sich auf seine Weise.
Er gab eine neue Bearbeitung seiner Lebensbeschreibungen heraus und nahm in dieselbe Condivis Arbeit ihrem ganzen Umfange nach auf, oft wörtlich, oft mit absichtlich anders gestellten Worten. Dabei verfuhr er jedoch wieder so nachlässig, daß er sich nicht einmal die Mühe nimmt, die zu seiner ersten Ausgabe befindlichen falschen Angaben zu verbessern, sondern er verflicht diese grobweg in diejenigen Condivis, so daß er doppelte Nachrichten bringt, die falschen neben den richtigen, was in den Köpfen seiner späteren Herausgeber dann weitere Verwirrung zur Folge hatte. Condivis Namen nennt er nicht, deutet dagegen auf das erkenntlichste an, er sei ein Lügner und unzuverlässiger Mensch, während er selber niemals etwas anderes als die lauterste Wahrheit geschrieben habe. Niemand, sagt er, besäße so viel und so schmeichelhafte Briefe von Michelangelos eigener Hand und hätte ihm so nahe gestanden. Freilich, heißt es am Schluß seiner Lebensbeschreibung, Michelangelo hatte Unglück mit denen, die täglich um ihn gewesen sind. Und nachdem er noch einmal hier auf seine eigene Bescheidenheit zurückgekommen, erwähnt er jetzt Condivi als einen Schüler Michelangelos. Von seiner Schriftstellerei keine Silbe, nur daß er nichts vor sich gebracht habe, daß der Meister ihm zu Hilfe gekommen sei, aber auch das ohne Frucht, daß Michelangelo sich sogar gegen ihn selbst, gegen Vasari nämlich, mit Bedauern über die vergeblichen Anstrengungen des armen Teufels ausgesprochen hätte.
Damit jedoch begnügte er sich noch nicht. Er versucht Condivis einfache Nachrichten womöglich zu überbieten. Er weiß jetzt die Dinge, die vor Condivis Buch niemand kannte, viel besser als der selbst, von dem er sie abschreibt. Ob er bei seinem Wunsche, Condivi zu übertreffen, jedoch stets nur von der eigenen Phantasie belehrt wurde, ist eine Frage, die offen bleibt. Vasari liebt es allerdings, die Begebenheiten abzurunden und durch eigene kleine Zwischengedanken in lebendigere Verbindung zu bringen: Vieles mag so entstanden sein, in manchen Fällen gelang es ihm aber wohl in der Tat, Neues herbeizuschaffen und auf der von Condivi gegebenen Grundlage solide weiterzubauen.
Jedenfalls erreichte er seinen Zweck. Er hatte seines Nebenbuhlers Arbeit ganz und gar in die eigene aufgenommen und sie als ein besonderes Buch überflüssig gemacht. Er war der berühmte Vasari. Condivis Buch geriet in solche Vergessenheit, daß im Jahre 1746, in dem man es zuerst wieder abdruckte, kaum ein Exemplar aufzutreiben war.
Wie wenig ehrenvoll nun auch die Ursachen sind, aus denen wir Vasaris zweite Arbeit in so verbesserter, ausführlicher Gestalt besitzen, und wie traurig das Schicksal Condivis, dessen Ende zugleich ein tragisches war (er ist ertrunken ohne für die Unsterblichkeit seines Künstlernamens vorher Sorge tragen zu können): beide Arbeiten gewährten eine große Ausbeute. Zu ihnen kamen Briefe, die Michelangelo selbst geschrieben hat, zahlreiche Gedichte von seiner Hand, Tagebuchnotizen, Kontrakte und verschiedenartige Aktenstücke, welche auf ihn bezüglich sind. Johann Gaye, ein Schleswig-Holsteiner, der in Berlin studierte und dann nach Italien ging, hat sich hier die größten Verdienste erworben. Er durchforschte die überfüllten Archive von Florenz, und andere sind auf seiner Fährte weiter gegangen. Gaye vollendete sein Werk nicht, er starb 1840, Herr von Reumont hat den dritten Teil des Buches herausgegeben. Die genannte letzte Florentiner Ausgabe des Vasari bot eine vortreffliche Zusammenstellung des bis auf die letzte Zeit bekannt gewordenen Materials, während die ein Jahrhundert ältere Ausgabe Condivis gleichfalls mit guten Noten verschiedener Autoren versehen ist. Mr. Harfords Life of Michelangelo enthielt einiges, was nicht bekannt war.
Im höchsten Grade umfangreich sind die Quellen, aus welchen die Geschichte der Zeiten geschöpft wird, von denen wir Michelangelo getragen sehen. Über keine Epoche der neueren Geschichte haben Zeitgenossen so kraftvoll und so schön berichtet; ihre Darstellung allein läßt oftmals Begebenheiten groß und wichtig erscheinen, die, von geringerer Feder aufgezeichnet, kaum die Aufmerksamkeit zu locken vermochten.
Voran die Werke Machiavellis. Mit einer unparteiischen Klarheit, die so groß ist, daß man mitten in ihrer Anerkennung an ihr zweifeln möchte, eben weil sie beinahe zu weit getrieben wird, gibt er von den leisesten Zuckungen der Zeiten Rechenschaft, die er mit durchmachte. Seine Sprache schreibend wie die besten antiken Autoren die ihrige, vertraut mit den politischen Ideen des Jahrhunderts, gewährt er den Grundton aller Anschauung. Um wenige Jahre älter als Michelangelo (er wurde 1469 geboren, drei Jahrhunderte vor Napoleon und Humboldt), starb er, als Michelangelo noch nicht zwei Drittel seines Weges zurückgelegt hatte. Stände sein persönliches Leben im Einklang mit der Höhe seines Geistes, so würde er der größte Mann seiner Zeit heißen neben Michelangelo, aber es wird gesagt werden, warum ihm von diesem Ruhme ein geringerer Anteil zukommt.
Nach ihm Guicciardini, kräftiger und gewaltsamer als Charakter, aber geringer in der Darstellung, ein Mann, der nicht wie er in untergeordneter Stellung oder in unfreiwilliger Muße Nebenstunden zum Nachdenken und Studieren fand, sondern von früh auf bis zum Schlusse seines Lebens hohe Posten bekleidete. Er kannte vielleicht mehr Menschen und Verhältnisse als Machiavelli, griff sicherlich hundertmal selbst gestaltend ein, wo dieser nur betrachtend dabei stand; aber er beobachtete oberflächlicher und durchschaute die Charaktere nicht mit dessen Blicken, die sich wie Scheidewasser über die Dinge gossen. Während Machiavelli höhere Gesetze als die Treibräder des Geschehenden erkennt, leitet Guicciardini die Verwickelung der Begebenheiten aus den bösen Leidenschaften der Menschen her. Er kannte ihre Macht und hatte sie in sich selbst erprobt. Auch er starb vor Michelangelo. Sein gewaltsamer Tod war die Frucht seines eigenen falsch berechnenden Ehrgeizes.
Dagegen Giovio, römischer hoher Geistlicher, aufgewachsen als Schmeichler an den Höfen der Päpste und eingestehend, daß er für Geld den Dingen einen Mantel umhänge. Aber in schöne Falten weiß er ihn zu legen, und in alle Intrigen eingeweiht, enthüllt er die Situation der politischen Verhältnisse. Wir besitzen von ihm als geringe Nebenstücke seiner weitschichtigen historischen Schriften ein paar kurze Lebensbeschreibungen Raffaels und Michelangelos, lateinisch abgefaßt und wertvoll, obgleich Giovio kein Freund Michelangelos war.
Dann Bembo, im Alter Kardinal, in der Jugend geistlicher Aventurier und Geliebter der Lucrezia Borgia, einer der vielen, die sich ihrer Gunst erfreuten, höher stehend als Giovio, aber doch aus gleichem Holze geschnitzt. Seine Briefe, in vielen Bänden zusammengedruckt, ein Abbild der Denkungsart der höheren Kreise und ein Muster jener späteren eleganten Prosa, die schmeichlerisch, inhaltslos, dem Auge und Ohr behagliche Worte bietet und ihre Kälte durch Beteuerungen verdeckt. Wie Giovio schmiegte er sich durch die hohen Herren hindurch, bis aus ihrem Diener ihr Vertrauter, ihr Freund und endlich ihresgleichen wurde.
Nardi dagegen, ein Florentiner Demokrat, aus bester Familie, in der Verbannung die Geschichte seiner Vaterstadt schreibend. Mild, diskret, ohne voreiliges Urteil, aber leidenschaftlich gegen die Feinde der Freiheit, deren Verlust ihm so teuer zu stehen kam. Er berichtet für Florentiner, die, wie er, mitten in der Politik der Stadt lebend, von vornherein mit den Verhältnissen der Stadt bekannt sind.
Nerli dagegen ist darüber hinaus, daß die Freiheit vernichtet wurde. Der Vorwurf lastet auf ihm, als Spion über die Pläne der vertriebenen Verteidiger der alten Unabhängigkeit nach Florenz berichtet zu haben. Die geruhige Ordnung unter der neuen Herrschaft ist ihm der richtige und erwünschte Zustand, von dem er ausgeht. Aufruhr und Revolution sind an sich gebrandmarkt, doch erkennt er die Freiheit an für die Vergangenheit. Ihm und anderen seiner Zeit kam es zugute, daß die Herzöge einer Linie der Medici angehörten, die von dem anderen Zweige der Familie, aus dem die beiden Päpste und die Unterdrücker der Freiheit stammten, unterdrückt und mißhandelt worden waren. Somit erschien es weniger unerlaubt, von diesen Leuten ohne Rücksicht zu reden und sich dadurch auf die Seite der alten Freiheit zu stellen, die ja doch nie wiederkehrte.
Die letzten Kämpfe um diese Freiheit schildert Segni in einem Buche, dessen Existenz niemand ahnte in den Zeiten, wo es verfaßt wurde. Er schreibt frei, genau und gebildet, aber nicht so anschaulich und energisch als Nardi und Guicciardini.
Auch Varchis Buch blieb ungedruckt, obgleich im Auftrage des Großherzogs selber angefertigt. Die Erlaubnis zur Herausgabe wurde nicht erteilt. Varchi ist schon ein Genosse Vasaris, erster Literat der Residenz und obenaufschwimmend im Florentiner Leben, das sich an die neue Dynastie gewöhnt hatte. Varchi hielt Michelangelos Leichenrede. Er redet auch von der alten Unabhängigkeit mit Begeisterung und beweint ihren Untergang, aber es sind die Tränen eines Historikers, und so hochtönend er vom alten, freien Florenz spricht, bleibt doch das neue Florenz, in dem er sich selber so wohl befindet, aus dem Spiele. Über die Zeiten um 1530 hat er gesammelt, was nur zusammenzuscharren war, aber den Stoff in seinen Geist aufzunehmen und aus sich selbst heraus zu gestalten, verstand er nicht.
Wie wenig er sich erlauben durfte, das ihm zu Gebote stehende Material nach Belieben auszunutzen, zeigen die Briefe Businis an ihn, der, in der Verbannung in Rom lebend, durch Varchi veranlaßt, seinen Erinnerungen aus den Jahren 1527-31 in vertraulichen Briefen freien Lauf läßt. Sie sind der eigentümlichste, unbekümmertste Ausdruck des florentinischen Geistes. Mit beißender Heftigkeit schwatzt er über die Ereignisse und Menschen. Ein Demokrat, von guter Familie, stolz, aber mit der Ruhe endlich errungener Gleichgültigkeit, weil doch schon so viele Jahre darüber hingegangen sind, gab sich Busini in Rom jener ironischen Apathie gegen die politischen Ereignisse hin, der auch Michelangelo in den letzten Jahren seine Hoffnungen zum Opfer brachte. Die Zeiten schienen damals für immer vorüber zu sein, in denen sich freie Bürger an den Schicksalen des Vaterlandes eingreifend beteiligen durften.
Neben diesen, eine stets individuelle, oft parteiliche Ansieht vertretenden Schriften die Berichte der venezianischen Gesandten, geschäftsmäßig, leidenschaftslos und nur unter dem Gesichtspunkte der Nützlichkeit für die Republik von San Marco abgefaßt.
Dann zwei Äußerungen menschlichen Geistes, deren Gegensatz nicht größer gedacht werden kann, die Schriften und Predigten Savonarolas und die Tagebücher des Burcardo und des Paris bei Grassi, beides päpstliche Zeremonienmeister. Dort die Blüte religiöser Begeisterung, hier die Fragen des Zeremoniells und die geheimsten Erlebnisse des Vatikan. Dort hinreißende, heroische Beredsamkeit einer Natur, die in Sprüngen einer gewaltsamen Katastrophe entgegeneilt, hier nur ein Auge auf starre Äußerlichkeiten, in deren eifersüchtige Beobachtung die Seele langsam hineinversteinert.
Dazu endlich eine Reihe trocken aufzeichnender Chroniken und Urkunden und die Massen von Büchern aller Art, die überhaupt damals gedruckt worden sind. Alle enthalten etwas. Unmöglich, diese Quelle zu erschöpfen. Man muß sich begnügen, das genau zu kennen, was von denjenigen Augenzeugen herrührt, deren Geist sich als ein hervorragender erkennbar macht.
Dies waren die Hilfsmittel, mit denen ich Michelangelos Leben zu schreiben begann. Man wußte, daß das Archiv der Familie Buonarroti zahlreiche Briefe und Dokumente jeder Art enthielt, aber zugleich war bekannt, daß es unmöglich sei, diese Papiere zur Einsicht zu erhalten. Da, im Jahre 1800, starb der letzte Buonarroti. Er vermachte sein Archiv der Stadt Florenz. Eine Kommission veröffentlichte ein Verzeichnis der vorhandenen Papiere. Es war eine natürliche Voraussetzung, daß sie nun der Benutzung offen ständen; jetzt aber eine neue Unmöglichkeit: der Graf Buonarroti hatte die Annahme seines Vermächtnisses von der Verpflichtung abhängig gemacht, das Geheimnis nach wie vor zu wahren und niemand das Geringste mitzuteilen, und so schien es, daß bei bewandten Umständen überhaupt unmöglich sei, die Arbeit fortzusetzen.
Durch einen glücklichen Zufall jedoch war nicht der gesamte Inhalt des Buonarrotischen Nachlasses zu dieser Abgeschlossenheit verurteilt worden. Ein Teil der Erbschaft kam durch Ankauf in den Besitz des britischen Museums. Hier natürlich stand der Benutzung kein Hindernis entgegen, und ich gelangte zur Kenntnis dreier umfangreicher Briefwechsel sowie einer Anzahl anderer Dokumente, alles in der sorgfältigen, malenden Handschrift Michelangelos so deutlich vorliegend, daß sich die Seiten wie die eines gedruckten Buches glatt herunterlasen.
Hundertundfünfzig Briefe wurden mir so zugänglich. Mit ihnen habe ich mich von der zweiten bis zur vierten Auflage meines Buches begnügen müssen. Endlich sind zur vierhundertjährigen Geburtstagsfeier Michelangelos auch die größere Anzahl der Florentiner Briefe gedruckt worden. Mit denen, welche das Britische Museum besitzt, zu einem stattlichen Bande vereinigt, lagen sie nun sämtlich vor. Was diese Briefe jedoch im allgemeinen anlangt, darf ich eine Beobachtung nicht verschweigen, die sich in dem Maße mehr bestätigt hat, als die anfangs so große Enthüllungen versprechenden Papiere schrittweise ans Tageslicht gebracht wurden.
Je mehr ich in meinen Studien für die Lebensbeschreibung Michelangelos fortgeschritten war, um so zahlreichere Fäden hatte ich entdeckt, die von diesem Manne nach allen Seiten hin ausliefen oder die, von den Erscheinungen seiner Zeit ausgehend, sich in ihm vereinigten. Nicht daß sein unmittelbarer Einfluß hervorgetreten wäre, aber der Zusammenhang seiner Fortentwicklung mit dem, was um ihn her geschah, zeigte sich. Immer deutlicher empfand ich die Nötigung, alles, was während seines Lebens sich ereignete, kennenzulernen, um ihm selbst näher zu kommen. Es ist mir vorgeworfen worden, daß ich mein Buch das »Leben Michelangelos« genannt, während ich es »Michelangelo und seine Zeit« hätte nennen sollen. Aber diese beiden sind eins mit ihm: er und die Ereignisse, die er erlebte. Je erhabener der Geist eines Mannes ist, je mehr erweitert sich der Umkreis, den seine Blicke berühren, und was sie berühren, wird ein Teil seines Daseins. Und so, je weiter ich vorwärts kam, um so unvollkommener erschien mir meine Bekanntschaft mit den Dingen, die ich betrachtete. Denn wo ich sie von einer Seite endlich erfassen lernte, ward mir zugleich klar, von wie viel andern ich sie weiter zu erfassen hätte, um ein in Wahrheit unbefangenes Urteil zu bilden.
Man sollte nun denken, es habe durch die Fülle der aus Michelangelos Briefen uns zufließenden Kenntnis seiner intimsten Gedanken und innersten Privatverhältnisse diesem Gefühle, im Grunde nur wenig von ihm zu wissen, ein Ende gemacht werden müssen. Allein im Gegenteil, die Aufklärungen, welche wir so empfangen, beirren uns oft viel mehr, als sie uns belehren. Wir wissen jetzt Dinge, von denen bei Michelangelos Lebzeiten niemand wußte, ja die er selber, als er Condivi von sich erzählte, vergessen hatte. Und doch kannten ihn die besser, die mit ihm lebten, ohne jemals in diese Besonderheiten eingeweiht zu sein. Es geht uns ähnlich mit Goethe. Wir können heute bei vielen seiner Arbeiten fast Tag und Stunde angeben, wann er sie zuerst niederschrieb, liegen ließ, wieder aufnahm und vollendete. Wir sind darüber, wenn wir den Inhalt vieler Briefe mit der von ihm selbst verfaßten eigenen Lebensbeschreibung vergleichen, besser unterrichtet als er selbst. Was aber nützt es? Würden alle Notizen über die Entstehung der Iphigenie ein Dutzend Verse aufwiegen, die wir dafür in dem Gedichte entbehren sollten? Ein Künstler führt als Schöpfer seiner Werke ein höheres Dasein als seine niederen irdischen Schicksale uns zeigen; in einer geheimnisvollen Atmosphäre entstehen diese Erzeugnisse des Geistes, zu der wir nicht emporsteigen. Jene Resultate unseres Nachspürens zu Sprossen einer Leiter dahin verarbeiten zu wollen, wäre ein vergebliches Unternehmen. Und so, wenn es bei einem Manne wie Goethe, der kaum gegangen ist, der die Luft beinahe noch atmete, in der wir leben, und von dem wir zehn Briefe aufzuweisen imstande wären, wo von Michelangelo einer vorhanden ist, wenn es bei Goethe doch am Ende nicht auf die Briefe, sondern auf die Erkenntnis der Zeit und die Tiefe des Verständnisses für seine Dichtungen ankommt, um zu fühlen, was er gewesen, so ist dies in noch höherem Grade bei Michelangelo der Fall, dessen Handwerk das Schreiben nicht war, der meistens in seinen Briefen die Person berechnet, an die er sie richtet, und selten sein Herz zeigt wie in seinen Werken, seinen Taten oder auch seinen Gedichten. Von der Strömung der Zeit, von der Trauer um das, was ihm mißlungen, der Hoffnung auf die Zukunft, enthalten die Briefe wenig. Einzelne Seiten seines Charakters zeigen sie in ihrer ganzen Schärfe, wo man früher nur ahnte, daß es so wäre, aber auch hier meistens nicht bei Ereignissen, die bedeutend sind. Seine Briefe geben viel, sie sind, sobald man sie einmal kennt, ein Teil von ihm, der sich von nun an nicht entbehren ließe, aber besäßen wir nichts als seine Arbeiten, die Biographie Condivis und die Geschichte von Florenz und Rom: aus dem Marmor, den diese liefern, ließe sich die Gestalt des Mannes heraushauen, wie er war, und was dazu kommt, hilft das Bildnis nur glätten und feiner ausarbeiten, ohne daß der ersten Anlage nach eine Falte anders gelegt zu werden brauchte.
Unter diesen Umständen erwecken auch die Papiere, welche immer noch unpubliziert in Florenz liegen, die Neugierde nicht mehr, mit welcher früher Michelangelos Briefe erwartet wurden. Über tausend Nummern an ihn gerichteter Schreiben sollen noch vorhanden sein. Was sie ohne Zweifel gewähren werden, ist genauere Datierung der Werke und der laufenden Arbeit daran sowie Aufschlüsse über allerlei Verhältnisse Michelangelos, von denen wir heute wenig oder nichts wissen. Allein vielleicht dürfte auch hier eintreten, daß man einmal mit noch größerer Beflissenheit, als man zuerst nach diesen Mitteilungen verlangte, sie in der Folge wieder zu beseitigen suchen wird, weil sie die einfachen Linien der Persönlichkeit wie wucherische Schlinggewächse eher verhüllten als klarer werden lassen.
Für die eigenen Arbeiten war den Florentiner Gelehrten die Benutzung dieses Materials natürlicherweise gestattet worden, und daraufhin muß Aurelio Gottis 1876 erschienenem Leben Michelangelos bedeutender Wert zugeschrieben werden. Vieles fand ich hier gedruckt, was meinen Blicken sonst entzogen geblieben wäre. Gottis Buch sticht durch diese wertvollen Eigenschaften unter der Masse anderer Publikationen hervor, welche zur Feier des vierhundertjährigen Geburtsfestes Michelangelos in Italien, in Frankreich und bei uns erschienen sind.
III
Im Jahre 1250 soll Simone Canossa, der Stammvater der Buonarroti, als Fremder nach Florenz gekommen sein und sich durch ausgezeichnete, der Stadt geleistete Dienste das Bürgerrecht erworben haben. Aus einem Ghibellinen sei er ein Guelfe geworden und habe deshalb sein Wappen, einen weißen Hund mit einem Knochen im Maule in rotem Felde, in einen goldenen Hund in himmelblauem Felde verändert. Dazu seien ihm von der Signorie noch fünf rote Lilien und ein Helm mit zwei Stierhörnern, eins golden, eins himmelblau, verliehen worden. So Condivi.
In den Adern der Simoni aber, die von den Grafen Canossa abstammten, flösse kaiserliches Blut, schreibt er weiter. Beatrice, die Schwester Kaiser Heinrich des Zweiten, sei die Stammutter der Familie, das eben beschriebene Wappen im Palaste des Podesta von Florenz noch zu sehen, wo Simone Canossa es gleich dem anderer Podestas habe in Marmor aushauen lassen. Der Familienname Buonarroti stamme daher, daß er als Vorname in der Familie herkömmlich gewesen sei; einer müsse ihn immer als einzigen Taufnamen führen. So sei er ein Kennzeichen des Geschlechtes geworden und habe sich endlich statt des Namens Canossa in die Bürgerrolle eingeschlichen.
Wir können annehmen, daß Condivi diese Mitteilungen von seinem alten Meister erhielt und daß dieser somit an das kaiserliche Blut in seinen Adern glaubte. Die Buonarroti hielten fest an dieser Tradition. Florentinische Geschichtsforscher haben indessen keinen Simone Canossa, der 1250 Podesta der Stadt gewesen wäre, zu entdecken vermocht. Auch in den Familiennachrichten des Grafen von Canossa wird dieser Persönlichkeit nicht erwähnt. Noch weniger stimmt das Wappen der Canossa mit dem, das Condivi beschreibt, oder das der Buonarroti selber damit. Dieses bestand aus zwei goldenen Querbalken im himmelblauen Felde, keine Spur von dem goldenen Hunde mit einem Knochen im Maul.
Der Hund führt vielleicht auf die Fährte einer Erklärung, wie die Fabel entstand. Das Mittelalter hatte seine eigene Art, die Worte symbolisch zu erklären. Der Hund canis, mit dein Knochen os im Maule, os wird auf demselben Wege zu »Canossa« wie die Dominikaner zu den »Hunden des Herrn«, domini canes, wurden. wichtiger indessen als die genaue Erklärung des Märchens ist der Umstand, daß der alte bürgerliche Michelangelo, dieser Erzguelfe, seine Biographie trotz alledem mit einer Erklärung beginnen läßt, durch die er sich seiner Abstammung von dem alten ghibellinischen höchsten Adel rühmt, und daß, wie ein noch vorhandener Brief eines Canossa aus dem Jahre 1520 beweist, die gräfliche Familie die Verwandtschaft anerkannte. Graf Alexander von Canossa tituliert Michelangelo in Anrede wie Adresse als seinen geehrten Vetter, Parente onorato, lädt ihn zu sich ein, bittet ihn, das Haus seiner Familie als sein Eigentum zu betrachten und geht so weit, ihn Michelangelo Buonarroti da Canossa zu titulieren.
Die Buonarroti, oder, wie sie sich schrieben, die Buonarroti Simoni, waren eines der angesehensten florentinischen Geschlechter. Ihr Name findet sich oft mit Staatsämtern verbunden. 1456 saß Michelangelos Großvater in der Signorie, 1473 sein Vater im Collegium der Buonuomini, einer aus zwölf Bürgern bestehenden Kommission, welche der Signorie beratend beigestellt war. 1474 wurde er zum Podesta von Chiusi und Caprese ernannt, zweier Städtchen mit Kastellen im Tale der Singarna gelegen, eines kleinen Gewässers, das sich in die Tiber ergießt.
Die Tiber entspringt in dieser Gegen und ist selber noch ein unbedeutender Fluß, wenn sie sich mit der Singarna vereinigt. Das Land ist gebirgig.
Michelangelos Vater, Lodovico mit Namen, begab sich von Florenz auf seinen Posten. Seine Frau, Francesca, gleichfalls aus guter Familie, war gerade hochschwanger, was sie nicht hinderte, ihren Mann zu Pferde zu begleiten. Dieser Ritt hätte ihr und dem Kinde gefährlich werden können, sie stürzte mit dem Tiere und wurde ein Stück fortgeschleift. Dennoch schadete es ihr nicht, am 6. März 1475 um 2 Uhr nach Mitternacht brachte sie zu Caprese einen Knaben zur Welt, der den Namen Michelangelo erzielt. Er war das zweite Kind seiner Mutter, welche bei seiner Geburt neunzehn Jahre zählte, während Lodovico im einunddreißigsten stand. Lodovicos Vater lebte nicht mehr, wohl aber seine Mutter, Mona Lesandra (soviel als Madonna Allessandra), eine Frau von sechsundsechzig Jahren.
1476, nach Ablauf seiner Amtsführung, kehrte Lodovico nach Hause zurück. Der kleine Michelangelo wurde drei Miglien von Florenz in Settignano zurückgelassen, wo die Buonarroti eine Besitzung hatten. Man tat das Kind zu einer Amme, der Frau eines Steinmetzen. Settignano liegt mitten im Gebirge; Michelangelo pflegte später scherzend zu sagen, es sei kein Wunder, daß er solche Liebe zu seinem Handwerk hege, er habe es mit der Milch eingesogen. In dem Orte zeigte man im vorigen Jahrhundert noch die ersten Malereien des Knaben an den Wänden des Hauses, in dem er aufwuchs, wie im Erdgeschoß des elterlichen Hauses zu Florenz die Fortsetzung dieser Bestrebungen zu erblicken war. Er fing an zu zeichnen, sobald er seine Hände gebrauchen konnte.
Die Familie vermehrte sich. Die Geschwister Michelangelos sollten Kaufleute werden, die gewöhnliche und natürliche Laufbahn in Florenz, er selbst aber wurde zum Gelehrten bestimmt und von Meister Franceso aus Urbino, der die florentinische Jugend in der Grammatik unterrichtete, in die Schule genommen. Hier aber profitierte er nicht viel. Er verwandte alle seine Zeit auf das Zeichnen und trieb sich in den Werkstätten der Maler umher.
Auf diesen Wegen lernte er Francesco Granacci kennen, einen schönen talentvollen Knaben, der, fünf Jahre älter als er, sein innigster Freund wurde. Granacci war bei Domenico Ghirlandaio oder, florentinisch gesagt, Grillandaio in der Lehre. Michelangelo ließ sich nicht mehr bei seinen Studien halten, er hatte nur die Malerei im Kopfe. Sein Vater und dessen Brüder, stolze Männer, die den Unterschied der Kaufmannschaft und der Malerei, die als ein in ihren Augen wenig angesehenes Handwerk geringe Aussichten bot, wohl zu würdigen wußten, machten Vorstellungen, aus denen allmählich Schläge wurden. Michelangelo blieb standhaft. Am 1. April 1488 unterzeichnete Lodovico den Kontrakt, kraft dessen sein Sohn zu den Meistern Domenico und David Grillandaii auf drei Jahre in die Lehre gegeben ward. Während dieser Zeit sollte er Zeichnen und Malen lernen und übrigens tun, was ihm geheißen würde. Von Lehrgeld war keine Rede, im Gegenteil verpflichteten sich die Meister, ihm im ersten Jahre sechs, im zweiten acht, im dritten zehn Goldgulden zu bezahlen. Michelangelo war vierzehn Jahre alt, als er so zum ersten Male seinen Willen durchgesetzt hatte.
Seltsam ist zu bemerken, daß, wenn Michelangelo in früher Jugend so darauf bestand, als Malerlehrling einzutreten, der Hochmut, mit dem seine Familie die Sache aufnahm, in hohem Alter auch bei ihm zum Durchbruche kam. In seinen Briefen unterzeichnete er sich so lange er jung war mit »Michelangelo der Bildhauer«, später jedoch, als alter Mann, nahm er übel, wenn so auf seinen Briefen stand. Bei seinem Neffen beklagte er sich dann, daß von einem Florentiner so an ihn adressiert worden sei: nicht Michelagnolo der Bildhauer, sondern Michelangelo Buonarroti laute der Name, unter dem er in Rom bekannt sei. Niemals habe er als Maler oder Bildhauer offene Werkstatt gehalten, sondern immer die Ehre seines Vaters und seiner Brüder im Auge gehabt, und sogar wenn er Päpsten gegenüber sich zu Diensten verpflichtet, sei das nur deshalb geschehen, weil es zu vermeiden unmöglich gewesen.
Domenico Grillandaio stand als der Herr der Werkstatt obenan, in welche Michelangelo jetzt eintrat, und gehörte zu den besten Meistern der Stadt. Er hatte damals eine umfangreiche Arbeit übernommen. Der Chor der Kirche Santa Maria Novella sollte neu gemalt werden. Orcagna, der Erbauer der offenen Halle neben dem Palaste der Regierung, der sogenannten Loggia dei Lanzi, hatte diesen Chor in Giottos Manier ausgemalt. Das Dach war schadhaft geworden, der Regen an den Wänden herabgelaufen und die Malerei allmählich zugrunde gegangen. Die Familie Ricci, welcher als Inhaberin dieses Chores auch seine Instandhaltung zukam, zögerte mit der Restauration der großen Kosten wegen. Jede bedeutende Familie besaß auf diese Weise eine Kapelle in einer der städtischen Kirchen, in der sie die Ihrigen begrub und deren Ausschmückung eine Ehrensache war. Da nun die Ricci ihre Ansprüche nicht aufgaben und anderen die Reparatur der beschädigten Wände nicht zugestehen wollten, blieb die Sache eine Zeitlang beim alten; Orcagnas Gemälde gerieten in immer bedenklicheren Zustand. Endlich machten die Tornabuoni, eine der reichsten Familien der Stadt, den Vorschlag, wenn man ihnen die Erneuerung der Kapelle überließe, wollten sie nicht nur alle Kosten tragen, sondern sogar das Wappen der Ricci prachtvoll wiederherstellen. Hierauf gingen diese ein. Grillandaio ward die Arbeit in Akkord gegeben. Der Meister stellte seine Forderung auf 1200 schwere Goldgulden mit einer Extravergütung von 200, wenn die fertige Arbeit zur besonderen Zufriedenheit der Besteller ausgefallen wäre. Im Jahre 1485 war sie in Angriff genommen worden.
Die Kapelle ist ein viereckiger, gewölbter, nach dem Schiff der Kirche hin offener Raum, durch den zu ziemlicher Erhebung aufgebauten Hochaltar jedoch, hinter dem sie liegt, von ihr abgeschlossen. Die Rückwand ist von Fenstern durchbrochen, es handelte sich also bei der Malerei nur um die beiden Wände zur Rechten und Linken, wenn man eintritt. Diese, in übereinander liegende lange, streifenartige Teile abgeteilt, mußten von unten bis oben mit Kompositionen ausgefüllt werden. Es sind Darstellungen biblischer Begebenheiten. Das heißt, die Namen der einzelnen Gemälde lauten so, in Wirklichkeit aber erblicken wir Gruppierungen bekannter und unbekannter florentinischer Schönheiten, Berühmtheiten, Männer, Frauen und deren Kinder, wie es die Umstände erforderten, im Kostüme der Zeit und in einer Weise zusammengestellt, als sei das, was das Bild bedeutet, vor wenigen Tagen in Florenz auf der Straße oder in einem der bekanntesten Häuser vorgefallen. Diese Art, die heilige Schrift unhistorisch aufzufassen, finden wir überall, wo sich die Kunst naiv und kräftig entwickelt. Rembrandt läßt Maria in einem Stalle sitzen, der einen holländischen Kuhstall seiner Zeit darstellt, während Raffael ihr in altem römischem Gemäuer ein Unterkommen gibt, wie er täglich daran vorüberging.
Für Florenz ist bei solchen Gemälden Vasaris Werk nicht hoch genug anzuschlagen. Als er schrieb, wußte man noch in der Stadt, wer diese Personen wären. Wir sehen da die gesamten Tornabuoni vom ältesten Mitgliede der Familie bis zum jüngsten herab, wir finden die Medici und in ihrem Gefolge die gelehrten Freunde der Familie: Marsilio Ficino, den platonischen Philosophen, den der alte Cosimo erzogen hatte, Angelo Poliziano, der Dichter, Philolog und Erzieher von Lorenzo dei Medicis Kindern war, und andere berühmte Namen. Unter den Frauen, welche bei der Begegnung der Maria und Elisabeth das Gefolge bilden, die reizende Ginevra dei Benci, damals die schönste Frau in Florenz, dann am Wochenbette der heiligen Anna andere Florentinerinnen, welche der Wöchnerin ihren Besuch abstatten, alle im vollen Staate, eine darunter mit Früchten und Wein, den sie, wie es damals Sitte war, zum Geschenk bringt. Wieder auf einer anderen Darstellung hat Domenico sich selbst und seine Brüder abgemalt.
Der Familie Medici begegnet man so an vielen Orten. Auf einem Gemälde im Camposanto zu Pisa stellt der alte Cosmo (oder Chosimo, wie die Florentiner sprachen und schrieben) mit seiner Familie und wiederum dem gelehrten Gefolge den König Nimrod dar, welcher den Turm von Babel bauen läßt. Babylon sehen wir im Hintergrunde; es ist bis in die genauesten architektonischen Einzelheiten ausgeführt und aus Gebäuden Roms und der Stadt Florenz sehr künstlich zusammengesetzt.
So kam Michelangelo gleich mitten in eine große Arbeit hinein. Eines Tages, als der Meister fortgegangen war, zeichnete er das Gerüst mit alle dem, was dazu gehörte, und mit denen, welche darauf arbeiteten, so durchaus richtig ab, daß Domenico, als er das Blatt ansah, voller Verwunderung ausrief, der versteht mehr davon als ich selber. Bald zeigten sich seine Fortschritte als so bedeutend, daß die Verwunderung in Neid umschlug. Grillandaio wurde besorgt. Es ergriff ihn jene Eifersucht, die bei zu vielen ähnlichen Gelegenheiten herausgetreten ist, um nicht auch hier verständlich zu sein.
Michelangelo malte sein erstes Bild. Bei dem lebhaften Verkehr der Florentiner mit Deutschland war es natürlich, daß deutsche Bilder und Kupferstiche nach Italien kamen. Ein Blatt Martin Schongauers, die Versuchung des heiligen Antonius darstellend, wurde von Michelangelo in vergrößertem Maßstab kopiert und ausgemalt. Dieses Gemälde soll noch in der Galerie der Familie Bianconi zu Bologna vorhanden sein. Anderen Nachrichten zufolge befindet es sich im Besitz des Bildhauers Mr. de Triqueti zu Paris, ohne daß gesagt wird, wie es in dessen Hände gelangte. Das Blatt Schongauers ist bekannt. Als Komposition betrachtet jedenfalls seine bedeutendste Arbeit und mit einer Phantasie erfunden, welche die tollsten niederländischen Arbeiten ähnlicher Art erreicht. Eine Gesellschaft fratzenhafter Ungeheuer hat den heiligen Antonius in die Lüfte geführt. Man sieht nichts von der Erde als unten in der Ecke des Bildes ein Stückchen Felsgestein. Acht Teufel sind es, die den armen Einsiedler in die Mitte genommen haben und peinigen. Der eine reißt ihn am Haar, der zweite am Gewande vorn, der dritte packt das Buch, das in eine Tasche eingeknöpft an seinem Gürtel hängt, der vierte reißt ihm den Stock aus der Hand, der fünfte hilft dem vierten, die anderen kneifen und zerren, wo nur Platz ist, um sich anzukrallen, und dabei kugelt und dreht sich das wunderliche Gesindel in den unmöglichsten Windungen über ihm, an ihm und unter ihm. Das ganze Tierreich ist bestohlen, um die Gestalten zusammenzusetzen. Krallen, Schuppen, Hörner, Schwänze, Klauen – was irgend Tiere an sich haben können, haben diese acht Teufel an sich. Das Fischhafte aber herrscht vor, und um hier ja nicht die Natur zu verfehlen, studierte Michelangelo auf dem Fischmarkt die ausgelegte Ware eifrig. So brachte er ein ausgezeichnetes Bild zustande. Grillandaio nannte es jedoch ein aus seiner Werkstatt hervorgegangenes oder gab sich sogar selbst als den Verfertiger an, wozu er der damaligen Sitte nach berechtigt war. Grillandaio, überhaupt, fing an die Fortschritte Michelangelos bedenklich zu finden. Er verweigerte ihm sein Skizzenbuch, aus dem dies und jenes abzuzeichnen den Schülern sonst freistand. Nun aber wurde ihm von Michelangelo sogar ein Streich gespielt. Dieser hatte als Vorlegeblatt einen Kopf zum Kopieren erhalten, ein schon älteres, etwas vergilbtes Blatt, das er nach einiger Zeit dem Meister wieder zurückgab, der es ruhig in Empfang nahm, worauf dann unter Gelächter die Entdeckung nachfolgte, er habe sich anführen lassen. Michelangelo hatte den Kopf so täuschend kopiert und das Blatt etwas angeräuchert, daß Grillandaio die eigene Arbeit von der des Schülers nicht mehr unterscheiden konnte. Es war Zeit, daß dem Verhältnis ein Ende gemacht würde, und dies geschah noch vor Ablauf der drei Jahre des Kontraktes auf eine Weise, die für Michelangelo kaum günstiger gedacht werden konnte. Er wurde mit Lorenzo dei Medici, Cosmos Enkel, bekannt, der um diese Zeit in Florenz die Regierung in Händen hatte.
IV
Florenz bestand, als Staat betrachtet, aus einer Vereinigung von Handelshäusern, deren erstes das der Medici war. Die Stellung der übrigen ergibt sich danach von selbst. Die Regierung der Stadt lag in den Händen Cosmos, der stets den Anschein des interesselosen, zurückgezogenen Bürgers festhielt, sicherer, als wäre er ein Fürst mit dein Titel eines Herrschers von Florenz gewesen. Piero, sein Sohn, regierte nach ihm. Daß er es tat, war ebenso natürlich, als sich von selbst verstand, daß er das ererbte Geschäft fortsetzte. Körperlich und geistig eine schwächere Natur, mit dem Beinamen »der Gichtbrüchige«, blieb er trotzdem sein Leben lang an der Spitze des Staates, und nach seinem Abscheiden traten Lorenzo und Giuliano, seine Söhne, in dieselbe Stellung ein: der Wechsel des Hauptinhabers unterbrach die Geschäfte des Hauses nicht.
Nach innen blieben die Medici schlichte Kaufleute, nach außen nahmen sie einen anderen Ton an. Cosmo war einmal in die Verbannung geschickt worden. Er trat wie ein Fürst auf in Venedig, wohin er sich gewandt hatte; die Florentiner merkten bald, daß er Florenz mit fortgenommen hätte, und holten ihn zurück. Nun war er Diktator; aber nur in Dingen, die keine Staatsangelegenheit waren, griff er öffentlich ein. Er berief Gelehrte, erbaute Kirchen und Klöster, stiftete kostbare Bibliotheken, verpflichtete sich jedermann durch willige Darlehen. In politischen Dingen mußten seine Freunde auftreten. Man braucht nur sein Gesicht anzusehen, das in den zahlreichsten Abbildungen aus allen Lebensaltern auf uns gekommen ist. Hohe, in die feingerunzelte Stirn hinaufgezogene Augenbrauen, eine lange, mit der etwas volleren Spitze hinuntergedrückte Nase, ein Mund, dessen feine Lippen nachdenklich zusammengepreßt und beide scharf nach vorn vorgedrängt sind, ein energisches, festes Kinn, im ganzen ein Anblick, daß man die verkörperte Klugheit zu erblicken glaubt.
Piero, sein Nachfolger, beging Fehler, behauptete sich aber allen Angriffen entgegen, ein Beweis, daß die Partei der Medici stark genug war, um sich selbst unter einer minder ausgezeichneten Führung in der Herrschaft zu erhalten. Lorenzo dagegen trat in die Fußstapfen des Großvaters und erhöhte seine persönliche Stellung um ein beträchtliches. Die Kämpfe, in denen er sich emporschwang, waren heftig und gefahrvoll. Seinem Bruder Giuliano kosteten sie das Leben. Sie zeigen, welch ein Mut dazu gehörte, an der Spitze eines Staates wie Florenz zu stehen.
Der Tod Giulianos fällt ins Jahr 1478. Michelangelo war damals zwei Jahre alt und noch in Settignano; die Verschwörung der Pazzi, die mit diesem Morde zum Ausbruch kam, gehört also kaum zu dem, was er erlebte. Ihre Entstehung aber, die Katastrophe und der Verlauf sind echt florentinisch, und die Erzählung des Ereignisses ist notwendig, um ein Gefühl von der Stellung Lorenzos zu der Zeit zu geben, in der Michelangelo mit ihm in Berührung kam.
Schon Cosimo hatte den Einfluß der mächtigen Familie auf seine Weise abzuschwächen gesucht, indem er seine Enkeltochter Bianca, Lorenzos und Giulianos Schwester, mit Guglielmo, dem einzigen Haupterben der Pazzischen Reichtümer, vermählte. Auf diesem Wege hoffte er eine Verschmelzung der beiderseitigen Familieninteressen herbeizuführen. Allein die Pazzi hielten sich zurück und bewahrten ihre Selbständigkeit, so daß Lorenzo und Giuliano, nachdem sie Regenten von Florenz geworden waren, ernstlicher darauf bedacht sein mußten, der drohenden Rivalität ein Ende zu machen. Es gab einen Punkt, wo sie keine Rücksicht kannten: mit eifersüchtiger Wachsamkeit suchten sie zu verhüten, daß kein anderes Haus durch seine Reichtümer ebenbürtig neben ihnen emporkäme. Drohte die Macht einer Familie die Grenze zu überschreiten, so griffen sie ein und ließen es darauf ankommen, was daraus werden würde.
Lorenzo bewirkte, daß von der Regierung der Stadt eine Reihe die Pazzi demütigender Maßregeln ausging. Man pflegte die großen, sogenannten adligen Häuser gemeinhin mit Rücksichten zu behandeln, die zwar nicht verfassungsmäßiger Natur, dennoch hergebracht waren; diese versäumte man jetzt den Pazzi gegenüber. Es fielen böse Worte von seiten der Familie, die Medici erwarteten das nicht anders, standen auf ihrer Hut und beobachteten sie.
Nun aber geschah schreiendes Unrecht. Die Frau eines Pazzi will ihren verstorbenen Vater beerben. Ein Vetter hält einen Teil der Erbschaft widerrechtlich an sich. Es kam zum Prozeß, die Frau mußte gewinnen; da erscheint ein neues Gesetz, durch welches dem Vetter der Besitz bestätigt wird. Lorenzo hatte es dahin gebracht; er wollte, daß das Geld geteilt bliebe. Giuliano selbst machte ihm Vorstellungen wegen dieser Ungerechtigkeit, allein das höhere Interesse überwog; Lorenzo war jung, hitzig und mutvoll, er glaubte dem Sturme die Spitze bieten zu können.
Dieser blieb nicht aus. In Florenz hielten sich die Pazzi still, aber in Rom begannen sie Waffen zu schmieden. Sie hatten dort wie die Medici und andere florentinische Häuser eine Bank, und Francesco Pazzi, welcher das Geschäft leitete, stand mit den Riarii, der Familie des regierenden Papstes, im besten Vernehmen. Die Medici waren Sixtus dem Vierten verhaßt und mußten es entgelten, soweit es in seiner Macht stand. Er hatte eben anstelle des verstorbenen Erzbischofs von Pisa einen anderen ernannt, der den Medici feindlich gesinnt war und den sie jetzt in seine Stellung einzutreten verhinderten. Man kam in Rom überein, wenn der Papst Ruhe haben wollte, so müßten die Medici in Florenz vernichtet werden. Die Riarii und Francesco entwarfen den ersten Plan. Der Erzbischof von Pisa ward hinzugezogen, hierauf der alte Jacopo Pazzi, das Haupt der Familie in Florenz, dessen Bedenklichkeiten der Papst selber erst heben mußte. Der Oberbefehlshaber der päpstlichen Truppen, Giovanbatista da Montesecco, kam nach Florenz, um näher zu verabreden, wie, wo und wann die Brüder zu ermorden wären, ob einzeln oder zugleich an einer Stelle; hierauf disponierte er seine Armee in kleinen Abteilungen derart, daß die Stadt rings eingeschlossen war und die Truppen, auf ein Zeichen von allen Seiten einbrechend, sich rasch in Florenz zusammenfinden konnten. Der Cardinal Riario brachte die Verschworenen in die Mauern der Stadt, indem er sie, unter seine zahlreiche Dienerschaft gemischt, selber durch die Tore führte.
Der Besuch dieses mächtigen Mannes war ein Ereignis. Ein Fest wurde veranstaltet, zu dem man die beiden Medici einlud. Hier sollten sie abgetan werden. Allein kurz vorher läßt Giuliano absagen. Jetzt mußte auf der Stelle ein Entschluß gefaßt werden, denn der kürzeste Aufschub konnte bei der großen Zahl der Mitwisser und der pünktlichen Verabredung aller übrigen Maßregeln der guten Sache verderblich werden. Es wurde ausgemacht, der Kardinal solle am Morgen des nächsten Tages im Dome die Messe lesen, die Brüder würden aus Höflichkeit erscheinen müssen, es sei das die beste Gelegenheit, sie niederzustoßen. Giovanbatista Pazzi wollte Lorenzo, Francesco Pazzi Giuliano auf sein Teil nehmen.
Alles abgemacht, erklärt Giovanbatista plötzlich, er könne an heiliger Stätte den Mord nicht ausführen. Es werden statt seiner nun zwei andere angestellt, der eine davon ein Priester, der eine natürliche Tochter Jacopo Pazzis im Lateinischen unterrichtete. Dieses Zurücktreten Giovanbatistas war der Anfang des Mißlingens, sagt Machiavelli, denn wenn bei irgend etwas, bedarf es bei solchen Gelegenheiten mutiger Festigkeit. Die Erfahrung lehrt, sagt er weiter, daß selbst denen, die an Waffen und Blut gewöhnt sind, der Mut dennoch versagt, wenn es in dieser Weise auf Leben und Tod geht.
Zu dem Momente, in welchem die Verschworenen zustoßen sollten, war das Zeichen mit der Glocke gewählt, während die Messe gelesen wurde; in demselben Augenblicke sollte der Erzbischof von Pisa mit seinen Leuten den Palast der Signorie stürmen. So hätte man mit einem Schlage den Umsturz der Dinge bewirkt und die Gewalt in Händen.
Die Brüder ahnten dunkel, daß etwas gegen sie beabsichtigt würde, allein in diese Falle gingen sie arglos hinein. Lorenzo kam zuerst, Giuliano blieb aus; einer von den Pazzi lief, ihn zu holen, und Arm in Arm traten sie in Santa Maria del Fiore ein. Mitten im Gedränge des Volkes stehen die Verschwörer und erwarten das Geläute, während die Worte der Messe aus dem Munde des Kardinals durch das weite, dämmernde Gewölbe und über die schweigende Menge fliegen.
Da schlägt die Glocke an, und Giuliano empfängt den ersten Stich in die Brust. Er springt auf, taumelt einige Schritte vor und stürzt zu Boden. Wütend fällt Francesco Pazzi über ihn her und zerfleischt ihn mit dem Dolche so wahnsinnig Stich auf Stich, daß er seine eigenen Glieder von denen des Todfeindes nicht mehr unterscheidet und sich selbst eine gefährliche Wunde beibringt.
Währenddem aber hat Lorenzo besser Stand gehalten. Ihm fuhr der Dolchstich in den Hals, er wirft sich zurück und verteidigt sich. Die Verschwörer stutzen, seine Freunde kommen zu sich, umgeben ihn und retten ihn in die Sakristei, gegen deren Türe Francesco, der Giuliano endlich in seinem Blute liegen läßt, mit seinen Genossen anstürmt. Ein furchtbares Getümmel erfüllt die Kirche. Der Kardinal steht am Altare, seine Geistlichen umringen und beschützen ihn, weil sich die Wut des Volkes, das die Dinge nun zu begreifen begann, nun gegen ihn wandte.
Unterdessen war der Erzbischof von Pisa auf den Palast losmarschiert. Die Signoren, welche, so lange ihr Amt dauert, dort wohnen und ihn unter keiner Bedingung verlassen dürfen, saßen eben beim Frühstück. Die Überraschung war vollständig, aber ebenso augenblicklich die Fassung. Mit den bewaffneten Dienern des Palastes vereint, drängen sie die feindliche Mannschaft, die dem Erzbischof schon die Treppe hinauf folgte, wieder hinab, während die, welche schon oben waren, zu Boden geschlagen oder aus den Fenstern auf den Platz niedergestürzt werden. Einen von den Pazzis aber und den Erzbischof selber exekutierte man auf der Stelle. Man warf jedem eine Schlinge um den Hals, und im Nu hingen sie draußen hoch am Fenster zwischen Himmel und Erde, während die anderen mit zerbrochenen Gliedern unten auf dem Pflaster lagen. Noch aber steckten die Verschworenen im Erdgeschoß des Palastes, wo sie sich verrammelt hatten. Oben läuteten die Signoren Sturm, aus allen Straßenmündungen strömten bewaffnete Bürger auf den Platz.
Im Dome war die Sakristei nicht zu erzwingen. Die Türen von Metall, mit denen sie versehen waren, leisteten guten Widerstand. Die Anhänger der Medici strömten von außen zu, Francesco Pazzi ließ den Mut nicht sinken. Der Stich, den er sich selbst ins Bein gegeben hatte, war so tief, daß ihn seine Kräfte verließen. Noch versuchte er zu Pferde zu steigen, um, wie verabredet war, durch die Straße reitend, das Volk in Aufruhr zu bringen, aber er vermochte es nicht mehr. Elend schleppte er sich nach Hause und bat den alten Jacopo, für ihn den Ritt zu übernehmen. Noch ahnte er nicht, wie es im Palast der Regierung stände, auch mußte von außen der Zuzug bald erscheinen. Jacopo, alt und gebrechlich, erschien mit hundert bewaffneten Berittenen auf dem Platze; der aber war von bewaffneten Bürgern besetzt, von denen keiner ihn anhören wollte. Die beiden Leichen sah er oben am Fenster hängen. So zog er mit seinen Leuten aus der Stadt und wandte sich in die Romagna. Auch anderen gelang es, sich davonzumachen. Francesco lag auf seinem Lager und erwartete sein Schicksal.
Das ereilte ihn bald. Lorenzo war, von bewaffneten Bürgern geleitet, zu Hause angelangt, der Palast der Regierung gereinigt von den Verrätern, überall wurde der Name Medici gerufen, und die zerrissenen Glieder der Feinde trug das Volk auf Piken aufgespießt durch die Straßen. Der Palast der Pazzi war das Ziel der allgemeinen Wut. Sie schleppten Francesco zum Palaste der Regierung und hingen ihn neben die beiden anderen. Kein Laut entschlüpfte ihm unterwegs, auf keine Frage gab er Antwort, nur zu Zeiten seufzte er schwer auf. So wurde dieser abgetan und der Palast der Pazzi geplündert. Und dann, als die Rache vollbracht war, kein florentinischer Bürger, der nicht in Waffen oder in seinem besten Staate bei Lorenzo erschienen wäre, um sich ihm mit Gut und Blut zur Verfügung zu stellen. Nun kam auch der alte Jacopo in die Stadt zurück, den man verfolgt und im Gebirge aufgebracht hatte. Er sowohl als ein anderer Pazzi, der ruhig auf seiner Villa gesessen hatte, wurden innerhalb von vier Tagen verurteilt und gerichtet. Aber alles genügte der Wut des Volkes nicht. Sie rissen Jacopo aus der Familiengruft wieder heraus, legten ihm einen Strick um den Hals und schleiften den Leichnam zum Arno, in den er hineingeworfen wurde, wo der Fluß am tiefsten war.
Lorenzo war jetzt allein, aber er stand in anderer Weise als früher dem Volke gegenüber, man empfand in Florenz, wie völlig das Geschick der Stadt mit dem der Medici verwachsen sei. Die nun folgenden Kriege mit dem Papste und mit Neapel trugen dazu bei, Lorenzos neuer Stellung Dauer zu geben. Wenig fehlte an seinem Untergange. Was ihn rettete, war eins der genialsten Wagnisse. Ohne Garantie persönlicher Sicherheit begab er sich zu Schiff nach Neapel in die Hände seines Feindes. Sein Auftreten hier, seine Klugheit, besonders aber sein Geld ließen ihn Wunder wirken. Er ging wie ein verlorener Mann, der unbesonnen dem Verderben entgegenschreitet, er kam zurück im Triumph als ein Freund des Königs, der ihn bald auch mit dem Papst versöhnte. Dieser war der rasendste seiner Gegner. Daß der Mordversuch von ihm selbst unterstützt worden sei, bedachte er nicht. Er hatte nur den Schimpf, der ihm durch die Erhängung des Erzbischofs und durch die Vereitlung seiner Pläne zugefügt worden war, vor Augen. Bezeichnend aber für die Zeit ist auch die Erklärung der florentinischen Geistlichkeit, die in den schroffsten Worten öffentlich aussprach, sie verachte den Bannfluch, und der Papst sei ein Verschwörer wie alle anderen. Trotzdem löst sich auch das in Wohlwollen und verzeihende Freundschaft auf, und der Medici geht aus den Anschlägen, deren Opfer er sein sollte, als der angesehenste Fürst Italiens hervor.
Was Lorenzo vortrefflich verstand, war die Kunst sich populär zu machen. Zwar hatte er nun seit 78 eine Art Leibgarde im Palaste, dazu war seine Frau eine Orsini, die zu den stolzesten Adelsgeschlechtern Italiens gehörten und sich nicht geringer als Kaiser und Könige dünkten, dennoch ging er in der Stadt nicht anders als seine Mitbürger. Wo es eine öffentliche Festlichkeit gab, da hatte er sie entweder angerichtet oder den größten Teil daran. Er mischte sich ins Gedränge und war jedem zugänglich. Er dichtete den Mädchen die Lieder, die sie zu ihren Tänzen sangen auf öffentlichen Plätzen zur Feier des Frühlings im Monat Mai. Alle Kinder kannten ihn, wer es begehrte, dem kam er mit Rat und Tat zur Hilfe. Am hellsten aber glänzte er in den Augen der Jugend, wenn er seine prächtigen Karnevalsumzüge veranstaltete, zu denen er dann auch selbst wieder Gesänge schrieb. Er scheute keine Kosten bei solchen Gelegenheiten, und nur wenige, die es verschwiegen, wußten darum, daß er die Staatsgelder dabei in Anspruch nahm. Bis dahin hatten die Medici ihren Aufwand aus eigenem Vermögen bestritten, Lorenzo fing an, die Geschäfte der Firma zu beschränken und sich anderweitig Mittel zu verschaffen.
Bei Gelegenheit eines solchen Karnevalaufzuges hatte sich Francesco Granacci, der ein schöner, gewandter Jüngling war und bedeutendes Talent für dergleichen besaß, in Lorenzos Gunst eingeschmeichelt. Es wurde der Triumphzug des Paulus Aemilius dargestellt. Nachahmungen römischer Triumphe waren eine beliebte Form öffentlicher Umzüge. Granacci sollte bald Gelegenheit finden, dieses Wohlwollen für sich und Michelangelo zu benutzen. Er erhielt Zutritt in den Garten von San Marco, wo die Kunstschätze der Medici aufgestellt waren.
Lorenzo ließ hier eine Anzahl junger Leute, besonders solcher, die aus guter Familie stammten, in der Kunst unterrichten. Der alte Bildhauer Bertoldo, Donatellos Schüler, leitete die Übungen. Im Garten waren Skulpturwerke aufgestellt, in den dazu gehörigen Gebäuden hingen Bilder und Kartons der ersten florentinischen Meister. Was von außen her auf die Bildung angehenden Künstler einwirken konnte, war vorhanden, und auch die Talente zeigten sich bald, denen diese Gunst des Schicksals zugute kam. Durch Granacci wurde jetzt Michelangelo in den Garten von San Marco eingeführt.
V
Der Anblick der Statuen, die er hier aufgestellt fand, gab seinen Gedanken eine andere Richtung. Wie er früher um Ghirlandaios willen die Schule vernachlässigt hatte, so versäumte er jetzt um der Statuen willen die Werkstätte des Ghirlandaio. Lorenzo ließ damals in seinem Garten Marmorarbeiten zum Bau einer Bibliothek anfertigen, in welcher die von Cosmo begonnene Büchersammlung untergebracht werden sollte und deren Vollendung später Michelangelo selbst geleitet hat. Mit den Steinmetzen schloß dieser jetzt Freundschaft. Er erlangte ein Stück Marmor und die nötigen Werkzeuge von ihnen und begann die antike Maske eines Fauns, die sich als Zierat im Garten vorfand, aus freier Hand zu kopieren. Doch hielt er sich dabei nicht ganz an das Original und gab seinem Werk einen weit geöffneten Mund, daß man die Zähne darin erblickte.
Diese Arbeit kam Lorenzo zu Gesichte, der selber auf die Dinge ein Auge zu haben pflegte und die Arbeiter im Garten besuchte. Er lobte Michelangelo, bemerkte aber scherzend: »Du hast deinen Faun so alt gemacht und ihm dennoch alle Zähne im Munde gelassen; du solltest doch wissen, daß man die bei so hohen Jahren nicht mehr sämtlich beieinander hat.«
Als der Fürst das nächste Mal wiederkam, fand er eine Zahnlücke im Munde des Alten vor, die so geschickt hineingearbeitet war, daß es kein vollendeter Meister besser verstanden hätte. Jetzt nahm er die Sache ernsthafter und ließ durch Michelangelo seinem Vater sagen, er möge zu ihm kommen.
Lodovico Buonarroti wollte nicht erscheinen auf diese Bestellung. Schon die Sache mit der Malerei war ihm hart angekommen, daß sein Sohn jetzt aber sogar noch Steinmetz werden sollte, deuchte ihm zu viel. Francesco Granacci, der bereits das erste Mal geholfen hatte, trat auch diesmal beruhigend ein und brachte ihn dahin, sich wenigstens zu Lorenzo auf den Weg zu machen. Michelangelos Vater war eine gerade, ehrliche Natur, ein Mann, der am Althergebrachten festhielt, uomo religioso e buono e piuttosto d'antichi costumi che no, sagt Condivi. Das Außergewöhnliche mußte ihm erst mit Mühe plausibel gemacht werden, ehe er sein Mißtrauen dagegen aufgab; so lamentierte er nun, daß sie ihm seinen Sohn auf allerlei Irrwege brächten, und ging mit der Absicht in den Palast, sich auf nichts einzulassen.
Lorenzos Liebenswürdigkeit stimmte ihn jedoch bald anders und vermochte ihn zu Erklärungen, an die er zu Hause sicherlich nicht gedacht hatte. Nicht allein sein Sohn Michelangelo, sondern er selbst und alle die Seinigen ständen mit ihrem Leben und Vermögen Seiner Magnifizenz zu Diensten. Medici fragte nach seinen Umständen und was er betriebe. »Ich habe niemals ein Geschäft gehabt«, berichtete er, »sondern lebe von den geringen Einkünften der Besitzungen, die mir von meinen Vorfahren hinterlassen sind. Die suche ich im Stande zu halten und, soviel ich kann, zu verbessern.« »Gut«, antwortete Lorenzo, »sieh dich um, kann ich etwas für dich tun, so wende dich nur an mich; es soll geschehen, was immer in meinen Kräften steht.«
Die Sache war abgemacht. Lodovico meldete sich nach einiger Zeit mit der Bitte um einen erledigten Posten beim Zollwesen, der monatlich acht Scudi einbrachte. Lorenzo, der ganz andere Ansprüche erwartet hatte, soll ihm da lachend auf die Schulter geschlagen haben mit den Worten: »Du wirst dein Lebtag kein reicher Mann werden, Lodovico.« Er gab ihm die Stelle, Michelangelo hatte er zugleich zu sich in den Palast genommen, ließ ihm ein Zimmer anweisen und setzte ihm monatlich fünf Dukaten Taschengeld aus. Alle Tage wurde öffentlich gespeist bei den Medicis; Lorenzo saß oben an, wer zuerst da war, setzte sich neben ihn, ohne Rücksicht auf Rang und Reichtum. So kam es, daß Michelangelo öfter den Ehrenplatz vor den eigenen Söhnen des Hauses voraus hatte, die ihn aber alle liebten und freundlich ansahen.
Hierbei blieb Lorenzo nicht stehen. Er ließ Michelangelo öfter zu sich rufen, sah mit ihm die Steine, Münzen und andere Kostbarkeiten durch, von denen der Palast erfüllt war, und hörte sein Urteil. Oder Polizian unterredete sich mit ihm und führte ihn in die Kenntnis des Altertums ein. Auf seinen Rat arbeitete Michelangelo den Kampf des Zentauren und Lapithen, ein Werk, das jedermann in Staunen setzte. Es ist ein Basrelief und unvollendet. Offenbar ist eine der Szenen, welche antike Sarkophage bieten, zum Muster genommen worden. Michelangelo wollte es nie fortgeben und hatte noch im späten Alter seine Freude daran. Heute befindet es sich im Palaste der Familie Buonarroti, der Faunskopf in dem National-Museum zu Florenz.
Bertoldo dagegen lenkte Michelangelo auf Donatello hin und unterwies ihn im Erzguß. Michelangelo arbeitete eine Madonna in der Weise dieses Meisters, dessen Natur ihn ebenso anzog als seine Werke: ein Basrelief, welches gleichfalls heute noch im Hause Buonarroti steht. Er zeichnete ferner mit den anderen Zöglingen Bertoldos nach Masaccio in der Kapelle Brancacci, wo Filippino Lippi eben noch die letzten fehlenden Gemälde beendete. Granacci ist hier als ein nackter Knabe angebracht, Filippinos Porträt, das Botticellis, der sein Meister war, das Pollaiuolos und anderer berühmter oder stadtbekannter Männer Bildnisse finden sich da. Durch diese Art, sich selbst und seine Freunde auf den Bildern anzubringen, wurde die Persönlichkeit der Künstler ein Teil der Kunst, und das Gefühl, daß hier eine große sich immer erneuernde Gemeinde mit vollen Kräften fortarbeitete, befestigte sich in den Gemütern der Nachstrebenden.
Nichts wurde damals verschmäht, was die Sache selbst förderte. Jede Richtung entwickelte sich unbekümmert neben der anderen. Das Altertum und die neueste Zeit waren gleichmäßig geschätzte Vorbilder. Das sorgfältigste Studium der Natur lief neben her und ließ das Gefühl für das lebendige immer über den Trieb toter Nachahmung triumphieren, der in späteren Zeiten leider so völlig den Sieg davontrug. In diesen Studien, wie sie damals unter Lorenzos persönlichem Einfluß in Florenz betrieben wurden, haben wir das schönste Beispiel einer Kunstakademie vor uns, und vielleicht das einzige, das uns zu der Wahrnehmung berechtigt, es habe gute und reichliche Früchte getragen. Eine andere Art gedeihlicher Einwirkung von seiten eines Fürsten auf die Kunst gibt es überhaupt nicht, denn die Kunst wird immer erniedrigt werden, wenn Fürsten aus äußerlichen Rücksichten und nicht aus dem edelsten Bedürfnis ihrer eigenen Seele sie zu erheben versuchen. Lorenzos Beispiel zeigt, daß die aufgewandten Geldmittel die geringste der treibenden Kräfte waren, welche sich hier vereinigten. Es bedurfte dazu, daß Medici selbst so tief in die klassischen Studien eingeweiht war, daß er die Jünglinge mit eigenem Blicke auswählte, daß er an den Sammlungen, die er ihnen zu Gebote stellte, selber die größte Freude hatte. Er ernennt den Lehrer, er verfolgt die Fortschritte, er erkennt aus den ersten Versuchen des Anfängers die glänzende Zukunft. Er bot den jungen Leuten in seinem Palaste den Verkehr mit den ersten Geistern Italiens. Denn alles strömte nach Florenz, und das Haus der Medici war nicht nur der Platz, von dem aus die feinsten Fäden der Politik nach allen Seiten gesponnen wurden, sondern die religiöse Bewegung, die philosophischen Studien, die Poesie, die Philologie wandten sich dahin, um teilweise eine entscheidende Richtung zu erhalten. Was Großes in der Welt geschah, wurde dort gekannt, besprochen und gewürdigt. Das Mittelmäßige erstickte unter der Fülle des Vortrefflichen. Das Vortreffliche selbst wurde nicht nach äußeren Merkmalen blind in den Kauf genommen, sondern mit Verständnis geprüft, ehe man es bewunderte. Bewegtes, geselliges Leben mischte sich ununterbrochen mit den ernsten Arbeiten, und als heilsamer Gegensatz zu den Süßigkeiten dieses Daseins wirkte der scharfe kritische Verstand des florentinischen Publikums, das sich in Sachen höherer Kultur weder bestechen noch betrügen ließ.
Das war es, was man nur in Florenz antraf und was die Florentiner an ihre Stadt fesselte: daß sie einzig dort die wahrhaft fördernde Anerkennung ihres eigenen feinen Geistes fanden. Nirgends sagte man so böse Dinge, nirgends aber sprach man so schön. Mißhandelt sahen sich die Künstler oft, mit erbärmlicher Knauserei in ihrem Lohne verkürzt, mit beißenden Worten und Beinamen verfolgt, stets aber dennoch mit jener wahrhaftigen Gerechtigkeit bis in ihre außerordentlichsten Leistungen erkannt und abgeschätzt, um derentwillen man gern alles übrige darangibt. Was ist ein Künstler ohne ein Publikum, das er seiner würdig fühlt? Donatello sehnte sich aus Padua, wo man ihn mit Schmeicheleien überschüttete, in seine Vaterstadt zurück. In Florenz fände man freilich immer an seinen Werken zu tadeln, sagte er, aber man reize ihn auch zu erneuten Anstrengungen und zur Erwerbung höherer, ruhmvoller Vollkommenheit. Wer sich Ruhe gönnte in Florenz, trat in den Hintergrund. Diejenigen Künstler, denen der Gewinn des täglichen Brotes nicht der nächste Grund zur Arbeit war, wurden durch den Ehrgeiz weiter gespornt, die aber, denen es auf die Bezahlung ankam, mußten alle Kräfte anspannen, weil die Konkurrenz so groß war. In der Luft von Florenz, sagt Vasari, liegt ein ungeheurer Antrieb, nach Ruhm und Ehre zu streben. Keiner will mit den übrigen gleichstehen, jeder möchte höher hinaus. Man sagt sich, bist du nicht so gut wie jeder andere? Kannst du es nicht ebenso weit und weiter bringen? Wer in behaglicher Ausbeutung der Kunst, die er gelernt hat, fortexistieren will, darf nicht in Florenz bleiben. Florenz ist wie die Zeit, die die Dinge schafft und sie wieder zerstört, wenn sie sie zur Vollendung gebracht hat.
Ich glaube, wenn es irgendwo erlaubt ist, sich eine romantische Vorstellung von den Dingen zu machen, so dürfen wir es bei Betrachtung der florentinischen Geselligkeit jener Jahre. Die Künste, die bei uns doch immer ein feineres Gewürz des Lebens sind, ohne das man sich allenfalls behelfen könnte, bildeten dort ein so notwendiges Ingredienz, daß sie wie das unentbehrliche Salz zum Brote waren. Man dichtete nicht nur, man sang auch die Lieder, die man gedichtet, Tanzen, Reiten, Ballspiel waren alltägliche Genüsse, und ein Gespräch, bei dem man die Blüte der Sprache anzuwenden trachtete, erschien ebenso willkommen wie ein frisches Bad oder eine Mahlzeit. Was dieses Leben aber gerade für Michelangelo erhöht haben muß, ist eine Eigenheit der romanischen Völker, die den germanischen abgeht. Das unbeholfene Wesen, das die Jugend bei uns schweigsam oder unlustig macht, wenn sie mit dem Alter zusammentrifft, kennen die Italiener nicht. Junge Leute von fünfzehn, sechzehn oder siebzehn Jahren, die in Deutschland die Unbehaglichkeit nicht überwinden können, mit der sie sich zwischen Älteren und Jüngeren ohne eigentliche Stellung sehen, gehen in Italien frei von beengenden Gedanken umher und wissen sich Frauen, Männern und Kindern gegenüber zu benehmen.
So empfing Michelangelo in dem Alter, in dem der fügsame Geist des Menschen der tiefsten und fruchtbarsten Eindrücke fähig ist, eine Erziehung, die kaum in glücklichere Zeiten fallen konnte. Bald aber traten nun auch die Stürme ein, deren Spuren ebenso erkenntlich in seinem Charakter sind, als es jene ersten sonnigen Tage waren. Denn Lorenzos Ende stand näher bevor, als irgend jemand ahnte, und die Änderung der Dinge, die schon in den letzten Jahren seiner Regierung begonnen hatte, bildete sich in immer rascherem Verlaufe zu totalem Umsturze des Bestehenden aus.
Drittes Kapitel
1494-1496
I
Seit der Ermordung Giulianos war die alte frohe Stimmung, welche sonst am mediceischen Hofe herrschte, nicht zurückgekehrt. Die Feste von Carreggi waren vorüber, wo gedichtet, musiziert und im Schatten der Lorbeern Philosophie getrieben wurde, wo man sich der Gedanken an die Zukunft mit all der Sorglosigkeit entschlug, die zum jugendlich genialen Genusse des Lebens so notwendig ist. Und wie in den Medici eine Wandlung vorging, so in den Gemütern der Florentiner selbst. Einstweilen verdunkelten die Wolken die Sonne noch nicht, aber die Wolken zogen auf, das fühlte man.
Zwei Dinge verstanden sich von selbst, wenn die Lage des Staates in Betrachtung kam: erstens, je mehr Lorenzo in eine fürstliche Stellung durch die bloße Gestalt der Umstände hineingedrängt wurde, um so mehr mußte der ihm ebenbürtige Adel fürchten, in Abhängigkeit zu geraten, die Strozzi, Soderini, Capponi und eine ganze Reihe der mächtigsten Familien; zweitens: Lorenzo selbst, je mehr ihm Widerstand von dieser Seite als etwas Natürliches erschien, das sicher zu erwarten war, um so geschickter mußte er den Anschein zu wahren suchen, als habe er dergleichen ganz und gar nicht im Sinne, um so fester mußte er das gemeine Volk auf seiner Seite halten. Daher diese fortwährenden öffentlichen Lustbarkeiten, diese Leutseligkeit dabei. Es könnte fast darüber gestritten werden, ob es in seiner Absicht gelegen habe, sich zum absoluten Herrn der Stadt zu machen. Man weiß, wie er seinem Sohne eindringlich empfahl, niemals zu vergessen, daß er nichts als der erste Bürger der Stadt sei. Aber angenommen wirklich, Lorenzo habe die Gefahren erkannt, die eine äußerliche Erhöhung seiner Familie in den Fürstenstand mit sich brachte, und den Moment hinausschieben wollen, in dem es so weit kam, – daß es einmal so weit kommen mußte, war ihm und jedermann, der die Verhältnisse näher kannte, offenbar: die finanziellen Angelegenheiten zwangen die Medici, die Gelder des Staates zum Vorteil ihrer eigenen Pläne in Anspruch zu nehmen. Dies Bedürfnis machte sich in steigendem Maße geltend. Es mußte das zur Tyrannei führen.
Hier also drohte ein Zusammenstoß. Die Florentiner waren zu gute Kaufleute, um das Exempel nicht selbst zu stellen und zu Ende zu rechnen in Gedanken. Allein es waren doch nur erst Wege, die zur Gefahr führen konnten, es hätte erst der Männer bedurft, die den Kampf herbeizwangen und leiteten. Die tägliche Stimmung des Publikums litt unter diesen Möglichkeiten noch nicht. Dagegen erhob sich eine andere Macht in der Stadt, die gefährlicher und erschütternder wirken sollte, und hier war auch ein Mann vorhanden, der eine mächtige Natur mit sich brachte, um das ins Werk zu setzen, was in seinem Geiste als Gedanken zuerst entstanden war. Dieser Mann ist Girolamo Savonarola, sein Gedanke: totale Reform in politischer und sittlicher Beziehung zum Besten der Freiheit von Florenz, und diesen Mann begünstigten die Ereignisse.
Savonarola war aus Ferrara gebürtig. Er kam in demselben Jahre nach Florenz, in dem Michelangelo von Lorenzo in den Palast der Medici aufgenommen wurde. Er war siebenunddreißig Jahre alt und schon früher einmal kurze Zeit in der Stadt gewesen, allein seine Predigten hatten damals wenig Erfolg gehabt. Jetzt erschien er als gereifter Mann und begann auf der Stelle in dem Geiste aufzutreten, den er bis zu seinen letzten Schritten fest bewahrt hat. Seine Überzeugungen hat er als Kind gehegt und bis zu seinem Tode nicht ein einziges Mal verleugnet und aus dem Herzen verloren.
Man könnte diesen zartgebauten, einsamen, nur auf sich selbst beruhenden, wie aus eisernen Fäden gewebten Charakter eine fleischgewordene Idee nennen, denn der Wille, der ihn beseelte, vorwärts trieb und aufrecht hielt, ist so rein aus jeder seiner Handlungen zu erkennen, daß die Erscheinung der wunderbaren, aber einseitigen Kraft etwas Schauerliches an sich hat. Wir Menschen leben in einer gewissen Unklarheit, deren wir bedürftig sind, Dumpfheit nennt es Goethe bei sich selber; die vergehende Zeit beraubt uns um Gedanken, die kommende führt uns neue zu: wir vermögen jene weder zu halten, noch dieser uns zu erwehren. Wir gehen von einem zum anderen über; bald rechts, bald links getrieben in unserem Wege, glauben wir viel getan zu haben, wenn wir wenigstens zeitweise des Steuers uns bedienen durften, wenn wir im Ganzen gewahren, daß es nicht rückwärts geht; dieser Mann aber durchschneidet das neblige Meer des Lebens wie ein Schiff, das der Segel und der geistigen Winde entraten kann, das die Stürme nicht irren, in sich selbst die Kraft besitzend, die es vorwärts treibt, geradeaus und keinen Zoll von der Linie weichend, die es innehalten wollte von Anfang an. Dreiundzwanzig Jahre alt, flieht er nachts aus dem väterlichen Hause, um in ein Kloster einzutreten. Er läßt einen Brief zurück, aus dem die ruhige Überlegung eines Geistes redet, der völlig mit sich selber im reinen ist. Er belehrt seinen Vater mehr, als daß er sich entschuldigt. Er fordert ihn auf, seine Mutter zu trösten und für die Erziehung der Brüder zu sorgen.
Savonarolas leitende Idee war die Lehre vom Strafgerichte, das unverzüglich über das verderbte Italien hereinbrechen werde, um dann aber um so höhere Blüte des Vaterlandes eintreten zu lassen. Die Welt schien ihm der Katastrophe mit großen Schritten entgegenzueilen. Savonarola sah die heidnische Wirtschaft allüberall, den Papst und die Kardinäle tonangebend an der Spitze. Die Strafe dieser Greuel konnte nicht länger auf sich warten lassen, das Maß war voll. So dachte er. Und wohin er blickte, bestätigte das was geschah dies Gefühl, das in seinem Herzen nach Worten suchte.
Es ist wahr, der moralische Zustand des Landes erscheint unerträglich für unser Urteil. Die Verschwörung der Pazzi steht nicht etwa als ein besonderer Fall hervorragend da, sondern nach diesem Muster waren alle die Dinge geformt, die vorfielen. Kein bedeutender Mann damals, dessen Tod nicht zu dem Gerüchte einer Vergiftung Anlaß gab. Man lese die Geschichtsschreiber darauf hin, unwillkürlich wird immer diese Ursache als die erste und natürlichste vorausgesetzt, an die man denkt. Unehelichen Kindern, mochte die Mutter ein Mädchen oder eine Frau sein, klebte kein Makel an, kaum daß ein Unterschied zwischen ihnen und legitimen Abkommen gemacht wurde. Das ist eine der Beobachtungen, die Commines der Aufzeichnung wert hielt, als er sich über Italien aussprach. Betrug erwartete man überall, und nur der Betrüger ward verachtet, der sich selber überlisten ließ. Feigheit war nur dann ein Verbrechen, wenn sie, mit zu wenig Hinterlist gepaart, das Ziel verfehlte. Klug wurde der genannt, der auch der treuherzigsten Versicherung keinen Glauben schenkte.
Was wir in unserem Sinne Scham vor dem Urteil der öffentlichen Meinung nennen, gab es noch nicht. Ein Beispiel möge zeigen, wie man lebte und dachte. Filippo Lippi, der beste Schüler Masaccios, war ein Karmelitermönch, der wie viele andere Mönche die Malerei betrieb und selten Geld im Hause hatte. Seines unordentlichen Wandels wegen allgemein bekannt, erhält er nichtsdestoweniger den Auftrag, in einem Nonnenkloster die heilige Margherita an die Wand zu malen. Er bittet um ein Modell, die Nonnen geben dazu eine reizende Novize, Lucretia Buti mit Namen. Eines schönen Tages ist er fort mit ihr. Die Eltern des Mädchens schlagen Lärm; Lucretia wird aufgefunden, erklärt aber, daß sie unter keiner Bedingung Filippo verlassen werde. Nun macht der Papst Eugen selbst dem Künstler den Vorschlag, er wolle ihn seines Mönchsgelübdes entbinden, damit er Lucretia wenigstens heiraten könne. Davon aber will Filippo nichts hören, und dabei blieb es. Und dieser Filippo, der später von den Verwandten einer andern Frau, welcher er nachstellte, vergiftet wurde, ist ein Meister, der Madonnen mit dem Ausdrucke der zartesten Unschuld gemalt hat. Während er jedoch in seinen Werken die innerste, bessere Natur herauskehrte, nahmen andere Geistliche noch nicht einmal diese Rücksicht. Geweihte Priester, Bischöfe und Kardinäle dichten Verse und bekennen sich öffentlich als ihre Autoren, gegen deren Inhalt Ovids Amoren Kinderlieder sind. Und im Schoße der Familien pfropfen sich Verbrechen auf Verbrechen, die ebensowenig das Licht des Tages scheuen; die Lehren der Religion sind verspottet und erniedrigt, Astrologie und Wahrsagerei hergebrachte offizielle Einrichtungen, ohne deren Zustimmung die Päpste selber nicht zu handeln wagen, – man begreift wohl, wie da das Gefühl sich finden konnte, daß das Ende aller Dinge gekommen sei.
Savonarola aber wurde durch dies Gefühl, das mit ruheloser Macht in ihm arbeitete, nicht zur Verzweiflung an der Möglichkeit des Heils getrieben, sondern er wollte verkünden, was er drohend erblickte, um zu retten, was zu retten war. Mit diesem Vorsatze ging er fort aus dem Hause seines Vaters und suchte die Stelle zu gewinnen, von der aus seine Stimme gehört wurde in Italien. Er machte eine lange Lehrzeit durch, mit Entbehrungen und Entmutigungen angefüllt. Er bereitete sich durch strenge Studien zu seinem Amte vor. Zuerst predigte er so rauhtönend und ungeschickt, daß er oft dachte, er werde niemals predigen lernen. Endlich schlug die Stunde, in der er zu wirken begann. Lorenzo Medici selber betrieb seine Versetzung nach Florenz. Der Graf Pico von Mirandola, ein Mann, der von seinen Zeitgenossen als der Inbegriff männlicher Vollkommenheiten dargestellt wird, durch Schönheit, Ritterlichkeit, Adel, Reichtum und weit umfassende Gelehrsamkeit hervorragend, hatte Savonarola in Reggio kennen gelernt, wo ein Generalkonvent seines Ordens abgehalten wurde. Er machte Lorenzo auf ihn aufmerksam, und dieser, der alles Bedeutende nach Florenz zu ziehen suchte, bewirkte seine Berufung nach San Marco, das Lieblingskloster der Medici, das sie selber neu gebaut und mit einer kostbaren Bibliothek ausgestattet hatten.
Hier begann Savonarola jetzt zu predigen. Bald war die Kirche zu klein, und man zog in den Hof des Klosters; unter einem persischen Rosenbaume stehend, umdrängt von Zuhörern, die Wort für Wort von seinen Lippen fingen, sprach er mit erschütternder Gewißheit von den Dingen, die sein Herz erfüllten. Er prophezeite die Zukunft, aber es lag nichts Dunkles, Orakelmäßiges in seinem Wesen. Seine Phantasie war weder umfangreich, noch bot sie ihm farbige Bilder; er war eher eine nüchterne Natur, deren logisches Denken sich bis zur Verzückung steigerte. Einige Sätze drängte er der Welt gewaltig auf, alles andere leitete er mit schneidender Wissenschaftlichkeit von ihnen ab. Die Politik war sein eigentliches Feld, und mit seinen Ideen ging er stets auf sofortige praktische Anwendung los.
Zu Anfang enthielten seine Predigten nichts, das Lorenzo hätte bedenklich machen können. Die Reform der Kirche war eine anerkannte Notwendigkeit. Die Medici hatten sich bei all ihrer platonischen Philosophie nie dem öffentlichen Christentum abhold gezeigt, am wenigsten der Geistlichkeit, die zudem ebenso heidnisch wie sie selber dachte. Die Zeremonien der Kirche blieben stets ein Bedürfnis. Lorenzo hat neben den weltlichsten Poesien ein geistliches Drama und dergleichen Gesänge gedichtet. Mit echt philosophischer Gesinnung begünstigte er alles, was der Gunst bedürftig war. Daß diese Gegensätze sich so friedlich nebeneinander fanden, daran ist die Eigentümlichkeit der romanischen Natur schuld, die ohne Heuchelei sich den verschiedensten Strömungen zugleich hingeben kann, deren Vereinigung germanischer Anschauung weniger natürlich erscheint. Heidnische Schriftsteller wurden auf der Kanzel zitiert, als wenn sie fromme Kirchenväter gewesen wären. Selbst Savonarola, der in diesem Punkte die strengsten Ansichten hatte, war weit entfernt, die antiken Autoren zu verdammen und zu verbieten, sondern nannte nur einige der ärgsten Schriften, von denen er nicht wollte, daß man sie den Kindern in die Hände gebe.
Lorenzo begünstigte das Kloster, zu dessen Prior Savonarola bald gewählt wurde, so auffallend, daß Dankbarkeit und Hingebung natürlich gewesen wären. Allein Savonarola dachte nicht daran, die Dinge so zu fassen. Nicht Lorenzo, sondern die Vorsehung habe ihn nach Florenz geführt, ob er sich ihrem blinden Werkzeuge jetzt unterwürfig zeigen solle? Es fiel ihm nicht ein, als neu gewählter Prior im Palaste Medici den herkömmlichen Besuch zu machen. Gott habe ihm dies Amt gegeben, und keinem sterblichen Menschen brauche er dafür Dank zu sagen. Lorenzo ließ das hingehen, besuchte nach wie vor das Kloster und beschenkte es. Savonarola verwandte diese Spenden alsbald in auffallender Art zu wohltätigen Zwecken. Er wollte die alte Ordensregel, welche jeden Besitz verbot, in voller Strenge wieder einführen. In seinen Predigten spielte er auf diese Geschenke an. Wenn einem wachsamen Hunde ein Stück Fleisch zugeworfen werde, so beiße er wohl hinein und verstumme auf kurze Zeit, alsbald aber lasse er es dennoch wieder fallen und belle nur um so kräftiger gegen die Räuber und die Unterdrücker der Freiheit.
Lorenzo stand zu hoch, um gereizt zu werden. Es wäre gegen alles mediceische Herkommen gewesen, offen einzugreifen. Er veranlaßte einige der vornehmsten Männer in Florenz, dem Prior von San Marco ganz wie aus eigenem Antriebe ein anderes Auftreten anzuempfehlen. Warum er ohne Grund das Volk beunruhige? Er tue nichts, war Savonarolas Antwort, als im Namen Gottes Laster und Ungerechtigkeit anzugreifen. So sei es in den ersten Zeiten der Kirche Sitte gewesen. Er wisse wohl, woher die Herren kämen und wer sie gesandt hätte. »Aber sagt dem Herren Lorenzo dei Medici«, schloß er, »er möge in sich gehen, denn Gott werde ihn seiner Sünden wegen ins Gericht nehmen. Sagt ihm ferner, ich sei hier fremd und er ein Bürger der Stadt, ich aber würde bleiben und er davon gehen.«
Lorenzo nahm die Dinge wie ein Weltmann. Er ließ sich weder beleidigen, noch zu auffallenden Schritten hinreißen. Er versuchte es auf anderem Wege. Savonarola sollte mit seinen Prophezeiungen ad absurdum geführt werden. Unter den der Familie Medici anhänglichen Persönlichkeiten befand sich ein gelehrter Augustinermönch, Mariano, Platoniker und ausgezeichneter Kanzelredner. Dieser wurde ins Feuer geschickt. Er kündigte eine Predigt an über den Text: »Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit und Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat.« Was an Männern von geistiger Bedeutung in der Stadt war, fand sich bei ihm ein und billigte, nachdem er geendet, den vortrefflichen Vortrag.
Savonarola nahm den Kampf an. Er predigte über dasselbe Thema. Aber während Mariano den Akzent darauf gelegt, daß uns nicht zu wissen gebühre Zeit und Stunde, faßte Savonarola die Worte anders: zu wissen gebühre uns, aber die Zeit und Stunde zu wissen, gebühre uns nicht. Er begeisterte zu Tränen, die ihn hörten. Lorenzos eigene Partei zog er zu sich hinüber, den Grafen von Mirandola, Marsilio Ficino, der vor Platos Büste eine Lampe brennen hatte wie vor einem Heiligen, Polizian, den eingefleischten klassischen Gelehrten, alle fühlten sich mit fortgerissen. Wie vom Himmel stürzten die Ströme seiner Beredsamkeit. Es war kein Widerstand, wenn er sprach. Seine Worte wurden zu Befehlen. Sie wucherten unvertilgbar fort in den Gemütern. Es schien als sei es möglich, die Natur der Menschen umzuwandeln. Frauen erhoben sich plötzlich, legten ihre prachtvollen Gewänder ab und erschienen wieder in bescheidener Kleidung; Feinde versöhnten sich; unrechtmäßiger Gewinn wurde freiwillig zurückgegeben. In jenen Zeiten ereignete es sich, daß ein junges glückliches Ehepaar sich trennt und beide Teile ins Kloster gehen. Vivoli, der Savonarolas Predigten in der Kirche nachschrieb und sie drucken ließ, erzählt, wie er oft vor Weinen nicht habe weiterschreiben können. Und endlich sollte Lorenzo selbst sich der Macht dieses Geistes beugen oder wenigstens seines Trostes bedürftig sein.
Es war während der Fasten des Jahres 1492, daß dieser Sturm geistiger Aufregung Florenz erfaßte. Mit dem Osterfeste hatten die Predigten ihr Ende gefunden. Plötzlich erkrankte Lorenzo. Er war erst vierundvierzig Jahre alt. Auch hier ward von Gift gemunkelt. Die Krankheit war kurz. Er lag in Carreggi, seinem Landhause unweit der Stadt, er fühlte das Herannahen des Todes, nahm von seinen Freunden Abschied und kommunizierte voll demütiger Ergebung in die Verheißungen der Kirche.
Da zuletzt verlangte er nach Savonarola. Wir wissen nicht, was zwischen beiden vorging. Polizian, in dessen Briefen sich eine genaue Darstellung der letzten Momente findet, erzählt, daß sie versöhnt voneinander geschieden seien und daß Savonarola Lorenzo gesegnet habe. Andere aber behaupten, er hätte diesen Segen verweigert. Nachdem Lorenzo zweien seiner Forderungen zugestimmt: an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben und alles ungerecht genommene Gut zurückzuerstatten, habe Savonarola zuletzt verlangt, er solle der Stadt ihre Freiheit wiedergeben. Da wandte er schweigend sein Gesicht von ihm ab der Wand zu, und Savonarola verließ ihn.
II
Michelangelo befand sich unter den Dienern und Hausgenossen vielleicht, von denen erzählt wird, daß sie weinend um Lorenzos Lager standen in den letzten Augenblicken. So vernichtet war er von dem Verluste, daß es lange Zeit bedurfte, ehe er sich zur Arbeit sammeln konnte. Er verließ den Palast und richtete sich im Hause seines Vaters eine Werkstätte ein.
Piero, Lorenzos ältester Sohn, übernahm die Regierung. In ganz Italien aber wurde die Nachricht von dem Tode des großen Medici wie die Kunde eines Unglücks aufgenommen, das jeden einzelnen beträfe, und das Vorgefühl böser Zeiten wuchs an, mit dem man in die Zukunft schaute.
Lorenzo soll von sich gesagt haben, er habe drei Söhne, der erste sei gut, der zweite gescheit, der dritte ein Narr. Der Gute war Giuliano, dreizehnjährig, als sein Vater starb, der Gescheite Giovanni, siebzehn Jahre alt, aber schon Kardinal durch die Gunst des Papstes, dessen Sohn mit einer Tochter Lorenzos verheiratet war, der Narr war Piero. Über ihn sprach Lorenzo mit Besorgnis, wenn er gegen vertraute Freunde seine Meinung äußerte. Sein Auge blickte zu scharf, um die Eigenschaften des Sohnes nicht zu übersehen, dessen geringste Gabe die der Verstellung war.
Piero war jung, hochmütig und ritterlich, kein Medici seinem Geiste nach, sondern ein Orsini, wie Clarice, seine Mutter, und Alfonsina, seine Gemahlin. Es wäre dem Stolze dieser Frauen und ihrer herrschsüchtigen Natur unmöglich gewesen, Piero dei Medici für etwas anderes als den legitimen Fürsten von Florenz anzusehen, und er widerstrebte dem Einflusse nicht, den sie beide auf ihn ausübten. Die Theorie der indirekten Taten und des sich Drängenlassens war seinem ungeübten Geiste nicht geläufig. Voll kühner Wünsche, aufgewachsen im Überflusse wie ein Fürstenkind, dachte er nicht einmal daran, die Gedanken zu verheimlichen, die er hegte. Seine Hochzeit war in Neapel vom Könige gefeiert worden, als gelte es den reichsten Königssohn zu ehren. Auf der Hochzeit des jungen Sforza in Mailand, wohin sein Vater ihn gesandt, war er nicht anders aufgetreten; jetzt, da er die Macht in Händen und die drängenden Umstände und die gewaltigen Orsini hinter sich hatte, blieb nichts übrig, als sich zum Herzoge von Florenz aufzuwerfen.
Gelegenheit dazu zeigte sich alsbald. Mit Lorenzos Verscheiden verschwand die Gewalt, welche bis dahin Neapel und Mailand beruhigend auseinander gehalten und, nach allen Seiten hin in feinster Weise diplomatisch wirkend, den Bruch des Friedens in Italien hinausgeschoben hatte. Wir finden das Gleichnis gebraucht, Florenz mit Lorenzo habe wie ein Felsendamm zwischen zwei stürmischen Meeren gestanden.
Italien war zu jener Zeit ein freies Land und von fremder Politik unabhängig. Venedig mit seinem festgeschlossenen Adel an der Spitze, Neapel unter den Aragonesen, einer Nebenlinie der in Spanien herrschenden Familie, Mailand und Genua unter den Sforza, alles drei tüchtige Gewalten zu Wasser und zu Lande, hielten einander die Waage. Lorenzo beherrschte Mittelitalien; die kleinen Herren der Romagna standen sämtlich in seinem Solde und der Papst mit ihm im besten verwandtschaftlichen Einvernehmen. Aber in Mailand steckte das Unheil. Ludovico Sforza, der Vormund seines Neffen Gian Galeazzo, hatte die Gewalt völlig an sich gerissen. Sein Mündel ließ er geistig und körperlich verkommen, er ruinierte den jungen Fürsten langsam zu Tode. Aber dessen Gemahlin, eine neapolitanische Prinzessin, durchschaute den Verrat und drang in ihren Vater, die unerträgliche Lage mit Gewalt zu ändern. Sforza allein hätte Neapel nicht widerstehen können. Auf Venedigs Freundschaft war kein Verlaß für ihn, Lorenzo vermittelte, solange er lebte, jetzt, nach seinem Tode, war Neapel nicht mehr zurückzuhalten. Das erste was geschah, war die Verbindung Pieros mit dieser Macht und zugleich der Hilferuf Ludovico Sforzas nach Frankreich, wo ein junger, ruhmbegieriger König den Thron bestiegen hatte. Der Tod Innozenz des Achten und die Wahl Alexander Borgias zum Papste vollendeten die Verwirrung, die hereinbrach.
Lange diplomatische Feldzüge gingen voraus, ehe es wirklich zum Kriege kam. Es handelte sich nicht um die Interessen der Nationen, daran kein Gedanke, aber doch auch nicht um die Launen der Fürsten allein. Der hohe Adel Italiens war leidenschaftlich bei diesen Kämpfen beteiligt. Am französischen Hofe wurden die Schlachten der sich begegnenden Intrigen ausgefochten. Frankreich war von den Aragonesen um Neapel beraubt worden. Die vertriebenen französisch gesinnten neapolitanischen Barone, deren Besitzungen die Aragonesen ihren eigenen Anhängern gegeben hatten, ergriffen mit Feuer den Gedanken, siegreich in ihr Vaterland zurückzukehren; die den Borgias feindlichen Kardinäle, voran der Kardinal von San Piero in Vincula, ein Neffe des alten Sixtus, und der Kardinal Ascanio Sforza, Ludovicos Bruder, drängten zum Kriege gegen Alexander den Sechsten; die florentinischen Großen, die den Gewaltstreich Pieros voraussehen, hofften auf Befreiung durch die Franzosen und redeten zu in Lyon, wo das Hoflager sich befand und eine ganze Kolonie florentinischer Häuser sich mit der Zeit gebildet hatte. Sforza lockte mit dem Ruhme und den gerechten Ansprüchen auf das alte legitime Besitztum.
Die Aragonesen dagegen boten einen Vergleich an, Spanien, das seine Verwandten nicht im Stiche lassen wollte, stand ihnen zur Seite; der Papst und Piero dei Medici hielten zu Neapel, und der französische Adel war dem Zuge nach Italien nicht günstig. Venedig stand neutral, allein es konnte gewinnen beim Kriege und redete nicht ab, und diese Meinung, daß etwas zu gewinnen sei, bemächtigte sich allmählich aller Parteien, selbst derer, welche anfangs den Frieden zu erhalten wünschten.
Spanien gewann zuerst und unmittelbar: Frankreich trat dem Könige Ferdinand eine streitige Provinz ab unter der Bedingung, daß er seinen neapolitanischen Vetter ohne Unterstützung ließe. Sforza als Herr von Genua wollte Lucca und Pisa wieder haben nebst dem Übrigen, was dazu gehörte: die Visconti hatten es ehedem besessen, und er nahm es von neuem in Anspruch. Was Piero dei Medici hoffte, ist gesagt. Pisa hoffte frei zu werden. Der Papst hoffte durch seine Allianz mit Neapel den ersten Schritt zur Erreichung der großen Pläne zu tun, die er für sich und seine Söhne hegte; er dachte einmal ganz Italien unter sie zu verteilen. Die Franzosen hofften Neapel zu erobern und dann weiter in einem gewaltigen Kreuzzuge die Türken anzugreifen. Als für einen Kreuzzug machte der König im eigenen Lande die Anleihen, deren er für den Feldzug bedurfte. Die Venezianer hofften von den Küstenstädten des adriatischen Meeres soviel als möglich in ihre Gewalt zu bringen. Im Herbste 1494 stellte sich Karl von Frankreich an die Spitze seiner Ritter und Mietstruppen, mit denen er die Alpen überschritt, während die Flotte mit der Artillerie, der furchtbarsten Waffe der Franzosen, nach Genua unter Segel ging.
III
Während der zwei Jahre, in denen diese Dinge sich gestalteten, trieb Michelangelo, der noch nicht zwanzig Jahre alt, seine Kunst auf eigene Hand weiter. Er kaufte ein Stück Marmor und arbeitete daraus einen Herkules von vier Fuß Höhe. Diese Statue stand lange im Palaste Strozzi, wurde dann nach Frankreich verkauft und ist heute vielleicht in England.
Es wird ferner ein Kruzifix genannt, das er beinahe lebensgroß für die Kirche des Klosters San Spirito ausführte, eine Arbeit, die ihm von großem Nutzen war, denn der Prior des Klosters, dessen Zuneigung er gewann, verschaffte ihm Leichname zu anatomischen Studien. Es wird heute ein Kruzifix in San Spirito gezeigt und für Michelangelos Werk ausgegeben, aber mit Unrecht.
Sein Fortziehen aus dem Palaste der Medici hatte darum sein Verhältnis zu der Familie nicht aufgelöst. Eine Art abhängiger Stellung dauerte fort, Piero zählte ihn zu den Seinigen und zog ihn zu Rate, wenn Kunstsachen angekauft wurden. Ein Verkehr jedoch wie mit Lorenzo war nicht möglich. Schon die Jugend Pieros verhinderte das. Zwar hatte dieser eine gründliche wissenschaftliche Bildung erhalten, Latein und Griechisch waren ihm geläufig, mit natürlicher Beredsamkeit ausgestattet, liebenswürdig, gutmütig und herablassend wußte er, wenn er wollte, die Menschen für sich einzunehmen, am liebsten aber trieb er ritterliche Übungen und überließ es anderen, sich mit dem Detail der Regierung und der Politik statt seiner abzugeben. Er war ein schöner Mann, sein Wuchs überschritt das gewöhnliche Maß, er wollte der erste Reiter, der beste Ballschläger, der Sieger in den Turnieren sein. Er rühmte sich, einen Künstler wie Michelangelo zu besitzen, nicht weniger aber tat er sich zu gleicher Zeit auf einen Spanier zugute, der in seinem Marstall diente und als Läufer ein Pferd in gestrecktem Carrière überholte.
In der Nacht des 22. Januar 1494 schneite es so heftig in Florenz, daß der Schnee zwei bis drei Ellen hoch in den Straßen lag. Piero ließ Michelangelo holen und eine Statue von Schnee im Hofe des Palastes von ihm errichten. Man hat diesen Auftrag für eine Verspottung des Genies ansehen wollen; Michelangelo jedoch, darf nicht vergessen werden, war damals ein junger Anfänger, der noch nichts geleistet hatte. Sowenig die ersten Künstler der Stadt Bedenken trugen, an den vorübergehenden Einrichtungen für öffentliche Festlichkeiten mitzuarbeiten und Malereien und Skulpturen herzustellen, die nicht viel länger am Leben blieben als jene Schneestatue Michelangelos, sowenig konnte dieser daran denken, den Auftrag des ersten Mannes in Florenz als eine Kränkung seiner Ehre aufzufassen. Später hat Bandinelli durch eine liegende Schneestatue, die er als ein junger Mensch in Florenz aufführte, das erste Zeichen seines Talents für Bildhauerei gegeben. Michelangelos Arbeit in Schnee war es, welche Pieros Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße auf ihn hinlenkte. Er sollte wieder im Palaste wohnen, wo ihm sein altes Zimmer zurückgegeben wurde und wo er nun wieder, wie einst zu Lorenzos Zeiten, an der Tafel der Medici speiste. Der alte Lodovico Buonarroti, der seinen Sohn mit Stolz in der Gesellschaft großer Herren sah, ließ es an vornehmen Kleidern für Michelangelo jetzt nicht fehlen. Wer weiß, ob dieser nicht selbst teilgenommen damals an dem Feste, zu dessen Verherrlichung vielleicht seine Schneestatue dienen sollte. Denn Piero liebte ein rauschendes Leben, wie sein Vater getan; die gedrückte Stimmung, die sich langsam über die Stadt hinlagerte, konnte doch nur erst stoßweise Macht gewinnen in den Gemütern, und das alte Leben ging äußerlich die gewohnten Wege weiter. Nirgends aber war man zuversichtlicher als im Palaste der Medici. Dort wurden mit kindlicher Ruhe die Ereignisse erwartet, und selbst dann zweifelte man noch nicht am Gehorsame des guten Glückes, als die Stadt durch eine Nachricht erschüttert wurde, die dem Gefühl vom Hereinbrechen eines ungeheuren Wechsels der Dinge völlig die Oberhand verlieh: es gelangte die Kunde nach Florenz von der ersten Niederlage der Neapolitaner.
Neapel hatte die größten Anstrengungen gemacht, das Ausbrechen des Krieges zu verhindern. Nachdem es jedoch die Vergeblichkeit seiner Schritte erkannt, wollte es den Vorteil haben, angreifender Teil zu sein. Der Herzog von Kalabrien, Sohn des regierenden Königs, rückte mit der Armee durch die päpstlichen Staaten in die Romagna vor, Don Federigo, der Bruder des Königs, segelte mit der Flotte auf Genua los. Neapel stand im Rufe einer streitbaren, für den Krieg vortrefflich geschulten Macht. Federigo hoffte Genua zu nehmen und den französischen Schiffen die Spitze zu bieten. In Livorno, dem befestigten Hafen der Florentiner, war er angelaufen, von Piero festlich empfangen und mit Lebensmitteln versehen worden. Die Erwartung Toskanas folgte dem Laufe seiner Galeeren.
Bei Rapallo unweit Genua landete er dreitausend Mann. Gegen diese zieht die Besatzung der Stadt nebst tausend Schweizern, und die Neapolitaner werden aufs Haupt geschlagen. Federigo wagt keinen zweiten Angriff, sondern eilt mit der Flotte nach Livorno zurück. Ganz Italien durchzitterte nach diesem ersten Verluste das Gefühl, daß Widerstand vergeblich sei.
Dieser panische Schrecken war möglich in einem Lande, in dem der Frieden Generationen hindurch nicht gestört worden war. Not und Gefahr sind die Regulatoren der höheren Sittlichkeit. Der Mensch muß sich einmal im Leben auf seine eigensten Kräfte angewiesen fühlen, ein Volk von Zeit zu Zeit den Besitz der Freiheit neu verdienen, und der Wert des einfachen, edlen Mutes, auf dem der allgemeine Zustand der Dinge beruht, muß, wenn sich nicht alles verwirren und auflösen soll, öffentlich zutage treten. Vielleicht war nichts so sehr an den traurigen Verhältnissen schuld, gegen welche Savonarola sich auflehnte, als der jeder kriegerischen Zucht entwöhnte Geist des italienischen Volkes.
Freilich lesen wir innerhalb des fünfzehnten Jahrhunderts von Kriegen in Italien. Sie wurden von gemieteten Soldaten geführt. Und wie schlug man sich in den Schlachten? Hundert Mann von dreitausend waren bei Rapallo auf dem Platze geblieben, das brachte das Land zum Zittern. Diese Zahl erschien enorm, sagt Guicciardini. Heute würde es kaum der Rede wert erscheinen. Aber man lese, was Guicciardini oder Machiavell von der italienischen Kriegführung des fünfzehnten Jahrhunderts erzählen, wie lange Feldzüge gemacht werden, ohne daß sich ein ernstlicher Zusammenstoß ereignet, und wie man furchtbare Schlachten schlägt, in denen kein Tropfen Blut vergossen wird. Wir hören von den alten Mexikanern, daß sie mit hölzernen Waffen in die Schlacht gingen, um ihre Feinde ja nicht zu töten, weil ihnen hinterher die eingebrachten Gefangenen gut bezahlt wurden. Ähnliche Erwägungen waren damals in Italien maßgebend.
Nationale Truppen kamen nur in den seltensten Fällen ins Gefecht. Die Regel war, daß ein Fürst oder eine Stadt ihren Bedarf auf dem Wege der Miete zusammenschaffte. Man befaßte sich nicht selber unmittelbar damit, sondern überließ das Geschäft, die Bewaffnung und Auszahlung des Soldes miteinbegriffen, einem oder mehreren Unternehmern, mit welchen ein Kontrakt abgeschlossen wurde. Dies war das Handwerk des hohen und niederen italienischen Adels. Sie machten Geschäfte in Soldaten. Die größeren Herren verhandelten mit den kleineren, diese mit noch geringeren, und so bis zum einzelnen Manne herunter. Venedig, Florenz, Neapel, Mailand und der Papst hatten ihre Armeelieferanten, welche bestimmte Kriege übernahmen und in der akkordierten Zeit die Besiegung der Feinde auszuführen versprachen. Diese Armeen durften meistens weder die Städte betreten, für die sie kämpften, noch sogar diejenigen berühren, welche sie erobert hatten. Sie waren gemeine und verachtete Werkzeuge und die Soldaten der Mehrzahl nach Gesindel, das sich aus allen Ländern zusammenzog.
Unter diesen Umständen konnte nicht gut von Begeisterung für eine gute Sache die Rede sein, nicht einmal von Feindschaft gegen die, denen man gegenüberstand. Man schlug sich mit der äußersten Bequemlichkeit. Meistens war es schwerbewaffnete Reiterei, die zu Felde zog. Diese konnte der Pferde wegen nur dann ausrücken, wenn Futter im Lande vorhanden war. Winters also kein Krieg. Wenn es aber dann im Frühling so weit kam, daß man sich nah genug stand und ein passendes Schlachtfeld vorhanden war, zu welchem Zwecke sich dann töten? Dies hätte niemanden Nutzen gebracht, während sich die Entrepreneure der Feldzüge gegenseitig nur das Geschäft verdarben. Um sich deshalb keinen Schaden zu tun, dennoch aber tapfer drauf loszuschlagen, wozu man sich ja eidlich verpflichtet hatte, gestaltete man die Schlachten zu großen Turnieren um, machte soviel als möglich Gefangene, nahm ihnen Roß und Rüstung ab und ließ sie wieder laufen. Fanden sie zu Hause neue Equipierung, so war wenig verloren. Armeen, die völlig geschlagen und vernichtet waren, konnten auf diese Weise ein solch hartes Schicksal erdulden, ohne einen Toten zu haben, und nach kurzer Zeit vollzählig und unversehrt wieder auf dem Kampfplatz erscheinen, als sei nichts vorgefallen. Aber es gab ein noch einfacheres Mittel, dem Feinde Niederlagen zu bereiten. Man kaufte ihm seine ganze Armee vor der Nase weg und vereinte sie entweder mit der eigenen oder bewegte sie wenigstens zum Abzuge. Kam es zum Kampfe, so war von Taktik keine Rede, noch weniger von Artillerie; man drang von beiden Seiten auf einander ein und suchte das Feld zu behaupten. Und diese Methode Krieg zu führen war so hergebracht in Italien und erschien zugleich so einfach und logisch, daß eine andere kaum möglich war. Schon zu den Zeiten Dantes schlug man sich so. »Herren«, redet vor der Schlacht von Campaldino der Feldherr die Florentiner an, »in unsern Schlachten pflegt ein guter Angriff den Sieg zu entscheiden; der Kampf ist kurz, wenige verlieren das Leben; es ist nicht gebräuchlich, sich totzuschlagen. Heute wollen wir es anders anfangen!« Aber die alte Sitte blieb. Welcher Schrecken, als man jetzt bei Rapallo einer Nation begegnete, die wirklich totschlug, was ihr nicht weichen wollte. Die Franzosen föchten wie die lebendigen Teufel, hieß es. Ebenso neu und erschreckend erschien die Art der Schweizer, die als französische Mietstruppen in geschlossenen Bataillonen standen wie bewegliche Mauern. Das furchtbarste aber war die französische Artillerie. Zum ersten Male sah man in Italien Kanonen anders als zum Festungskriege oder zum bloßen Staate angewandt. Statt der Steinkugeln, die früher aus ungeheuren eisernen Röhren geschleudert wurden, flogen jetzt eiserne Bälle aus bronzenen Geschützen, welche nicht auf von Ochsen gezogenen Fuhrwerken mühselig nachgeschleppt wurden, sondern mit Pferden bespannt und von einer wohleingeübten Mannschaft bedient, dem Heere gleichen Schrittes folgten. Mit verderblicher Genauigkeit schossen sie, ein Schuß folgte dem andern fast ohne Zwischenraum, und was sonst an langen Tagen geschah, war für sie in wenig Stunden zu erreichen.
Kaum war in Florenz die Niederlage bei Rapallo ruchbar geworden, als die Nachricht eintraf, daß Karl in der Lombardei stehe, daß ein Teil des französischen Heeres gegen die Romagna vorgegangen sei und sich der Herzog von Kalabrien zurückziehe. Piero hatte keine Armee in Toskana. Die Franzosen rückten darauf los. Karl hätte durch die Romagna gehen können, doch er erklärte, jede Abweichung vom geraden Wege nach Rom und Neapel widerspreche seiner königlichen Würde. Eine unheilerwartende Stimmung ergriff die Gemüter. Für Michelangelo aber trat zu den allgemeinen Ursachen der Besorgnis ein seltsames persönliches Erlebnis hinzu, dessen Einfluß ihn völlig überwältigte.
Piero hatte einen gewissen Cardiere bei sich, einen ausgezeichneten Lautenschläger und Improvisator. Piero selbst galt für einen Meister in dieser Kunst und pflegte sich jeden Abend nach beendigter Tafel darin zu üben. Dieser Cardiere kommt eines Morgens im Hofe des Palastes auf Michelangelo zu, bleich und verstört, zieht ihn beiseite und eröffnet ihm, Lorenzo sei ihm in vergangener Nacht erschienen, in schwarzen zerrissenen Kleidern, daß das nackte Fleisch durchgesehen hätte, und habe ihm befohlen, seinem Sohne Piero zu sagen, er werde in kurzer Zeit aus seinem Hause vertrieben werden, um niemals wieder zurückzukehren! Was Michelangelo meine, daß er tun solle?
Dieser gab ihm den Rat, dem Befehle zu gehorchen. Einige Tage darauf kommt Cardiere zu ihm, außer sich vor Erregung. Er habe nicht gewagt, den Herrn anzusprechen, nun aber sei ihm Lorenzo zum zweiten Male erschienen, habe das Gesagte wiederholt und ihm zu dessen Bekräftigung und zur Strafe des Ungehorsams einen Schlag ins Gesicht gegeben.
Jetzt redet ihm Michelangelo so dringend ins Gewissen, daß Cardiere auf der Stelle alles zu sagen beschließt. Piero war gar nicht in der Stadt, sondern in Carreggi. Cardiere macht sich dahin auf. Nachdem er eine Strecke gelaufen, kommt Medici mit seinem Gefolge entgegengeritten. Der unglückliche Dichter und Lautenschläger fällt ihm in die Zügel und bittet um Gotteswillen Halt zu machen und ihn anzuhören. Hierauf trägt er seine Sache vor. Piero lacht ihn aus und die übrige Gesellschaft desgleichen. Sein Kanzler Bibbiena, dessen Regierung ihn besonders verhaßt gemacht hatte (der spätere Kardinal, den Raffael gemalt hat, und dessen Nichte Maria er heiraten sollte), ruft Cardiere die höhnischen Worte zu: »Narr, glaubst du, Lorenzo gebe dir so viel Ehre vor seinem eigenen Sohne voraus und werde nicht ihm selber erscheinen statt dir, um so wichtige Dinge mitzuteilen, wenn sie wahr wären?« Damit lassen sie ihn stehen und reiten weiter, Cardiere kommt dann auch wieder im Palaste an, und indem er sich bei Michelangelo über sein Schicksal beklagt, erzählt er ihm noch einmal seine Vision in der lebendigsten Beschreibung.
Michelangelo erregte die Verblendung der Medici ebensosehr als der Inhalt der Erscheinung. Der Untergang der Familie erschien ihm unvermeidlich, eine plötzliche Furcht befiel ihn. Der Glaube an übernatürliche Winke der Vorsehung, der den Florentinern von Natur im Blute lag, steigerte sich im höchsten Maße durch die letzten Ereignisse. Was man jetzt erlebte, war die Erfüllung der Dinge, die Savonarola gepredigt hatte. Und dies erst der Anfang! Schrecklicheres hatte er vorausgesagt, dessen Eintreffen erwartet wurde. Und der Himmel deutete nicht allein durch seinen Mund die verhängnisvolle Zukunft an. Zeichen unzweifelhaften Inhalts kamen dazu, heilige Bilder und Statuen schwitzten Blut aus, in Apulien erblickte man nachts drei Sonnen zugleich am Himmel, in Arezzo sah man Tag für Tag Bewaffnete auf ungeheuren Rossen in der Luft sich bekämpfen und unter furchtbarem Getöse dahinziehen. Das Volk glaubte an diese Erscheinungen mit derselben Zuversicht, wie es tausend Jahre früher getan. Wie wir bei Sueton die Blitzschläge finden, die Cäsars Tod voraus verkündeten, so lesen wir in den florentinischen Autoren, wie dicht vor Lorenzo Medicis Tode aus heiterem Himmel ein betäubender Schlag herabfuhr und die Spitze von Santa Maria del Fiore zerschmetterte, wie die Löwen, welche öffentlich von der Stadt gehalten wurden, sich anfielen untereinander und zerfleischten, wie ein helleuchtender Stern über Carreggi stand, dessen Licht schwächer und schwächer ward, bis es im Momente verlöschte, in dem Lorenzos Seele entfloh.
Rechnet man dazu den Tod Polizians, der um diese Zeit in halbem Wahnsinn endete, während Marsilio Ficino Savonarolas Lehre ergeben war, sehen wir alle Welt unter dem Einflusse der übernatürlichen Furcht, welche die Gemüter bedrängte, und nur Piero mit wenigen Anhängern im Gegensatz zur allgemeinen Stimmung, so begreift sich, wie ein junger Mensch, der unabhängig genug ist, um als freier Florentiner keinen Herrn über sich anzuerkennen, sich von der Familie abwendet, die ihrem Geschick verfallen schien, und, um nicht in den großen Untergang mit hineingerissen zu werden oder für eine Sache kämpfen zu müssen, die er nicht als die gerechte anerkennt, endlich durch dies Zeichen besonderer Art zum Entschluß getrieben wird, in der Flucht sein Heil zu suchen. Zwei Tage schwankt er, ob er bleiben solle, am dritten verläßt er mit zwei Freunden die Stadt und flüchtet nach Venedig.
IV
Wären sie auf guten Pferden gerade durchgeritten, so hätte die Reise eine Woche in Anspruch genommen. Allein die Franzosen standen in der Romagna. Es mag also längere Zeit darauf hingegangen sein. Desto kürzer mußten sie sich in Venedig selbst fassen, nachdem sie es endlich erreicht. Michelangelo war der einzige, der Geld hatte, sehr bald ging seine Barschaft auf die Neige, und die Gesellschaft faßte den Entschluß, nach Florenz zurückzukehren.
So gelangten sie wieder bis Bologna, wo die Bentivogli die herrschende Familie waren. Diese hatten sich erst seit kurzer Zeit zu entscheidender Übermacht emporgeschwungen und wußten sich oben zu halten. Die ihnen feindlich gesinnten Häuser wurden durch Verbannungen oder auch Morde unschädlich gemacht, die Bürger durch strenge Gesetze und Abgaben im Zaume gehalten. Unter diesen Gesetzen befand sich eines, das in seltsamer Manier zur Ausführung kam: jeder Fremde mußte sich bei seinem Eintritte am Tore melden und erhielt als Legitimation ein Siegel von rotem Wachs auf den Daumen geklebt; wer es unterließ, verfiel in eine bedeutende Geldstrafe. Michelangelo und seine Freunde kamen wohlgemut, aber ohne Siegel auf den Daumen, in die Stadt, wurden gefaßt, vor Gericht geführt, zu fünfzig Lire Strafe verurteilt, und, da sie soviel nicht aufzubringen vermochten, einstweilen festgehalten.
Zufällig kamen sie in dieser bedrängten Lage einem der ersten Männer in Bologna zu Gesichte, einem Messer Gianfrancesco Aldovrandi, Mitgliede des großen Rates und Haupte einer angesehenen Familie. Dieser ließ sich den Fall vortragen, machte Michelangelo frei und lud ihn, als er gehört, daß er ein Bildhauer sei, zu sich in sein Haus ein. Michelangelo jedoch lehnte die Ehre ab. Er stehe nicht allein und könne seine Freunde nicht verlassen, welche auf ihn angewiesen seien; mit ihnen zusammen, zu dreien aber, wollten sie dem Herrn nicht beschwerlich fallen. »Oh«, rief Aldovrandi, »wenn die Dinge so stehen, da möcht' ich bitten, mich doch gleichfalls mitzunehmen und auf deine Kosten in der Welt herum spazierenzufahren.« Dieser Scherz ließ Michelangelo zu praktischeren Ansichten kommen. Er gab seinen Reisegenossen den Rest seines Geldes, nahm Abschied von ihnen und folgte seinem neuen Beschützer. Und dies war das Vernünftigste, was er hatte tun können, denn kaum waren einige Tage vergangen, so kamen die Medici, Piero und seine Brüder und was von Anhängern ihnen sonst gefolgt war, auf der Flucht in Bologna an, denn in Florenz war die Prophezeiung Lorenzos in Erfüllung gegangen.
Um dieselbe Zeit, wo Michelangelo sich nach Venedig fortgemacht, hatten die Franzosen die Toskana betreten. Der König, welcher wohl wußte, wie französisch gesinnt die Bürgerschaft war, wollte das Äußerste versuchen, ehe er als Feind aufträte. Er hatte noch einmal Durchzug verlangt, Piero ihn wiederum verweigert. Dies war eine Herausforderung. Ein Teil der Armee kam von Genua her das Meeresufer entlang, die Hauptmacht mit dem Könige marschierte von Pavia südlich auf die Apenninen los und überschritt sie da, wo auf dem schmalen Küstenlande genuesisches und florentinisches Gebiet aneinanderstießen.
Hier lagen eine Anzahl befestigter Plätze, die Lorenzo noch erworben hatte, und die jetzt, von Pieros Leuten besetzt, wenn sie Widerstand leisteten, ganz Toskana verschlossen halten konnten. Die Gegend war sumpfig, kalt und ungesund. Lebensmittel mußten von weitweg auf Schiffen herbeigeführt werden. Die Truppen des Königs bestanden größtenteils aus gemietetem, zu Meuterei geneigtem Volke, unter dem es bereits zu gewaltsamen Unruhen gekommen war; ein Aufenthalt an dieser Stelle wäre den Franzosen verderblicher als eine verlorene Schlacht gewesen.
Pieros Lage war also nicht allzu verzweifelt. Er hatte die Orsini mit einigen Leuten im Lande, um den bedrohten Festungen Entsatz zuzuführen. Gegen Obigni, der aus der Romangna heranzog, schützten ihn wohl zu verteidigende Gebirgspässe. Er hätte den Mut nicht zu verlieren brauchen.
Aber er war nicht Herr seiner Stadt. Florenz merkte immer mehr, daß der König nur gegen die Medici und nicht gegen die Bürger Krieg führe. Karl hatte von Anfang an, als Piero sich gegen ihn erklärte, die Florentiner Kaufleute in Lyon unbelästigt gelassen, nur die Medici zwang er, ihre Bank zu schließen. Es ist gesagt, wie die vornehmen Florentiner in Frankreich selbst zum Kriege drängten. Man erwartete Karl wie einen Befreier. Schon im Jahre 93 hatte Savonarola, aufgefordert von der Regierung, ein Gutachten über die beste Form einer Regierung für die Stadt abgegeben und darin mit schneidender Schärfe die Gelüste Pieros dargestellt, wenn er auch, statt den Namen zu nennen, nur im allgemeinen einen Fürsten beschrieb, wie er etwa herrschen würde und herrschen müßte, wenn er sich zum Tyrannen einer freien Stadt aufwürfe. Es ist eine brillante Schrift, die, mit kaltem, staatsmännischen Blicke, aber auch mit der leidenschaftlichen Energie der Partei abgefaßt, ebensosehr die augenblickliche Lage charakterisiert, wie zwanzig Jahre später Machiavellis Buch vom Fürsten ein Bild der so völlig veränderten Zustände gewährt.
Savonarolas Macht wuchs zusehends in jenen Tagen. Politik und Theologie waren eins für ihn. Er drängte sich nicht mehr auf, als man ihn suchte. Der Haß gegen die Medici ging immer unverhüllter einher. Piero mußte einen äußersten Entschluß fassen, wenn er sich halten wollte.
Der Herzog von Montpensier mit dem Vortrabe der königlichen Armee war zuerst diesseits der Apenninen angekommen und vereinigte sich mit den von Genua heranziehenden Truppen. Er bombardierte Fivizzano, den ersten jener kleinen florentinischen Plätze, schoß Bresche, stürmte und ließ die Besatzung und die Einwohner bis auf den letzten Mann zusammenhauen.
Immer war noch nichts verloren und Toskana unter dem Schurze der übrigen Festungen so sicher wie früher, allein die Nachricht von den Greueltaten der Franzosen versetzte Florenz in Gärung. Piero faßte zum ersten Male seine Lage ins Auge, wie sie war. Er sah sich verlassen und verraten. Es fehlte ihm an Geld; er wollte borgen, aber seine besten Freunde machten Schwierigkeiten und zeigten sich unerbittlich. Von Neapel war keine Hilfe zu erwarten, auf Alexander Borgia kein Verlaß, in Pisa regten mailändische Agenten das Volk zur Empörung auf, denn Sforza wollte die ganze Küste Toscanas, Lucca, Livorno und Pisa in seine Gewalt bringen; er war es, der den König am meisten auf Toskana losgehetzt hatte. In Pisa befand man sich auf nichts vorbereitet, Piero ließ in aller Eile die Zitadelle wenigstens mit Munition versehen; aber was in Florenz selber beginnen, das keine andere Besatzung hatte als seine eigenen bewaffneten Bürger, und wo die Empörung ihr Haupt erhob? Piero tat in dieser Lage einen Schritt, der, wenn er besseren Erfolg gehabt hätte, als die Tat eines entschlossenen Mannes gelten müßte, welcher im Gefühl seiner Lage das letzte Rettungsmittel anzuwenden wagt, der aber, da er leider zum Unheil ausschlug, anders beurteilt worden ist: er gab sich unbesiegt dem König in die Hände.
Wäre er nach Neapel oder Venedig geflüchtet, den einzigen Orten, die ihm offen standen, so hätten die Florentiner alsbald mit Karl dem Achten Frieden gemacht, ihm die alte Würde des Beschützers der florentinischen Freiheit neu übertragen und ein Bündnis geschlossen, das die Medici für immer der Herrschaft beraubte. Viel besser, dem Könige zu Füßen zu legen, was man noch besaß, und vielleicht als Preis von ihm zu verlangen, was Neapel nun nicht mehr verschaffen konnte.
Piero wollte als Herzog von Florenz in die Stadt zurückkehren, als er die Führung einer Gesandtschaft übernahm, die im Namen der Regierung mit dem Könige unterhandeln sollte. Unterwegs hörten sie, wie Paolo Orsini vergebens den Versuch gemacht, sich mit dreihundert Mann nach Sarzana zu werfen. In Pietrasanta ließ Piero seine Begleiter zurück und verfügte sich unter französischer Bedeckung allein ins Hauptquartier nach Pontremoli.
Das Erscheinen des großen Lombarden, unter welchem Namen Piero nach seines Vaters Vorgang in Frankreich bekannt war, wo alle Italiener für Lombarden galten, erregte Erstaunen im Lager. Noch größeres die schmählichen Anerbietungen, die er machte. Das von seinem Vater erst erworbene und mit ungeheuren Kosten befestigte Sarzana, das Montpensier vergeblich berannte, die anderen Festungen, Livorno und Pisa dazu, wollte er freiwillig überliefern. Florenz sollte sich mit Karl verbünden, unter seine Obhut treten und 200 000 Dukaten zur Fortführung des Krieges leihen.
Auf diese Bedingungen hin wurde Piero zu Gnaden angenommen; was er für sich selbst verlangte und wohl zugestanden erhielt, zeigte sein Auftreten in Florenz, wohin er sich jetzt zurückzukehren anschickte, und zwar in Begleitung seiner Truppen, deren er gegen die Franzosen nicht mehr bedurfte. Allein vor ihm war die Gesandtschaft dort wieder eingetroffen, an deren Spitze er ausgezogen war, und hatte berichtet, was geschehen war. Pieros eigenmächtiges Verfahren, das in seinem völligen Umfange nicht einmal bekannt sein konnte, erregte eine Indignation, von der jetzt auch die treuesten Anhänger der Medici mit fortgerissen wurden. Dennoch hielt man sich ihm gegenüber in den Grenzen. Eine zweite Gesandtschaft wurde sogleich ernannt und Piero abwesend zu ihrem Mitgliede gewählt. Fünf Männer, darunter Savonarola. Er war es, der in Lucca, wo sie den König bereits antrafen, das Wort führte. Er sprach von der Freiheit und Schuldlosigkeit des florentinischen Volkes und verlangte bestimmte Zusicherungen. Karl gab ausweichende Antwort. Savonarolas Ruf war längst nach Frankreich gedrungen, und der König scheute den Mann, verehrte ihn vielleicht, aber er hatte sich mit Piero zu tief eingelassen. Dieser, der sich noch bei ihm befand, sobald er die Fünfe erscheinen sah, wußte, wie die Dinge in Florenz standen. Unter dem Vorwande, vorauszueilen und den Empfang des Königs in Pisa vorzubereiten, beurlaubte er sich und eilte nach Florenz. Paolo Orsini trieb zusammen, was von Soldaten im Moment aufzubringen war, und folgte ihm.
Am 8. November abends war Piero zurück in der Stadt, am 9. morgens erschien er vor dem Palast der Regierung. Er wollte eintreten, die große Glocke läuten, das Parlament berufen und die Verfassung stürzen. Einer der angesehensten Bürger, Luca Corsini, trat ihm entgegen und riß ihn zurück. Was er hier zu tun habe? Piero sah sich und seine Gefolge auf den Platz hinausgedrängt, das Volk stand in dichten Gruppen umher und sah mit an, was daraus würde. Einzelne Stimmen riefen ihm zu, er möge mit Gott gehen, wohin er Lust habe. Plötzlich erhob sich daraus ein Rufen, ein Geschrei, Libertà, libertà, popolo, popolo, die Kinder riefen zuerst und warfen mit Steinen auf den Medici und die ihn begleiteten. Niemand hatte Waffen, aber die Haltung des Volkes und das Geschrei erschütterten Piero, daß er zurückwich. Nun kam der Polizeimeister mit seinen Leuten und versuchte den Platz zu säubern. Das war das Zeichen des Ausbruchs. Die Wut wandte sich gegen ihn, der Palast der Polizei wurde gestürmt und die Gefangenen in Freiheit gesetzt.
Piero war im Palaste Medici wieder angelangt und sandte Boten an Paolo Orsini, der in der Nähe der Stadt lagerte. Aber auch die Herren von der Regierung fühlten, daß sie handeln müßten. Die Sturmglocke wurde gerührt, und aus allen Teilen der Stadt strömten die Bürger in Waffen auf den Platz zusammen. Dahin versuchten jetzt die Medici noch einmal vorzudringen.
Giovanni, der Kardinal, nachmals Leo der Zehnte, dessen freundliches Benehmen von jeher gegen das stolze Auftreten Pieros angenehm abstach und der den Bürgern der liebste der drei Brüder war, sollte zuerst erscheinen und das Volk anreden, Piero mit Giuliano und Orsini wollten mit den Truppen nachfolgen. Aber Giovanni ward zurückgestoßen, ehe er den Platz erreichte, auf die anderen, als sie mit den Truppen erschienen, wurde aus den Fenstern mit Steinen geworfen, und sie wagten sich nicht weiter vorwärts. Das Volk greift an. Giovanni flüchtet nach San Marco, dort abgewiesen, rettete er sich als Mönch verkleidet aus den Toren der Stadt. Piero mit den Seinigen folgt ihm. Noch einmal versuchen sie in den Vorstädten Geld auszuwerfen und das niedrige Volk, das da vorzugsweise wohnte, zur Empörung aufzureizen, aber als man ihnen auch hier mit Steinwürfen erwidert, eilen sie rascher vorwärts, bis eine förmliche Flucht daraus wird. Und so ging es fort nach Bologna.
V
So begegnete Michelangelo seinen Beschützern wieder, die von Bentivoglio mit Vorwürfen empfangen wurden. Persönlich hätten sie durch ihre Flucht ohne tätlichen Widerstand sich selbst geschadet, durch ihre Niederlage zugleich allen anderen Familien, die sich in ähnlicher Stellung befanden, das schlechteste Beispiel gegeben. Bentivoglio dachte dabei an sein eigenes Haus. In späteren Zeiten hätten es ihm die Medici Wort für Wort zurückgeben können, denn sein Schicksal gestaltete sich nicht besser als das ihrige. Die Brüder, die sich in Bologna nicht sicher fühlten, gingen nach kurzem Aufenthalte weiter nach Venedig, Michelangelo blieb im Palaste Aldovrandi, denn jetzt nach Florenz zurückzugehen, war nicht ratsam. Messer Gianfrancesco behandelte ihn auf ehrenvolle Art. Michelangelos ganzes Wesen, die Vielseitigkeit seiner Natur, gefielen ihm. Abends mußte er an seinem Bette sitzen und ihm ein Stück Dante oder Petrarca, auch wohl etwas aus den Novellen des Boccaccio vorlesen, bis er einschlief.
Auch künstlerische Beschäftigung fand sich. Bologna ist berühmt unter den italienischen Städten durch den Leichnam des heiligen Dominikus, den es besitzt. Der Sarg, welcher in der Kirche von San Domenico die Gebeine umschließt, stammte aus der Werkstätte Niccolo Pisanos, der als der Gründer der neueren Skulptur in Italien betrachtet wird. Er zuerst ahmte die Antike wieder nach und wußte, während die gleichzeitige Malerei noch in den festen Formen der Byzantiner gefangen lag, sich zu eigner Anschauung der Natur freizumachen.
Niccolos Arbeit ist aus einem einfachen Marmorkasten durch spätere Unter- und Aufbauten heute zu einem hohen Monumente geworden. Ununterbrochen seit dem dreizehnten Jahrhunderte, in welchem es entstand, wurde neuer Marmorschmuck zum alten hinzugefügt. Als Michelangelo nach Bologna kam, war kurz zuvor der Bildhauer gestorben, dessen Hauptarbeit sich auf dieses Denkmal so sehr konzentriert hatte, daß er davon den Beinamen erhielt: Niccolo dell'Arca. Nun bedurfte es eines Nachfolgers für Vollendung der begonnenen Skulpturen. Messer Aldovrandi führte Michelangelo nach San Domenico und fragte ihn, ob er sich die Arbeit zu unternehmen getraue. Herzustellen waren zunächst zwei Figuren, von denen die eine, der heilige Petronius in Bischofstracht, halb vollendet war, während die andere, ein kniender Engel, welcher einen Kandelaber hält, als Pendant eines bereits vorhandenen, noch ganz fehlte. Michelangelo sagte, er getraue es sich wohl. Man gab ihm dreißig Dukaten dafür.
Lange Zeit ist seltsamerweise Niccolos Engel für Michelangelos Arbeit gehalten worden: ein reizendes Figürchen, ganz im Stile des fünfzehnten Jahrhunderts, von zarter Natürlichkeit, während Michelangelos Werk, das auf den ersten Blick wenig Anziehendes hat, noch heute in Bologna Niccolo zugeschrieben wird. Es ist die Arbeit eines Anfängers, scheint trotzdem aber gleich solche Beachtung gefunden zu haben, daß es die Ursache wurde, warum Michelangelo Bologna wieder verlassen mußte.
Die Eifersucht einheimischer Handwerker gegen fremde ist eine gewohnte Erscheinung, in Sachen der Kunst aber kann sie sich leicht zum Haß steigern. Vasari spricht oft von dergleichen. Die Bologneser Künstler waren berüchtigt wegen ihrer feindseligen Gesinnung gegen fremde, ein Tadel, der auch denen von Perugia anklebte. Der ehrenvolle Auftrag, welcher Michelangelo, diesem hergelaufenen Florentiner von zwanzig Jahren, zuteil ward, erregte solche Empörung, daß es zu Drohungen kam. Ein Bolognesischer Bildhauer erklärte, ihm hätte diese Arbeit gebührt, ihm sei sie zuerst versprochen und durch Michelangelo nun entwandt worden; er möge sich in acht nehmen. Sicherlich war es nicht dieser Einzige allein, mit dem er zu tun gehabt hätte, und er zog es vor, in seine Vaterstadt zurückzukehren.
Was Michelangelo in diesem Entschlusse bestärken mußte, waren die festeren Zustände, die sich während seiner Abwesenheit in Florenz wieder gebildet hatten. Wie aber fand er alles verändert! Er hatte die Stadt verlassen, ehe von der Macht der Medici auch nur ein dünner Zweig abgeknickt war, und jetzt sah er den vollen Baum, der so weit hin seine Schatten streckte, bis auf die Wurzeln vertilgt. Der Palast der Familie stand leer und seiner Kunstschätze beraubt. Eine Partei hatte die Herrschaft in Händen, in deren Ohren es schon wie Verrat klang, wenn der Name der Medici anders als mit feindlichem Akzent, ausgesprochen ward. Der Garten von San Marco war verwüstet, seine Statuen und Bilder meistbietend verkauft und in alle Welt zerstreut. Von den Künstlern hatten viele die Stadt verlassen, andere verdammten als Anhänger Savonarolas, was sie früher so frei und fröhlich geschaffen hatten. Lorenzo di Credi, Verrocchios Schüler und Leonardos Freund, Baccio della Porta, bekannter als Fra Bartolommeo, Cronaca, der Architekt, und Botticelli, Filippo Lippis Schüler, kämpften mit ihrem Gewissen, ob die Arbeiten, die sie so schön hervorgebracht hatten, nicht Werke des Teufels wären. Und dementsprechend wurde die öffentliche Sittlichkeit mit unnachsichtlich scharfem Blicke bis ins Innere der Familien hinein von Staats wegen aufrecht erhalten.
Dies war die Frucht der Ereignisse, welche während des Jahres sich zugetragen hatten, das Michelangelo in Bologna verlebte.
In derselben Stunde, in der Florenz sich empört hatte und Piero geflüchtet war, kam der Aufstand in Pisa zum Ausbruch. Hier aber wurde nicht gegen die Medici, sondern gegen das Joch der Florentiner rebelliert, das auf der unglücklichen Stadt unerträglich gelastet hatte. Es war die ausgesprochene Politik von Florenz, Pisa langsam zugrunde zu richten. Mit flehentlichen Worten wandten sich jetzt seine Bürger an den König von Frankreich und baten um Schutz, den er zusagte. Karl übersah nirgends die Situation, überblickte nirgends die Verpflichtungen, welche das, was er im Feuer des Augenblickes aussprach, ihm selber auflegte. Er war jung, gutmütig und im Rausche des Glückes befangen, das mit unermüdlicher Treue seine Schritte begleitete. Klein und zwergenhaft nennt ihn Guicciardini, mit sechs Zehen an jedem Fuße – ein Monstrum; aber der kühne Blick verriet den König, setzt er hinzu. Allen Einflüssen zugänglich, fortwährend von mächtigen, ränkevollen Männern umgeben, die sich untereinander haßten und zu vernichten strebten, und denen allen er abwechselnd günstiges Gehör lieh, widersprach er sich frischweg in Entschlüssen und feierlichen Zusagen, und trotzdem, so lange das gute Glück bei ihm aushielt, gelang ihm das Unmögliche: allen gerecht zu werden. Jetzt garantiert er den Pisanern ihre Freiheit, und in demselben Atem besteht er darauf, daß die florentinischen Gerichtsbeamten dort in ihren Stellen blieben und man ihnen Gehorsam leiste. Dies nämlich hatte er Piero dei Medici zugesagt.
In Pisa teilte sich die französische Armee. Der Kardinal Vincula ging mit der Flotte nach Ostia, seiner Stadt, die er besetzt hielt, um die Borgia im Gebiet der Kirche von dort aus anzugreifen. Von der Landarmee marschierte der größere Teil des Heeres südlich nach Siena ab, die andere Hälfte begleitete den König nach Florenz, um mit ihm feierlich dort einzuziehen. Dafür kam nun auch Obigni aus der Romagna über die Berge hinüber.
Noch während Karl in Pisa verweilte, waren in Florenz die Medici zu Rebellen und Feinden des Vaterlandes erklärt worden. Ihre Paläste und die ihrer Ratgeber hatte das Volk gestürmt und geplündert, nur mit Mühe gelang es, den Hauptpalast der Familie zu retten, in dem Lorenzos Witwe und Pieros Gemahlin zurückgeblieben waren. Diesen beiden Frauen geriet nun der König in die Hände, der im Palaste Medici abstieg und dort mit seinem Gefolge, nebenbei bemerkt, all die Kostbarkeiten sich aneignete, die von dem ersten Sturm noch gerettet worden waren; er machte der Form wegen alte Forderungen geltend, welche Frankreich an die Medici hätte. Zugleich aber wirkten dennoch die Tränen und Bitten zugunsten Pieros und die Anklage gegen das unzuverlässige florentinische Volk. Karl hatte den Bürgern, bevor er in prachtvoll feierlichem Zuge die Stadt betrat, fest zugesagt, daß er alles billige, was geschehen sei, hatte sich von der neuen Regierung der Stadt empfangen und in den Dom führen lassen, umdrängt vom Volke, das Francia! Francia! jauchzte, und endlich, im Palaste der Medici abgestiegen und allein mit Clarice und Alfonsina, ließ er sich soweit bringen, daß Eilboten nach Bologna gesandt wurden, Piero möge zurückkehren, der König werde ihn in seine Stelle wieder einsetzen. Aber die Medici waren längst nach Venedig weiter. Nun verlangte er von der Stadt ihre förmliche Rückberufung und die Aufnahme einer stehenden, französischen Besatzung. Die Lage war eine kritische. Florenz angefüllt von den Rittern und den Mietstruppen des Königs, deren Übermut zu Reibungen führte. Italienische Gefangene, welche die Franzosen wie gebundenes Vieh durch die Straßen zerrten, wurden von florentinischen Bürgern gewaltsam befreit. Im Palaste wollten die Verhandlungen zu keinem Ende führen. In betreff der Medici gab Karl zuletzt nach, aber die Summe, die er als Zuschuß in seine Kriegskasse forderte, war übermäßig. Er bestand auf seiner Forderung. »Gebt ihr nicht nach«, rief er abbrechend aus, »so lasse ich meine Trompeten blasen!« »Und wir läuten unsere Glocken!« rief Pier Capponi in einem Tone dagegen, der nicht weniger drohend klang, zerriß den eben aufgesetzten Kontrakt und wandte sich mit den anderen Bürgern, von denen keiner seine Kühnheit verleugnete, zum Fortgehen.
Bis an die große Treppe des Palastes ließ sie der König gelangen, da rief er Capponi zurück, der von Lyon her sein Bekannter war, machte einen Scherz aus der Sache und tat, als ließe er ihm auf die alte Freundschaft die Worte hingehen, die späterhin in Florenz solche Berühmtheit erlangten, daß heute kein Florentiner ist, der von jener Begegnung nicht zu erzählen wüßte. Man vereinigte sich zu einem billigeren Vertrage, welcher feierlich beschworen ward. Karl nahm den Titel »Wiederhersteller und Schutzherr der florentinischen Freiheit« an, die Stadt führte seine Fahne, er zog ab, nur die von Piero übergebenen Städte behielt er bis zur Eroberung Neapels. 120 000 Goldgulden wurden beigesteuert, ein neuer Handelsvertrag mit Frankreich vereinbart. Die Medici sollten das Recht haben, ihre Angelegenheiten in der Stadt zu ordnen, natürlich aber nicht in eigner Person. Am 28. November 1494 zog Karl nach Siena ab. Ein gärendes Chaos von Begeisterung, Ehrgeiz, Eigennutz, Fanatismus und gutem Willen blieb zurück und strebte aus sich selbst nach fester Gestaltung.
Diese zu gewinnen, war keine leichte Sache. Man hatte die Medici verjagt und dennoch die Regierung, die von ihnen selbst aus ihren eigenen Anhängern gebildet worden war, im Amte gelassen. Diese Herren hatten sich ja im Sturme der allgemeinen Empörung an die Spitze des Aufruhrs gestellt, ihr Benehmen erschien bei so uneigennütziger Handlungsweise nur um so leuchtender. Nach dem Abzuge Karls beriefen sie ein Parlament, das dem Herkommen nach eine Zahl Männer mit diktatorischer Macht behufs Neubesetzung der Staatsämter ausrüstete. Die Mitglieder der alten Regierung wurden gewählt und ihnen dadurch abermals das höchste Vertrauen bewiesen. Unterdessen waren diese aber und überhaupt die Freunde der Medici zur Besinnung gekommen. Sie fühlten, daß sie übereilt gehandelt hätten, und sahen sich im Besitze der Gewalt. Notorische Persönlichkeiten, die als Gegner der Medici bekannt waren, wurden nun bei Verteilung der Stellen übergangen. Eine Anzahl der größten Familien mit mächtigen Männern an der Spitze fühlten sich gekränkt. Die Bürgerschaft fing an unruhig zu werden. Savonarola hatte auch seine Pläne. Die anderen dachten nur an sich selber, er aber an die Sache, der er sich geweiht hatte.
Seine Predigten begannen wieder in den Fasten des Jahres 95. Er drängte auf eine totale Änderung der Dinge. Geistig und politisch wollte er die Stadt umschmieden. Er deutete unablässig auf die wunden Stellen. Er hatte das Größte, eine Umgestaltung Italiens, im Auge und fing beim Kleinsten, beim Herzen jedes einzelnen seiner Zuhörer mit der Reform an. Er predigte Güte und Versöhnlichkeit, aber wehe denen, die seinen Worten nicht Folge leisteten! Seiner Idee nach sollte an der Spitze des Staates der Wille einer Versammlung aller stimmfähigen Vollbürger als höchste Gewalt stehen. Es mochten auf ganz Florenz gegen 2000 Männer kommen, die im Genuß des Bürgerrechts in diesem Sinne waren. Diese sollten sich als großer Rat, consiglio grande, im Palaste der Regierung versammeln und der Beschluß der Majorität der Souverän von Florenz sein.
Noch vor der Mitte des Jahres war die Partei der Medici aus der Regierung und aus ihren Stellen verdrängt, und das Consiglio grande konstituierte sich. Alles tat Savonarola. Er lenkte die Majorität, der er im Namen Gottes seine entscheidenden Befehle zukommen ließ. Francesco Valori und Paolantonio Soderini, Anhänger seiner Lehre und erbitterte Gegner der Medici, beide zuerst bei der Stellenausteilung übergangen, standen als die Führer der herrschenden Partei mit ihm als die mächtigsten Männer im Staate da. Zwei Zielpunkte hatten sie im Auge. Nach innen, Durchführung der Reform; nach außen, Wiedererlangung Pisas und der übrigen Städte, die sich in der Gewalt der Franzosen befanden; denn obgleich Florenz keine französische Besatzung in seinen Mauern hatte: solange Pisa und Livorno Frankreich gehörten, war auch Florenz von ihm abhängig.
Karls Vordringen nach Neapel war ein Triumphzug. Fast alle französischen Kriege in Italien haben mit blendendem Siegesglanze begonnen und mit Unterliegen geendet. Machiavelli sagt von den Franzosen seiner Zeit, was Cäsar schon von den alten Galliern geurteilt: beim ersten Angriffe wären sie mehr als Männer, beim endlichen Rückzuge weniger als Weiber
In Rom schloß der König mit dem Papste zärtliche Freundschaft. Von da ging er weiter nach Neapel. Ende Februar hielt er seinen Einzug, das Volk hatte zu seinen Gunsten rebelliert und die Aragonesen davongetrieben. Die Neapolitaner haben ein Bedürfnis nach frischen Königen, urteilt Guicciardini. Karl wurde mit überschwenglichen Freudenbezeugungen aufgenommen.
Bis zu diesem Tage hatte es noch keiner Schlacht bedurft. Die Tore taten sich auf, wo er sich zeigte. Allein nun kam der Rückschlag. Vor ihm war alles gewichen, hinter ihm schloß es sich wieder zusammen. Lodovico Sforza war der erste, der abfiel. Statt Livorno und Pisa ihm zu geben, hatten die Franzosen die Städte selbst behalten. Venedig, der Römische König, Spanien und der Papst machten gemeinschaftliche Sache mit Mailand. Eben noch hatte ganz Italien glatt und sanft zu des Königs von Frankreich Füßen gelegen, und jetzt galt es, sich mit Gewalt den Rückweg durch ein feindliches Land zu bahnen. Karl nahm den Kampf an. Einen Teil der Armee ließ er in Neapel zurück, der durch die Flotte mit Frankreich in Verbindung blieb, mit der anderen Hälfte kehrte er um, auf Rom wieder los. Eben noch hatte er Kuß und Umarmung mit dem Papste getauscht, davon war diesmal keine Rede mehr. In ganz Italien hatte der König nur einen Bundesgenossen, und das waren die von Savonarola geleiteten Bürger von Florenz, bei denen alle Anstrengungen der übrigen Mächte, sie zum Anschluß an das große Bündnis herüberzuziehen, vergeblich blieben.
Der Mut Karls aber und sein Stolz litten nicht unter diesem Wechsel der Umstände. In Siena erwartete ihn eine Gesandtschaft der Florentiner. Sie boten ihm Geld und Mannschaften an. Er antwortete, seine eigenen Leute genügten ihm, Herr über seine Feinde zu werden. Noch einmal trat ihm Savonarola entgegen. Das Evangelium in der Hand haltend, beschwor er ihn, die Strafe des Himmels zu fürchten und Pisa herauszugeben. Der König wich aus. Er konnte sein Wort nicht beiden Parteien zugleich halten. Sogar mit den Medici stand er aufs neue in Verkehr. Piero befand sich damals in seinem Gefolge und hoffte durch ihn in die Stadt zu gelangen, in der seine Freunde als geordnete Partei der Savonarolas entgegenstanden und die Rückkehr ihres ehemaligen Herrn vorbereiteten.
Ohne Florenz zu berühren, ging Karl nach Norden weiter. Endlich kam es zur ersten Schlacht in diesem Kriege. Bei Fornuovo am Taro stellte sich ihm das Heer der Verbündeten entgegen und suchte ihn aufzuhalten. Beide Teile schrieben sich den Sieg zu, die Franzosen mit größerem Rechte, denn sie schoben den Feind zur Seite und machten sich den Weg nach Piemont frei. Am 6. Juli geschah dies im Norden Italiens, am 7. Juli kam im Süden Neapel schon wieder in die Gewalt der Aragonesen. Es stand bedenklich mit der französischen Sache. Erst jetzt erlangten die Florentiner, daß den Besatzungen der toskanischen Städte Befehl zum Abzuge gegeben ward.
Der Kommandant von Pisa aber weigerte den Gehorsam. Die Bitten der Pisaner, ihr Gold, die Tränen eines schönen Mädchens, das die Erhaltung der Freiheit zum Preis ihrer Liebe machte, endlich: entgegengesetzte Verhaltungsbefehle aus der Nähe des Königs selber brachten es dahin, daß den Florentinern die Tore geschlossen blieben. Nur Livorno wurde ihnen eingeräumt; die übrigen Festungen verkauften die Franzosen an Lucca oder Genua. Florenz mußte sich mit Gewalt sein Recht verschaffen. An der Allianz mit Frankreich hielt man fest, aber Pisa mußte erobert werden. Savonarola feuerte dazu an, er verhieß die Wiedereinnahme der Stadt im Namen Gottes, der auf seiten des Volkes stände.
Die Pisaner, gefaßt auf den Abzug der Franzosen, der kurz oder lang dennoch erfolgen mußte, wandten sich an Venedig und an Lodovico Sforza. Beide unterstützten die flehende Stadt, weil beide sie für sich selbst zu gewinnen hofften. Dieser Kampf der Pisaner um ihre Freiheit, diese verzweifelte Anstrengung, sich aus der Schwäche emporzuraffen, in die sie durch die Florentiner immer tiefer versenkt worden waren, muß jedem das Herz ergreifen, der die Ereignisse näher betrachtet. Wenige Städte haben so bis auf das Äußerste ihre Mauern verteidigt. Aber Savonarola rührte das nicht. Pisa war sein Karthago, das vernichtet werden müßte. Keine Spur von Mitleid in seinen Worten, wenn er von der Unterjochung der Stadt als der Belohnung des Himmels redet und die Bürger anfeuert, auszuhalten und der französischen Politik treu zu bleiben. Er hatte den Staat wie weichen Teig in den Händen, was er wollte, wurde angenommen. Er besaß eine wunderbare Gewalt, die natürlichsten, nüchternsten Reden zu unwiderstehlichem Fluß aneinanderzuketten. Sprichwörter, Fragen mit Antworten darauf, dazwischen pathetische Begeisterung, Bibelstellen, Nutzanwendungen überraschender Art, aber immer für das handgreifliche Verständnis ausgearbeitet, stehen ihm in drängender Fülle zu Gebote. Er war die Seele der Stadt. Wie eine gut geschriebene Zeitung heute ihrer Partei die Gedanken zufließen läßt, die sie bedarf und verlangt, so übernahm Savonarola, die tägliche Gedankenzehrung der Florentiner zu befriedigen, und seine Vorräte schienen unerschöpflich. Er sprach in kurzen Sätzen. Ohne schmückende Beiwörter, rasch und praktisch, wie man auf der Straße redet, aber zu hinreißendem Zuge verbindet er die Gedanken. Und da es nur einige wenige Punkte sind, auf die er stets zurückkommt, wie er sie von Anfang an gepredigt hat, so sagt er den Leuten nichts Neues, was sie erst frisch aufzufassen und zu bedenken hätten, sondern wiederholt nur mit immer neuer Kraft ihre eigenen alten Überzeugungen. Mitten unter den Prophezeiungen und den Erklärungen der höchsten Dinge erteilt er Befehle über Kleidung, Sitte und Betragen und gibt politische Verhaltungsregeln für die nächsten Tage, wie sie gerade von der Lage der Dinge erfordert werden. Savonarola besaß den alten Takt der Männer des Volkes, die mit den Massen umzugehen wissen und mitten in der Begeisterung nie die gemeine Deutlichkeit verlieren. Nur daß bei ihm endlich die Begeisterung zum Fanatismus wurde.
In solche Zustände trat Michelangelo ein, als er von Bologna zurückkam. Sie waren trüb und drückend, aber es wurde noch von Künstlern gearbeitet und von reichen Leuten gekauft. Er richtete sich sogleich eine Werkstätte ein. Auch fand sich ein Beschützer für seinen Genius, und sogar ein Medici war es, der sich seiner annahm.
Der alte Cosimo hatte einen Bruder gehabt, der früh starb und ein großer Freund der Gelehrsamkeit gewesen war. Seine Nachkommen lebten in Florenz und wurden von der regierenden Linie stets mit Mißtrauen beobachtet. Piero ging so weit, seine beiden Vettern Lorenzo und Giovanni, die allerdings in Florenz sowohl als an auswärtigen Höfen gegen ihn intrigierten, gefangen setzen zu lassen, und war nur mit Mühe dahin zu bringen gewesen, das Gefängnis in die Verbannung auf eine Villa zu verwandeln, deren Grenzen sie nicht überschreiten durften. Nach Frankreich entflohen, kehrten sie im Gefolge Karls zurück. Nach dem Sturze Pieros traten sie wieder in die Stadt ein, legten, um dem Volke zu schmeicheln, den Namen Medici ab und nannten sich Popolani, ganz wie Orleans unter ähnlichen Umständen sich einst Egalité genannt. Reich und durch ihre Frauen mit dem höchsten Adel Italiens verwandt, lebten sie seitdem in Florenz und suchten sich durch Eifer für seine Freiheit hervorzutun.
Lorenzo nahm sich Michelangelos an und gab ihm Arbeit. Er ließ einen heiligen Johannes in kindlichem Alter, einen San Giovannino wie Condivi sagt, von ihm ausführen, und es hat sich neuerdings auch eine Statue gefunden, welche Anspruch erheben durfte, als dieser Giovannino anerkannt zu werden. In einem vornehmen Hause in Pisa auftauchend, ist sie in das Berliner Museum gelangt und hat sowohl durch ihre Schönheit als durch offenbare Zeichen, welche ihre Herkunft zu bestätigen scheinen, Aufsehen erregt. Johannes, eine zarte Knabengestalt, steht so unschuldig da, die Ähnlichkeit mit anderen Werken Michelangelos ist so offenbar, daß man sich fast genötigt sieht, auch dieses ihm zuzusprechen. Dennoch kann ich mich nicht für völlig überzeugt erklären, da etwas im Ausdrucke des Antlitzes wie in der Flächenbehandlung des Marmors gegen die Urheberschaft Michelangelos redet. Müßte sie, wenn sie sein Werk ist, nicht später in Rom erst entstanden sein?
Neben diesem Auftrage begann Michelangelo auf eigene Rechnung einen Cupido in Marmor zu hauen, den er im Schlafe liegend als sechs- bis siebenjähriges Kind darstellte. Man hat das Werk wieder entdecken wollen, aber es bleibt verschollen.
Während des Winters 1495 auf 96, in dem er an diesen beiden Stücken tätig war, traten jetzt aber Ereignisse in der Stadt ein, zu denen die bisherigen nur ein sanfteres Vorspiel waren. Nach allen Seiten hin hatten die Dinge noch in der Schwebe gelegen. Das Verfahren der Verbündeten, Florenz zu gewinnen, hielt stets an der sichern Aussicht fest, daß die Bemühungen, die Stadt zum Abfall von Frankreich zu bringen, Erfolg haben würden. Die Parteien flossen noch immer einigermaßen durcheinander; Savonarola hielt, so heftig er sprach, doch ein gewisses Maß inne, und wenn man von Rom aus hätte einlenken wollen, es wäre möglich gewesen.
In das Ende des Jahres 95 aber fällt die erste bewaffnete Expedition der Medici, sich mit Gewalt der Stadt wieder zu bemächtigen. Piero, der von den Franzosen nichts erlangen konnte, hatte sich an die Verbündeten gewandt und Gehör gefunden. Die Florentiner sollten gezwungen werden, sich ihnen anzuschließen und die Angriffe gegen Pisa einzustellen. Mit Sforza, den Bentivogli, den Orsini und mit Siena im Bunde, hofften die Brüder Florenz wie in einer Schlinge zu fangen und zum Gehorsam zu bringen. Aber die Uneinigkeit der Verbündeten vereitelte die Unternehmung, deren einziger Erfolg die Stärkung der Partei Savonarolas in der Stadt und die seines eigenen Ansehens war.
Nun kam der Karneval zu Anfang des Jahres 96 .
Sonst pflegte er mit ausgelassenem Spektakel begangen zu werden. Tag und Nacht
wütete Tollkühnheit in den Straßen, vom graziösen Scherze bis zum Unfug, der
mit Blutvergießen endete. Jeder mußte seine Haut zu Markte tragen. Die Krone
des Festes waren immer die prachtvollen Umzüge mit Gesang und am letzten Tage
das Verbrennen der Bäume, die, mit erbetenem oder erpreßtem Flitter behangen,
auf den öffentlichen Plätzen aufgestellt und unter Tänzen umher vom Volke in
Flammen gesetzt wurden.
.
Sonst pflegte er mit ausgelassenem Spektakel begangen zu werden. Tag und Nacht
wütete Tollkühnheit in den Straßen, vom graziösen Scherze bis zum Unfug, der
mit Blutvergießen endete. Jeder mußte seine Haut zu Markte tragen. Die Krone
des Festes waren immer die prachtvollen Umzüge mit Gesang und am letzten Tage
das Verbrennen der Bäume, die, mit erbetenem oder erpreßtem Flitter behangen,
auf den öffentlichen Plätzen aufgestellt und unter Tänzen umher vom Volke in
Flammen gesetzt wurden.
Wie einst das Christentum sich der alten heidnischen Feste bemächtigte und sie, statt sie auszurotten, an sich riß, so verfuhr jetzt Savonarola. Es sollten Umzüge gehalten, Lieder gesungen, Gaben erbettelt und Bäume verbrannt werden, das Volk sollte tanzen um sie her, aber alles in höherem Sinne, wie er es erdachte und anordnete. Kinder gingen durch die Straßen, klopften an die Türen und baten mit sanften Worten um »Gegenstände der Verdammnis«, die zur Ehre Gottes verbrannt werden sollten. Statt der lustigen Aufzüge erfolgten Prozessionen mit frommen Liedern. Am letzten Tage dann der Aufbau einer Pyramide, errichtet aus den Ergebnissen der Sammlung. Musikinstrumente, Bücher mit Liebesgedichten (toskanische sowohl als heidnische), Bilder, Putz, Parfüms, kurz was von unheiligen Überflüssigkeiten des täglichen Lebens erdacht werden kann, türmte sich hier in den wertvollsten Exemplaren zu einem Baue auf, der angesteckt und unter Absingung seltsamer Lieder zum Lobe Christi, des »Königs von Florenz«, vom begeisterten Volke umtanzt wurde. Alt und jung beteiligte sich. Hier war es, wo Fra Bartolommeo und Lorenzo di Credi ihre eigenen Arbeiten den Flammen überlieferten, wo kostbare Ausgaben des Petrarca und Virgil zerstört wurden.
Die Fasten folgten. Diesmal eine wirkliche Zeit der Buße und Zerknirschung. Tag für Tag sausten die Predigten Savonarolas durch das Volk und fachten die glühende Schwärmerei zu frischen Flammen an. Zweimal bereits hatte der Papst ihm das Predigen untersagt, die Regierung der Stadt aber und seine römischen Freunde eine Aufhebung des Verbotes erlangt. Man hatte gehofft, daß er sich mäßigen werde, aber das war wenig gewesen, was er bis dahin gesagt, rückhaltlos gab er sich jetzt dem Drange hin, kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, und bezeichnete deutlicher die letzten Konsequenzen seiner Lehre. »Ich frage dich, Rom«, ruft er, »wie es möglich sein kann, daß du noch auf dem Boden der Erde dastehst?« Elftausend Kurtisanen in Rom, sei noch zu tief gegriffen. Nachts wären die Priester bei diesen Frauen, morgens darauf läsen sie die Messe und teilten die Sakramente aus. Alles sei in Rom käuflich, alle Stellen und Christi Blut selber für Geld zu haben. Er stehe da und fürchte sich nicht. Seine Feinde und Angeber möchten nur berichten, was er gesprochen habe; er sei ein Feuer, das sich nicht löschen ließe.
Vieles sei eingetroffen von dem, was er vorausgesagt habe, aber das sei das wenigste. Rom und Italien würden bis auf die Wurzeln vernichtet werden, furchtbare Rächerbanden würden sich über das Land ergießen und den Hochmut der Fürsten bestrafen; die Kirchen, die von ihren Priestern zu öffentlichen Häusern der Schande erniedrigt wären, würden die Ställe der Pferde und des unreinen Viehes sein; Pest und Hungersnot würden kommen – so donnert er los am vierten Morgen der Fasten in einer Predigt, die heute noch einen aufregenden Eindruck macht.
Wir wissen nicht, in welchem Maße Michelangelo sich diesen Stimmungen hingab, wohl aber, daß er zu Savonarolas Anhängern gehörte. In hohem Alter noch studierte er seine Schriften und erinnerte sich der starken Stimme, mit der er gepredigt. Als im Jahre 1495 der Saal für das Consiglio grande im Palaste der Regierung auf Savonarolas Drängen ausgebaut zu werden begann, war Michelangelo unter denen, die dabei zu Rate gezogen wurden. Die Sangalli, Baccio d'Agnolo, Simone del Pollaiuolo und andere bildeten diese Kommission. Simone del Pollaiuolo, bekannter unter dem Namen Cronaca, erhielt den Bau, Fra Bartolommeo übernahm das Gemälde für den im Saale errichteten Altar, lauter Anhänger Savonarolas und Michelangelo mitten unter ihnen. Am 15. Juli wurde Cronaca erwählt. Dieses Datum gibt zugleich einen Anhaltspunkt für Michelangelos Rückkehr aus Bologna. Er mußte in Florenz gerade wieder angekommen sein, als er bei dieser Angelegenheit beteiligt wurde.
Trotzdem blieb er immer noch weltlich genug gesinnt, um den Cupido zu arbeiten. Im April oder Mai 1496 hatte er ihn vollendet. Medici war entzückt von der Arbeit und gab ihm an, auf welche Weise der beste Preis dafür zu erzielen sein würde. Er möge dem Stein das Ansehen geben, als hätte er lange in der Erde gelegen. Er selber wolle ihn darauf nach Rom schicken, wo er als eine Antike hoch bezahlt werden würde. Man sieht, daß den Medici trotz ihrer Vornehmheit der Kaufmannsgeist nicht verloren gegangen war. Lorenzo bewährte das noch bei anderen Gelegenheiten. Er verstand die in Florenz eintretende Teuerung wohl zu benutzen, indem er aus der Romagna Korn kommen ließ und daran ein Erkleckliches verdiente.
Michelangelo ging auf den Vorschlag ein, gab dem Marmor ein verwittertes, uraltes Aussehen und empfing bald durch Lorenzo den Bescheid, daß ihn der Kardinal von San Giorgio, jener selbe Raffael Riario, der in Florenz die Messe las, als Guiliano von den Pazzi ermordet wurde, für dreißig Dukaten angekauft habe. Messer Baldassare del Milanese, durch dessen Vermittelung in Rom der Handel abgeschlossen war, ließ Michelangelo die Summe in Florenz auszahlen, welche diesem demnach als ein vernünftiger Preis erschienen sein muß.
Das Geheimnis aber von der wirklichen Entstehung der Antike wurde nicht bewahrt. Dem Kardinal kam allerlei zu Ohren; er ärgerte sich, betrogen zu sein, und schickte einen der ihm dienenden Edelleute nach Florenz, um der Sache auf den Grund zu kommen. Dieser nahm den Schein an, als suche er Bildhauer, die in Rom beschäftigt werden sollten, und lud auch Michelangelo zu sich ein. Er kam, statt jedoch mitgebrachte Arbeiten zu zeigen, nahm er eine Feder und zeichnete eine menschliche Hand groß aufs Papier hin, daß ihm der Römer voller Erstaunen zusah. Hierauf zählte er auch die Skulpturen auf, die er bereits vollendet hätte, und nannte darunter ohne weiteres den schlafenden Cupido.
Nun eröffnete der Mann, warum er ihn eigentlich habe rufen lassen; statt der dreißig Dukaten, die Messer Baldassare geschickt, erzählte er von zweihundert, welche der Kardinal für die Arbeit bezahlt hätte, so daß sich Michelangelo ebensosehr als der Kardinal selbst betrogen sah. Eingeladen von dem römischen Herrn, der ihn in seinem eigenen Hause aufzunehmen versprach, erfüllt von dessen Erzählungen, daß man in Rom ein weites Feld finde, um seine Kunst zu zeigen und Geld zu gewinnen, hauptsächlich aber in der Absicht, sich von Messer Baldassare die übrigen hundertsiebzig Dukaten auszahlen zu lassen, machte er sich nach Rom auf, wo er am 25. Juni 1496 eintraf.
Viertes Kapitel
1496-1501
I
Das älteste Schriftstück von Michelangelos Hand, das wir besitzen, ist der Brief, in welchem er Lorenzo dei Medici seine Ankunft in Rom anzeigt.
»Ew. Magnifizenz teile ich mit, daß wir am vorigen Sonnabend gesund angekommen sind und sogleich zum Kardinal di San Giorgio gingen, dem ich Euren Brief überreichte. Er schien mir wohlgeneigt zu sein und begehrte auf der Stelle, daß ich mir verschiedene Figuren ansähe, womit ich den ganzen Tag zubrachte und deshalb Eure anderen Briefe noch nicht abgab. Sonntag kam der Kardinal in den neuen Bau und ließ mich rufen. Als ich kam, fragte er mich, was ich von dem hielte, was ich gesehen hätte. Ich sagte ihm meine Meinung darüber. Es sind in der Tat, scheint mir, hier sehr schöne Sachen. Der Kardinal wollte nun wissen, ob ich mir etwas Schönes zu arbeiten getraute. Ich antwortete, daß ich keine großen Versprechungen machen wolle, aber er würde ja selbst sehen, was ich zu leisten imstande sei. Wir haben ein Stück Marmor für eine lebensgroße Figur gekauft, und nächsten Montag fange ich an zu arbeiten. Vergangenen Montag gab ich Eure übrigen Briefe Paolo Rucellai, der mir das Geld auszahlte, das ich nötig hatte, und das für Cavalcanti. Dann brachte ich Baldassare den Brief und verlangte den Amor zurück, ich wollte ihm dafür sein Geld wiedergeben. Er antwortete mir sehr heftig, lieber wolle er den Amor in tausend Stücke schlagen, er habe ihn gekauft, er sei sein Eigentum, er könne schriftlich beweisen, daß er dem genug getan, von dem er ihn empfangen hätte. Kein Mensch solle ihn zwingen, ihn wieder herauszugeben. Er beklagte sich über Euch. Ihr hättet ihn verleumdet. Einer von unseren Florentinern hier hat sich dazwischen gelegt, um uns zu vereinigen, hat aber nichts ausgerichtet. Ich denke jetzt durch den Kardinal die Sache durchzusetzen; Baldassare Balducci hat mir diesen Rat gegeben. Ich schreibe Euch, was weiter geschehen wird. Soviel für diesmal. Ich empfehle mich Euch. Gott behüte Euch.
Michelagnolo in Rom.«
Wie lebhaft führen uns die wenigen Worte in den Verkehr der Leute hinein, die über den Handel mit der Statue aneinandergeraten. Ein geärgerter hoher Herr, ein wütender, betrügerischer Kaufmann, dazwischentretende Freunde, und dennoch dies alles Nebensache gegen Rom selber! Michelangelo durchstreift die Stadt, und über dem Anblick der Kunstwerke kommen ihm neue Gedanken zu eignen Arbeiten.
Er war einundzwanzig Jahre alt, als er nach Rom kam.
Wie die Römer einst sagten »die Stadt«, um Rom zu bezeichnen, sagen wir heute »Rom«, um das zu nennen, was jedem, der es gesehen hat, als das Ideal einer Stadt erscheinen muß. Man meint, als die Welt geschaffen sei mit Bäumen, Flüssen, Meeren, Gebirgen, Tieren und Menschen endlich, da hätte an dem Flecke der Erde, wo Rom steht, eine Stadt aus dem Boden wachsen müssen, aufsprossend ohne menschliches Zutun. Bei anderen Städten könnte man denken, hier war einst eine wüste, öde Fläche, ein Wald, ein Sumpf, eine stille, weitgedehnte Wiese; dann kamen Menschen und errichteten Hütten, aus denen Häuser wurden, eins klebte sich ans andere, und es ward endlich eine ungeheure Menge mit Kirchen und Palästen dazwischen, aber alles zerstörbar wieder, und nach Jahrhunderten könnten da frische Bäume stehen, zwischen denen nur scheues Wild durchschlüpfte; bei Rom aber sind solche Gedanken fast eine Unmöglichkeit. Man glaubt nicht, es sei hier jemals sumpfiger Grund gewesen, in dessen seichtem Gewässer Romulus und Remus als Kinder ausgesetzt wurden, oder es könne der rohesten Gewalt gelingen, die sieben Hügel von Gebäuden zu befreien. Bei Berlin, Wien, Paris könnte ich mir einen Sturm denken, der wie ein Rasiermesser alles vom Boden abmähte und tot zur Seite würfe; in Rom aber scheint es, als müßten die Steine sich wieder zu Palästen zusammenfügen, wenn sie eine Erschütterung auseinanderrisse, als sei es gegen die Gesetze des Daseins, daß die Höhe des Kapitols ohne Paläste, Tempel und Türme sei.
Es ist ein Übelstand, daß man sich, um dergleichen Gedanken auszudrücken, fester Bilder mit begrenztem Inhalte bedienen muß. Praktisch genommen, sind es wertlose Gedanken, die hier eben vorgebracht wurden, denn Rom kann einmal so gut wie Babylon und Persepolis mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Und dennoch liegt in diesen Phantasien ein Inhalt höherer Art, und die Notwendigkeit ist vorhanden, sie zu sagen. Das Gefühl des Ewigen, Unvergänglichen sollte ausgedrückt werden, das uns in Rom beschleicht; das Gefühl, als sei die Erde ein großes Reich und hier sein Mittelpunkt; die Liebe zu dieser Stadt aller Städte. Ich bin kein Katholik und spüre nichts von romantischer Verehrung von Papst und Kirche in mir, aber leugnen kann ich das allmächtige Heimatsgefühl nicht, das mich in Rom ergriffen hat, und die Sehnsucht dahin zurück, die ich nie verlieren werde. Die Idee, daß der junge Michelangelo, voll vom Geräusche des fanatisch bewegten Florenz, in dieses Rom vom Schicksal geleitet wird und zum ersten Male den Boden betritt, wo das verworrenste Treiben dennoch von der stillen Größe der Vergangenheit überboten wurde, hat etwas Furchtbares, Gedankenerweckendes in sich. Es war der erste Schritt seines wirklichen Lebens, den er tat. Vorher ließ er sich hin- und herleiten von den Menschen und von den eigenen unklaren Absichten; jetzt auf sich selber angewiesen, nimmt er einen neuen Anlauf für seine Zukunft und das, was er hervorbringt, eröffnet die Reihe seiner Meisterwerke.
II
Welcher Art die schönen Sachen gewesen sind, von denen er gegen den Kardinal äußerte, daß sie in Rom vorhanden seien, läßt sich heute kaum bestimmen. Die Ausbeute des reichen Bodens hatte begonnen, und viel war gefunden worden, allein die Entdeckung der meisten Antiken, welche heute als Prachtstücke der Sammlungen bekannt sind, fällt in spätere Zeiten; andererseits ist von dem, was sich im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert in Rom angehäuft hatte, in der folgenden Zeit viel nach allen Seiten hin entführt worden. Der heutige Zustand gibt keinen Maßstab für den damaligen, es war ein anderes Rom, in das Michelangelo eintrat. Die vorhandenen Kunstwerke waren nicht wie jetzt in Museen kalt nebeneinander gereiht, sondern verteilt durch die ganze Stadt, zum Schmuck der Gebäude und zur Freude der Menschen, allüberall an günstigen Plätzen frei aufgestellt. Diese Gebäude waren in einem Stile aufgeführt, von dem nur geringe Reste übrig geblieben sind. Als Michelangelo den Felsen des Kapitols bestieg, ahnte er nicht, daß er ihn einst mit Palästen besetzen würde, die seine ganze Form veränderten. Als er da droben, auf den nackten Trümmern des alten Jupitertempels sitzend, die Augen umherschweifen ließ, ahnte er nicht, daß man von da einst die Peterskuppel, die er erdachte, und die unzähligen kleineren Kuppeln, die alle nach ihrem Muster gebaut sind, mit den Blicken überfliegen würde. Heute denkt man, Rom sei nicht möglich ohne diese Aussicht. Nichts von alledem war vorhanden. Damals stand noch die alte Basilika von Sankt Peter; der prachtvolle, geräumige Platz des Bernini mit den sausenden Springbrunnen und den gewaltigen Säulengängen, die ihn in ihre Arme nehmen, war mit einem wüsten Wirrwarr kleiner Häuser bedeckt. Ein Platz lag in ihrer Mitte, auf dem Turniere und Ringelrennen abgehalten wurden. Der langgestreckte vatikanische Palast war kaum viertel so groß als heute und festungsartig abgeschlossen. Von hier aus zog der Papst einen bedeckten gemauerten Gang nach der Engelsburg, die durch Festungswerke mit der Brücke, die unter ihr über die Tiber führt, eng verbunden, sichtbarer als heute das Bild eines Kastells darbot, dessen Inhaber dadurch, daß er die beiden Hälften Roms, die päpstliche neue Stadt nördlich vom Flusse und das alte große Rom südlich von der Tiber, je nach seinem Willen völlig voneinander trennen konnte, Herr der Stadt war.
Das Kastell von Santangelo bildete die Zitadelle von Rom, aber doch nur eine einzige all der geringeren Festungen, von denen es, wie Florenz in alten Tagen, immer noch erfüllt war. In Florenz hatte ein freierer, lichterer Stil längst freie, schöne Paläste geschaffen, in Rom, wo der öffentliche Zustand der Dinge der Stärke vor der Schönheit noch den Vorrang lassen mußte, sah man erst wenige von den ausgedehnten mit Fensterreihen erfüllten Prachtfassaden. Die von hohen Türmen überragten Paläste der Kardinäle und des hohen Adels, der Orsini, Colonna und anderer zeigten sich als ringsum abgeschlossene, finstere Bauwerke, wohlgeeignet verteidigt zu werden, und mit allen Mitteln versehen, plötzliche Überfälle abzuwehren. Der römische und florentinische Palastbau ist ein Produkt der Zeiten und der Geschichte. Die Fassade lag nach innen, der Hof war der eigentliche Mittelpunkt des Gebäudes, ein ringsum eingeschlossener Raum, wo zu allen Tageszeiten schattige Kühle waltete, wo sich der Brunnen befand und die Statuen in günstigem Lichte standen. Die nach außen rauhen und düsteren Massen der Paläste öffneten sich um den Hof in leichten, offenen Säulengängen. Hier war man sicher und hatte dennoch den freien Himmel über sich. Die Loggien des Vatikans, die Raffael ausmalte, sind die offenen Bogengänge, welche den Hof des päpstlichen Palastes umgeben.
Um diese Burgen der weltlichen und geistlichen Fürsten lagen die Wohnungen ihrer Dienstleute und derer überhaupt, die sich zu dem Herrn hielten, der in ihrer Mitte thronte. Die engen Straßen zwischen diesen Häusern wurden nachts mit Ketten gesperrt. So hatte jeder Mächtige seine Stadt in der Stadt für sich, seinen Hof, seine Kirche, seine Untertanen, Edelleute, Soldaten, Künstler und Gelehrte, und zwischen diesen Höfen all und dem päpstlichen eine ewige Flut von Intrigen mit versteckter oder auch offen ausbrechender Feindschaft. Damals war noch mehr als die Hälfte von Europa geistliches Eigentum, lieferte nach Rom seine Abgaben und empfing von dort Befehle. Heute (1859!) ist die Stadt eine Wüste gegen jene Zeiten. Die Paläste stehen leer, die Kardinäle, Leute, die nur in Ausnahmefällen Macht und Ansehen besitzen, fahren in schwerfälligen Karossen durch die Straßen, meist gebrechliche Herren, deren Namen kaum in der Stadt bekannt sind; damals sprengten sie in vollen Waffen mit ihren Leuten zum Vatikan, an ihren Kirchen vorüber, wo sie zur Zeit der Papstwahl öffentlich die silbernen und goldenen Weihgefäße verkaufen ließen, weil sie Geld brauchten, um ihre Freunde und Feinde zu bestechen. Es waren Männer aus den ersten Fürstenfamilien, jung, streitbar und mit glühenden Leidenschaften. Ungeheure Summen hatte der Kardinal Ascanio, Lodovico Sforzas Bruder, darangesetzt, um nach Innozenz' Tode seine Wahl zum Papste durchzusetzen, ebenso der Kardinal Vincula, der wie Ascanio seine eigene Armee ins Feld stellen konnte, so mächtig waren beide, dennoch besiegte sie diesmal Alexander Borgia, der am meisten vermocht hatte und zu der Zeit, wo Michelangelo ankam, Rom beherrschte. Es war der erste Papst, der öffentlich von seinen Kindern sprach; früher war immer nur von Neffen und Nichten die Rede gewesen. Lucrezia Borgia war seine Tochter. Ihrem ersten Manne wurde sie wieder abgekauft, von ihrem zweiten geschieden, ihr dritter vor dem Vatikan selber niedergestoßen, und als er sich dennoch zu erholen drohte, von Cesare Borgia, Lucrezias Bruder, der diesen Überfall eingerichtet hatte, auf seinem Krankenlager erdrosselt.
Dieser Cesare Borgia, der Lieblingssohn Alexanders, war damals fünfundzwanzig Jahre alt, schön von Gestalt und riesenmäßig stark. Auf einem mit Schranken umgebenen Platze vor dem Vatikan tötete er sechs wilde Stiere, gegen die er zu Pferde kämpfte. Dem ersten schlug er auf einen Hieb den Kopf herunter. Ganz Rom staunte. Nicht geringer aber als seine Kraft war seine Wildheit. Messer Pierotto, den Liebling seines Vaters, erstach er unter dessen eigenem Mantel, wohin er sich geflüchtet hatte, daß dem Papste das Blut ins Gesicht spritzte. Alle Morgen fand man in den Straßen vier bis fünf Leichen, darunter Bischöfe und hohe Prälaten. Rom war in Schrecken vor Cesare.
Zu jener Zeit muß er den Herzog von Gandia, seinen Bruder, ermordet haben. Er ließ ihn erdolchen und in die Tiber werfen. Dann teilte er dem Papste selber mit, daß die Tat von ihm ausgegangen sei. Das Oberhaupt der Christenheit, außer sich vor Wut und Schmerz, erscheint im Kollegium der Kardinäle, heult um seinen Sohn, wirft sich seine Verbrechen vor, die er bis dahin begangen hat, und gelobt Besserung. Das hielt vor einige Tage, da war es vorüber, und die Aussöhnung mit Cesare ließ nicht lange auf sich warten. Diese furchtbare Familie war zu sehr auf einander angewiesen, um in sich selbst lange uneins bleiben zu können. Falsch, schamlos, lügnerisch, ohne Treu und Glauben, von unersättlicher Habgier und ruchlosem Ehrgeize, grausam bis zur Barbarei, so zählt Guicciardini des Papstes Laster auf. Ein solcher Charakter scheint unmöglich in unseren Tagen, er fände keinen Raum, um seine Geierflügel völlig auszuspannen, und keine Beute mehr, auf die er stoßen könnte. So völlig aber passen die Borgia in ihre Zeit hinein, daß sie nur dann daraus hervorstechen, wenn wir ihre Eigenschaften aus dem Rahmen dessen, was sie umgab, herausgenommen für sich betrachten. Vertiefen wir uns in die Taten, die von anderen um sie her ausgingen, so erscheinen ihre Verbrechen beinahe ausgeglichen, und wir gewinnen sogar die Freiheit, ihre guten Seiten zu würdigen, das heißt die Kraft, durch die sie die anderen überboten, die vielleicht nur ihrer Schwäche wegen weniger gebrandmarkt dastehen.
»Der Papst ist siebzig Jahre alt«, berichtet der venezianische Gesandte aus jener Zeit, »alle Tage scheint er jünger zu werden, keine Sorge behält er über Nacht im Herzen, er ist heiter von Natur, und was er tut, schlägt ihm zum Vorteil aus.« Alexander hatte einen Riesenkörper, einen durchdringenden Blick für den Sachverhalt der Dinge und für die rechten Mittel, die zum Zwecke führten, auf wunderbare Weise wußte er den Leuten die Überzeugung zu verleihen, er meine es redlich mit ihnen. Ebenso geschickt war Cesare, Lucrezia aber besaß soviel Schönheit und solche Gaben des Geistes, daß sich selbst heute noch Verehrer gefunden haben, die an ihre Verbrechen nicht glauben wollen. Sie berufen sich auf ihre Briefe, ihren Verkehr mit den edelsten Männern Italiens, ihre spätere Laufbahn, wie sie als Herzogin von Ferrara lange Jahre die beste Gattin und Mutter gewesen sei. So sehr überstrahlen die Gaben des Geistes die dunklen Handlungen, denen wir uns schuldig machen. Doch will es uns nicht scheinen, als ob die Verbrechen dieser Familie jemals zu übertünchen wären.
III
Das waren die Menschen, die im Vatikan wohnten, als Michelangelo nach Rom kam. Von Künstlern, die er dort antraf, sind die bedeutendsten zwei Florentiner, Antonio Pollaiuolo, der noch unter Ghiberti an den goldenen Türen mitgearbeitet hatte, und sein jüngerer Bruder Piero, völlig eingebürgert, wohlhabend und willens, ihre Tage in Rom zu beschließen. Piero muß um die Zeit gestorben sein, als Michelangelo ankam; Antonio jedoch, der bedeutendere, lebte noch bis 1498. Er begann als Goldschmied, ward berühmt seiner Zeichnungen wegen, nach denen viele Künstler arbeiteten, bekam selber Lust zu malen, modellierte, bildhauerte und goß in Erz. Nach Papst Sixtus' Tode wurde er vom Kardinal Vincula nach Rom berufen, um ein Grabmonument für ihn auszufahren. Dies geschah 1494. Pollaiuolos umfangreiches Bronzewerk zeigte den Papst lang ausgestreckt auf einem Unterbaue, der mit korinthischem Blätterschmuck meisterhaft umkleidet ist. Nach seiner Vollendung übertrug man ihm die gleiche Arbeit für Innozenz den Achten, der mit Lorenzo dei Medici in einem Jahre verschied und den er in sitzender Gestalt arbeitete. Außerdem sind viele Werke seiner Hand in den römischen kleineren Kirchen zu finden; jene beiden Monumente wurden in der Basilika von Sankt Peter errichtet, wo sie noch zu sehen sind.
Pollaiuolos Stärke war die Strenge der Zeichnung, seine Farbe ist kalt und undurchsichtig. In den Figuren aber liegt ein Zug zum Großen und Einfachen, das sonst den Florentiner Meistern weniger eigen war als denen der umbrischen Malerschule. In San Miniato zu Florenz befand sich ein zehn Ellen hoher heiliger Christoph von seiner Hand, den Michelangelo zu wiederholten Malen kopiert haben soll. Es ist daher wohl anzunehmen, daß er sich jetzt in Rom an Pollaiuolo persönlich anschloß. Dies vielleicht um so mehr, als er mit Cronaca, dessen Schüler und nahem Verwandten, in Florenz bekannt war.
Indessen, wie dem auch sei, die Brüder Pollaiuolo waren nicht die Männer, ihn künstlerisch auf eine höhere Stufe zu heben. Dagegen lernt er in Rom jetzt die Arbeiten zweier Meister kennen, deren Art und Weise weit abliegt von der Auffassung der florentinischen Kunst und deren Werke nicht ohne Einfluß auf ihn bleiben konnten, Mantegna und Melozzo da Forli.
Mantegna gehörte zu den allerersten. Eine Tiefe der Empfindung liegt in seinen Bildern, ein Adel in seinen Linien, daß man sogleich fühlt, er sei kein Mann, der übertroffen oder nachgeahmt werden könne, wohl aber eine Natur, deren belebenden Einfluß jeder empfinden mußte, der von ihr berührt zu werden fähig war. Mantegna lebte in Mantua, wo die Gonzaga seine Gönner waren. Er kam während der achtziger Jahre nach Rom. Die Kapelle, die er für den Papst ausmalte, ist heute nicht mehr vorhanden, aber man darf annehmen, daß diese Arbeit, zu der er eine Reihe von Jahren brauchte, nicht geringer gewesen sei als die übrigen. Während in Florenz die Einwirkung der Antike auf die Kunstanschauung nicht von ersichtlicher Stärke war, sondern die freie Bewegung des Lebendigen, Natürlichen die Quelle blieb, aus der man schöpfte, gestattete Mantegna dem Stil der antiken Meister auffallenden Einfluß, setzte ihrer Kraft aber eine so entschiedene Eigentümlichkeit entgegen, daß auch hier von Nachahmung keine Rede sein kann. Seine Farbengebung ist einfach, beinahe kalt, und ordnet sich durchaus der Zeichnung unter, diese Zeichnung aber läßt die Gestalten so durchdringend zur Erscheinung kommen, daß sie fast eine typische Gewalt empfangen. Man meint, es sei nicht möglich, eine Szene anders aufzufassen, als er getan. Wenn man vor dem vom Kreuze genommenen Christus steht, den wir von seiner Hand in Berlin besitzen, so scheint das Gefühl des grausamsten Todes, der dennoch eine lächelnde himmlische Ruhe zurückließ, erschöpft zu sein durch die Kunst des Meisters, und kein Gedanke bleibt übrig an andere Künstler, denen es besser hätte gelingen können und die noch tiefer in unsere Seele drängen. Mantegna ist befangen in einer gewissen Steifheit, die erst Leonardo und Michelangelo überwanden, von denen beiden dann Raffael die glücklich errungene Freiheit empfing. Das aber verhindert nicht, Mantegna mit jenen drei in eine Reihe zu stellen. Und so wurde auch von Anfang an in Italien geurteilt.
Melozzo da Forli reicht nicht an Mantegna heran in dem, was er leistete, in dem aber, was er leisten wollte, übertrifft er vielleicht alle Künstler vor Michelangelo. Es sind nur wenige von seinen Werken übrig geblieben, und von den größten nur geringe Bruchstücke. Forli, sein Geburtsort, liegt in der Romagna, nicht weit von Urbino, wo Giovanni Santi, Raffaels Vater, lebte. Dieser, ein genauer Freund Melozzos, zeigt dieselben strengen Formen in seinen Bildern, denselben erdigen Ton, der mehr auf Mantegna als auf die Florentiner Schule hinweist. Die Romagna, durch das Gebirge von Toskana getrennt, empfing aus dem Norden größere Anregung als vom Nachbarlande. Forli gehörte dem Grafen Girolamo Riario, dem Neffen des Papstes Sixtus. Durch ihn wurde Melozzo nach Rom gebracht. Die Ernennung zum Maler des Papstes folgte, endlich die Erhebung in den Ritterstand. Dazu ein reiches Gehalt und großartige Aufträge. Es befindet sich ein Bild von ihm im Vatikan, das den Papst umgeben von seinen Neffen darstellt. Es sind dieselben, die mit den Pazzi Lorenzo dei Medici ermorden wollten; gerade in jenen Zeiten malte sie Melozzo. Unter ihnen auch der Kardinal Vincula, jung und unbärtig. Der Papst selber im Profil, ein scharfes, volles Gesicht, der Mann, der den Italienern Respekt einflößte weil er seine Familie so energisch in die Höhe brachte. Das Hauptwerk Melozzos, eine Himmelfahrt Christi, die ehedem die Altarwand der Kirche San Apostoli einnahm, ist heute zerstört, und nur einzelne Stücke, die in der Sakristei von Sankt Peter und im Lateran aufbewahrt werden, gewähren eine Idee der grandiosen Zusammenstellung kolossaler Figuren, aus denen das Gemälde bestand. Diesen Gestalten wüßte ich, was die Kühnheit der Komposition anlangt, nichts Gleichzeitiges an die Seite zu stellen. Denn eine Phantasie, welcher menschliche Körper in so kühnen Verkürzungen vorschwebten, und eine Hand, wie sie der Künstler besaß, der so frei und fest hinzeichnete, was er im Geiste erblickte, finde ich bis dahin bei keinem Maler vereinigt. Dennoch nimmt Melozzo kaum einen Platz in der Kunstgeschichte ein, weil zu geringe Überbleibsel seiner Tätigkeit vorhanden sind; Vasari erwähnt ihn erst in der zweiten Auflage seines Werkes, und auch da beinahe nur um zu sagen, daß er nichts von ihm wisse. Wie mir nach den vorhandenen Resten der Mann vor Augen steht, ist er als Künstler und Charakter gleich groß und verdient die Vergessenheit nicht, in die sein Name hinabsank. Man begreift, daß dieser wilde Papst mit seinen ebenso tollen Neffen (oder Söhnen, wie man will) vor dem Genie Melozzos Respekt hatte und ihn nicht mit Geld allein abfand, wie Pollaiuolo etwa, der bei seinem Tode jeder seiner Töchter fünftausend Dukaten hinterlassen konnte. Wie gering erscheint Pollaiuolo mit aller seiner umfassenden Tätigkeit neben Melozzo, dessen Christus und Apostel emporstiegen, als durchbrechen sie das Kirchendach! Es sind noch eine Anzahl Fragmente von den Engeln erhalten, die wahrscheinlich in vollem Chor den anlangenden Sohn Gottes in den Gewölben empfingen. Sie spielen auf verschiedenen Instrumenten und singen dazu; auch sie beugen sich in schönen Verkürzungen nieder, lauter edle, schöne Mädchengestalten. Zwei erschienen mir besonders reizend. Die eine mit beiden Armen ein Tamburin emporhaltend, das sie schlägt, und mit dem Körper weit zurückgebogen; ein lila Gewand über grünem Unterkleide umfliegt sie in freien, großen Falten; nichts ist gemein natürlich daran, und doch keine Spur leerer, konventioneller Großartigkeit. Die andere sitzt auf dem Gewölk und schaut vorgeneigt in die Tiefe nieder, während sie auf einer Laute spielt. Sie hat braune, stumpf abgerundete Eulenflügel, ganz wie nach der Natur gemalt. Melozzo war schon zwei Jahre tot, als Michelangelo nach Rom kam. Die Neffen des ehemaligen Papstes lagen mit Alexander Borgia und seinen Söhnen im Kriege. Der Kardinal Vincula saß in Ostia, seiner Residenz. Damals kann Michelangelo deshalb noch nicht mit ihm bekannt geworden sein, der später sein berühmter Freund und Beschützer ward.
Sollte aufgezählt werden, was er außer den Werken Mantegnas und Melozzos allein an Arbeiten florentinischer Künstler in Rom fand, so würde das einen langen Katalog füllen. Sie hatten fast sämtlich hier gearbeitet, von Giotto bis auf Ghirlandaio herab, und die Kirchen waren voll von Denkmälern ihrer Tätigkeit; persönlich anwesend aber war gerade keiner. Doch sind wir nicht so genau unterrichtet, um die, welche in Rom zu jenen Zeiten arbeiteten, alle zu kennen. Wir haben auf dem Berliner Museum eine überlebensgroße Porträtbüste Alexander des Sechsten, welche damals entstanden sein muß. Das Werk ist in jeder Beziehung eines großen Meisters würdig, ja von solcher Vortrefflichkeit, daß es für Pollaiuolo zu gut erscheint. Aus Mangel an Nachrichten aber bleibt dieser dennoch der einzige bedeutende Künstler, von dem wir annehmen dürfen, daß er mit Michelangelo zusammentraf.
IV
Der Kardinal di San Giorgio, von dem Michelangelo so gut aufgenommen worden war, gab sich in der Folge trotzdem nicht als den Mann zu erkennen, von dem etwas zu erwarten gewesen wäre. Er ließ zu der Zeit, als Michelangelo in Rom ankam, in der Nähe des Campo del Fiore einen umfangreichen Palast bauen, an dem er ihn leicht hätte beschäftigen können. Dies muß der »neue Bau« sein, von dem im Briefe an Lorenzo dei Medici die Rede ist. Schien der Kardinal anfangs Michelangelo dabei benutzen zu wollen, wie gleichfalls aus dem Briefe hervorgeht, so gab er ihm in der Folge trotzdem keine Aufträge. Auch zog er sich aus der Affäre mit Messer Baldassare auf wenig fürstliche Weise heraus. Er nötigte den Kaufmann, das Geld wieder herzugeben und die Statue zurückzunehmen. Michelangelo hatte erwartet, der Kardinal würde den Baldassare zwingen, ihm den unterschlagenen Rest zu zahlen. Nun war er vielleicht froh, seine dreißig Dukaten behalten zu dürfen. Auch von der lebensgroßen Figur, zu der er gleich in den ersten Tagen Marmor kaufte und die offenbar vom Kardinal bestellt worden war, wird nichts weiter gesagt. Es muß zwischen ihnen beiden irgend etwas vorgefallen sein, was dem Verhältnis einen Stoß gab. Denn Condivi, der nach Michelangelos eigenen Worten schrieb, spricht sich hart über das Benehmen des Kardinals aus, ohne jedoch nähere Angaben zumachen.
Nur in sehr mittelbarer Weise machte sich Michelangelo im Hause San Giorgios geltend. Vasari erzählt, derselbe habe einen Barbier gehabt, der sich aufs Malen gelegt, aber vom Zeichnen nichts verstanden hätte. Diesem habe Michelangelo den Karton zu dem heiligen Franziskus, wie er in der Verzückung die Wundmale empfängt, angefertigt. Varchi lobt das Bild in seiner Leichenrede auf Michelangelo. Lomazzo will den Karton gesehen haben und sagt, es sei ein strahlenausstreuender Serafim mit sechs Flügeln darauf. Da jedoch Condivi darüber schweigt und von Varchi und Lomazzo nicht bekannt ist, ob sie es in Rom selbst gesehen oder nur in Vasaris Buche darüber gelesen haben, so bleibt die Sache ungewiß. Möglich wäre, daß der heute in San Piero in Montorio, wo das Gemälde sich in der ersten Kapelle linker Hand befunden haben soll, sichtbare heilige Franziskus die letzten Reste dieser Malerei unter sich trägt.
Dagegen möchte ich in diese ersten römischen Zeiten eine Arbeit setzen, von der freilich niemand etwas erzählt, die aber unzweifelhaft von Michelangelo geschaffen worden ist und sich allen Merkmalen nach am besten hier einreiht: die Madonna des Nationalmuseums in London, welche, ehe sie an dieser Stelle einen festen Platz erhielt, in den Händen verschiedener Besitzer war, nach denen sie zeitweise genannt worden ist.
Es ist ein Temperabild und unvollendet. Die Komposition zerfällt in drei Teile: in der Mitte die Madonna, rechts und links von ihr je zwei jugendliche Gestalten dicht nebeneinander, Engel wenn man will. Die zur Linken sind nur in Umrissen da, die auf der anderen Seite aber vollendet und von so rührender Schönheit, daß sie zu dem Besten gehören, das Michelangelo hervorgebracht hat. Sei stehen dicht nebeneinander, zwei Knaben zwischen vierzehn und fünfzehn Jahren etwa, der vorn stehende im Profil sichtbar – die ganze Gestalt herab –, der hinter ihm en face; dieser hat seinem Genossen beide Hände auf die Schulter gelegt und blickt mit ihm zugleich auf ein Pergamentblatt, das derselbe mit beiden Händen vor sich hält, als läse er darin, auch hat er den Kopf etwas vorgeneigt und die Augen darauf niedergeheftet. Ein Notenblatt vielleicht, von dem beide singen; die halbgeöffneten Lippen könnten es andeuten. Die nackten Arme, die Hände, die das Blatt halten, von jugendlicher Magerkeit beide, aber mit einer Naturbeobachtung gemalt, die zu loben oder zu beschreiben unmöglich ist, reichten allein hin, um dieser Gestalt den höchsten Wert zu geben. Dazu aber der Kopf, die köstlich schlanke Figur, das leichte Gewand in anliegenden, vielfach geknickten Falten bis über die Knie herab, dann das Knie und das Bein und der Fuß; – es gibt eine Darstellung der Natur, die etwas fast zu Ergreifendes hat, – man fühlt tief im Herzen eine Liebe zu diesem Kinde und möchte die Hand ins Feuer legen, daß es rein und unschuldig sei. Das Gewand des anderen ist dunkel, es liegt ein Schatten über den Augen und im Auge selbst ein ganz anderer Charakter, doch nicht weniger liebenswürdig. Auch das Haar anders, die Locken dichter, dunkler und in Häkchen ausfahrend, während die des ersten sanfter und voller, hinter das Ohr zurückgestrichen, auf dem Nacken liegen.
Die Jungfrau sehen wir ganz von vorn. Ein heller Mantel ist auf der linken Schulter mit den Zipfeln zu einem starken Knoten zusammengebunden, verhüllt den rechten Arm beinahe und ist unten weitfaltig um und über die Knie geschlagen. Auf dem dunklen Haar liegt ein weißer Schleier, doch so, daß es ringsum sichtbar bleibt. Über ihren Schoß hin greift das Jesuskind nach dem Buche, das die Mutter in der Linken haltend ihm entzieht, wobei die Rechte, unter dem Mantel vorkommend, ihr behilflich wird. Es ist, als hätte auch sie selbst im Chor mitgesungen und eben das Blatt umwenden wollen, als das Kind ihr ins Buch griff, das sie leise nach links emporhält. Johannes steht rechts neben dem Jesuskinde mehr im Hintergrunde; ein Tierfell ist um das kleine Körperchen geschlagen, doch fast ohne es irgendwo zu verhüllen. Das Licht kommt von der Linken, dadurch fällt der Schatten, den die Gestalt der heiligen Jungfrau wirft, ein geringes über ihn.
Die beiden nur mit wenigen Linien angedeuteten Gestalten auf der anderen Seite neben der Madonna waren vielleicht Mädchen, im Gegensatze zu den Knaben dort. Von der Farbe kann ich nichts sagen, da ich nur Photographien vor Augen hatte.
Michelangelo hat viel unvollendete Werke hinterlassen. Seine heftige, oft abspringende Natur war schuld daran. Hier vielleicht mögen besondere Umstände mitgewirkt haben, die seinem Gedächtnisse jedoch wie das Bild selbst und die ganze so entfernt liegende Zeit nicht mehr zurückkehrten. Wüßte man, woher die Tafel stammt, so ließe sich möglicherweise dadurch mehr Licht gewinnen.
Michelangelos erste notorische Arbeit, die er in Rom ausgeführt hat, ist seine Statue des trunkenen Bacchus, die Arbeit wohl, an der er im August 1497 beschäftigt war. Er schreibt seinem Vater darüber. Nachdem er im Juli gemeldet, man solle ihn in Florenz nicht sobald zurückerwarten, weil der Kardinal noch immer nicht bezahlen wolle und man bei großen Herren nur allmählich mit seinen Ansprüchen aufkomme, meldet er sieben Wochen später, wie es ihm mit Piero dei Medici gegangen sei. Dieser habe ihm eine Statue in Auftrag gegeben, doch sei nichts daraus geworden, »weil ihm von seiten Pieros nicht gehalten worden sei, was er ihm anfangs zugesagt«, und deshalb, nachdem er obendrein bei dem Marmor Unglück gehabt und Geld verloren habe, arbeite er zu seinem eigenen Vergnügen jetzt an einer Figur.
Ist in der Tat der Bacchus hier gemeint, so fand sich auch ein Abnehmer dafür in der Person des Jacopo Galli, von Condivi ein Gentiluomo Romano »di bello ingegno« genannt, ein gebildeter, vornehmer Mann also. Dieser ließ das Werk für sich ausführen, das heute noch in unversehrtem Zustande erhalten ist, eine lebensgroße Gestalt, von der Michelangelos Zeitgenossen mit Bewunderung reden, während Neuere in diese unbedingte Anerkennung nicht einstimmen wollen.
Es ist kein göttlicher Rausch, von dem wir den Gott durchströmt sehen, kein heiliges Feuer der Trunkenheit, von dessen Gluten umhaucht uns die alten Dichter den die Welt durchziehenden Dionysos erblicken lassen, sondern das Taumeln eines weinerfüllten Menschen, der mit lächelndem Munde und matten Gliedern sich aufrecht zu erhalten strebt. Dennoch aber kein alter dicker Bauch, nichts Aufgeschwemmtes, sondern ein jugendlich schöngebildeter Körper. Mit der Antike verglichen, ein beinahe widerliches Abbild irdischer Schwäche, mit der Natur zusammengehalten, trotzdem das ideale Bild der von Wein erzeugten, zu den Wolken tragenden Fröhlichkeit.
Hören wir Condivi. »In jeder Hinsicht«, schreibt er, »ist dieser Bacchus der Gestalt und dem Ausdrucke nach den Worten der antiken Autoren entsprechend hingestellt. Das Antlitz voll heiterer Seligkeit, den Blick üppig und verlangend, wie bei denen der Fall zu sein pflegt, die den Wein lieben, hält er in der Rechten eine Schale, als wollte er trinken, und sieht sie an, als schlürfte er in Gedanken den Wein schon, dessen Schöpfer er ist. Deshalb trägt seine Stirne auch einen Kranz von Weinlaub. Über dem linken Arm hängt ein Tigerfell, weil ihm der Tiger, der den Wein liebt, heilig war. Mit der Hand hat er eine Traube gefaßt, von der ein kleiner hinter ihm stehender Satyr gewandt und listig die Beeren abnascht. Der Satyr ist wie ein siebenjähriges Kind, der Gott selber wie ein achtzehnjähriger Jüngling.«
Daß Condivi sich nur auf die antiken Schriftsteller und nicht auch auf die antiken Skulpturen beruft, ist ein Zeichen der Unbefangenheit, mit der man selbst in seinen Zeiten noch dem Altertum frei gegenüberstand. Man benutzte, was es darbot, sich aber durch es bestimmen zu lassen, fiel niemand ein. Szenen aus der griechischen Götterwelt wurden ebenso in die neueste Geschichte verlegt, wie dies mit den biblischen Erzählungen geschah. Mars ist ein nackter Florentiner, Venus eine nackte jugendliche Florentinerin, Cupido ein Kind ohne Kleider. Dem Künstler kam es nicht in den Sinn, die Natur, die er vor sich sah, etwa auf antike Muster hin verbessern zu wollen, zu »idealisieren«, wie heute der Handwerksausdruck lautet. Es wäre eine Unnatur gewesen, hätte Michelangelo einen trunkenen Bacchus anders darstellen wollen. Es ist ein vom Wein berauschter, nackter Jüngling. Er ist aufs Feinste ausgearbeitet. Seine Glieder sind rein und tadellos. Immerhin mag man sagen, die Natur des alten Donatello habe hier im jungen Michelangelo gewaltet. Aber wenn das Antlitz der Statue etwas gemein Natürliches an sich hat, so findet das darin seinen Grund, daß er einen silenenhaften Familienzug milde, aber erkenntlich hineinlegen wollte.
Gedenken wir aber noch einmal des schwärmenden Gottes der Griechen, dessen leuchtende Schönheit die empörten Schiffer bändigt und der die Tränen der verlassenen Ariadne trocknet. Durchdrungen von derartigen Anschauungen und befangen außerdem von der Erinnerung an die Werke der griechischen Bildhauer, deren zu Michelangelos Zeiten nur wenige bekannt waren, müssen wir heute uns künstlich erst auf seinen Standpunkt versetzen, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Michelangelos Statue steht heute in der Nationalgalerie in ebenso ungünstigem Lichte wie früher in den Uffizien. Shelley, der große englische Dichter, nennt sie in einem seiner Briefe ein empörendes Mißverständnis des Geistes und der Idee des Bacchus. Betrunken, brutal, albern, sei sie ein Bild der abscheulichsten Völlerei. Die untere Hälfte steif, die Art, wie die Schultern an Hals und Brust ansetzen, unharmonisch; kurz, die zusammenhanglose Phantasie eines Katholiken, der einen Bacchus göttlich habe darstellen wollen.
So ungerecht macht die Unkenntnis der näheren Umstände. Shelley kannte keine einzige der Bedingungen, unter denen dieses Werk entstanden war. Dennoch widerruft er sein Urteil selbst. »Die Arbeit aber, an sich betrachtet, hat Verdienste«, bemerkt er weiter. »Die Arme sind von vollendeter männlicher Schönheit, der Körper ist energisch modelliert, und alle Linien fließen kühn und wahrhaftig empfunden eine in die andere. Als Kunstwerk fehlt ihm nur die Einheit, als Bacchus alles.« Dieser Mangel an Einheit erschien Shelleys Augen gewiß nur deshalb als ein Fehler, weil die Statue am falschen Orte stand. Im Hofe des Palazzo Galli in Rom, wo sie noch zu Condivis Zeiten befindlich war, muß sie von der kühl hinunterströmenden Helligkeit des freien Himmels ganz anders umleuchtet gewesen sein. Der im Berliner Museum aufgestellte Abguß erlaubt, die Arbeit nun auch von der Rückseite zu betrachten. Die Beine und der Rücken zeigen hier eine bewunderungswürdige Feinheit der Ausführung.
Für denselben Galli arbeitete Michelangelo einen Cupido, der, nach fast drei Jahrhunderten des Verstecktseins, im Kensington-Museum wiederaufgetaucht ist, wohin er aus der Sammlung Campana in Rom gelangte. Daß er in dieser vorhanden war und woher er in sie kam, weiß und wußte niemand.
Ich kenne die Arbeit aus einem Gipsabguß sowie aus zwei vorzüglichen Photographien. Mit dem einen Knie auf dem Boden ruhend, stemmt Amor sich mit dem straffen Arme gegen die vordere Lehne des Wagens, auf dem er fährt, während er mit der anderen erhobenen Hand – die freilich heute restauriert ist – die Zügel der Tauben leicht hält, die einst vor dem Wagen vorn als Gespann sichtbar waren. Offenbar war er für einen hohen Standpunkt berechnet und darf deshalb auch im Abgusse nur von unten auf betrachtet werden. Wir haben nichts vor uns in ihm als einen Knaben von acht bis zehn Jahren, mit unendlicher Sorgfalt der Natur nachgebildet. Arme, Rücken, Schulter, Knie: alles flößt Bewunderung ein. Das Fleisch scheint weich, die Muskeln sind wie beweglich, das Momentane der Stellung ist in wunderbarer Kunst wiedergegeben.
V
Steht der Bacchus in unvorteilhaftem Lichte, so ist er doch wenigstens sichtbar. Michelangelos Hauptwerk aber, diejenige Arbeit, durch die er plötzlich aus einem geachteten Künstler zum berühmtesten Bildhauer Italiens ward, ist heute so gut wie verhüllt: die trauernde Maria mit dem toten Sohne im Schoße, »la Pietà«, wie die Italiener eine solche Gruppe nennen. Der Cardinal von San Dionigi, ein Franzose, bestellte sie bei ihm, und Jacopo Galli vermittelte den Auftrag. Im Kontrakte, den wir noch haben, verbürgte sich dieser dafür, Michelangelo werde ein Werk zustande bringen, schöner als irgendein in Rom vorhandenes, und besser als irgendeiner unter den lebenden Bildhauern es herstellen könnte. Selten ist die Schönheit eines anerkannten Meisterwerkes in solchem Maße durch eine ungünstige Aufstellung beeinträchtigt worden. Zuerst in eine Seitenkapelle der alten Basilika von Sankt Peter postiert, erhielt die Statue beim Umbau der Kirche einen anderen Platz und steht jetzt wiederum in einer Seitenkapelle des Sankt Peter so hoch und in so verzwicktem Lichte, daß es nur mit Mühe möglich ist, aus der Nähe oder aus der Ferne ihres Anblickes teilhaftig zu werden. Kopien, welche verschiedene Bildhauer für römische und florentinische Kirchen anfertigten, kommen nicht in Betracht. Es bleibt für die genauere Untersuchung nichts übrig, als sich an Abgüsse zu halten.
Das Material aber ist ein wesentlicher Bestandteil einer Bildhauerarbeit. Holz, Marmor, Bronze bedingen jedes eigentümliche Behandlung. Es kann eine Bronzearbeit nicht mechanisch in Marmor kopiert werden, ohne einen Teil ihres Inhaltes einzubüßen, noch weniger verträgt ein Marmorwerk die mechanische Nachbildung in Metall. Gips aber ist gar kein Material, ein negativer, toter Stoff, der statt der weichen, durchsichtigen, fast bewegten Oberfläche des Marmors nur eine starre, lastende Ruhe gibt. Die ideale Ähnlichkeit mit der menschlichen Haut, deren sanfte, leicht wechselnde Flächen und Linien der schöne Stein anzunehmen befähigt ist, geht beim Gips verloren, und dennoch ist er unentbehrlich, wie die Gelegenheit, bei der er eben so arg geschmäht wird, am besten darlegt.
Was sich bei näherer Betrachtung der Pietà zuerst zeigt, ist die ungemeine Vollendung des Einzelnen, verbunden mit einer wunderbaren Harmonie des Ganzen. Von allen Seiten bietet die Gruppe edle Linien. Die Stellung der beiden Gestalten zueinander ist die hergebrachte, viele Maler haben vor Michelangelo Maria und Christus ähnlich dargestellt. Aber wie sehr übertrifft Michelangelo sie sämtlich. Die Lage des auf den Knien der Frau ruhenden Körpers, die Falten ihres Gewandes, das ein quer über die Brust laufendes Band andrückt, die Neigung des Hauptes, das sich trostlos und so erhaben zu dem Sohne herabneigt, oder das seinige, das tot, erschöpft und mit milden Zügen in ihren Armen ruht: man fühlt, jeder Zug ist zum ersten Male geschaffen von Michelangelo, und das, worin er andere nachahmte in dieser Gruppe, war nur ein allgemeines Eigentum, das er benutzte, weil seine Anwendung hergebracht war. Nur Handwerker und Stümper reden von gestohlenen Ideen. Das geistige Eigentum besteht nicht in dem, was sich einem Meister nehmen läßt, sondern in dem, was ihm niemand rauben kann, und wenn er es selber gestatten wollte. Michelangelo wäre gar nicht imstande gewesen, die Gedanken anderer anzuwenden. Sie würden auf ihm gelastet haben, statt ihn zu fördern.
Unser tiefstes Mitleid wird erweckt durch den Anblick Christi. Die beiden Beine mit matten Füßen daran, die über dem Knie der Mutter seitwärts herabbaumeln, der hängende Arm, der eingeknickte, gesunkene Leib, das vom Halse hinterrücks gefallene Haupt, die Windung des ganzen Manneskörpers, der daliegt, als wäre er durch den Tod wieder zum Kinde geworden, das die Mutter in ihre Arme genommen hat, dabei im Antlitz eine wunderbare Vermischung des althergebrachten byzantinischen Typus, in länglichen Zügen mit geteiltem Barte, und der edelsten Bestandteile des jüdischen Nationalausdruckes: – Keiner vor Michelangelo wäre darauf verfallen; je öfter man das Werk betrachtet, um so rührender wird seine Schönheit; überall die reinste Natur, deren Inneres und Äußeres ineinander gehen. Was vor dieser Arbeit in Italien von Bildhauern geleistet worden ist, tritt in Schatten und nimmt das Ansehen von Versuchen an, denen es irgendwo fehlt, sei es am Gedanken oder in der Ausführung: hier deckt sich beides. Künstler, Werk und Zeitumstände greifen ineinander ein, und es entstand etwas, das vollkommen genannt zu werden verdient. Michelangelo zählte vierundzwanzig Jahre, als er seine Pietà beendete. Er war der erste Meister in Italien, der erste der Welt von nun an, sagt Condivi; ja man ging soweit zu behaupten, sagt er weiter, daß Michelangelo die antiken Meister übertroffen habe.
Wie war es möglich, daß in einer Zeit, wo die Auflösung aller politischen, sittlichen, äußerlich und innerlich religiösen Zustände zu erwarten sind, in Rom, dem Mittelpunkte der Verderbnis, ein Werk wie diese Madonna geschaffen, tief empfunden in ihrer Schönheit, und von einem jener Kardinäle mit teurem Golde bezahlt werden konnte?
Es wurden bei dem Werke damals Fragen aufgebracht, an die heute niemand denken würde. Man fand die Maria zu jung im Verhältnis zum Sohne. Uns stehen beide Gestalten so fern in betreff ihres irdisch-äußerlichen Lebens, daß dergleichen heute kaum auffallen würde, den Italienern aber von damals war die Sache wichtig, und es wurde darüber gestritten. Condivi wandte sich an Michelangelo selbst, und dieser gab ihm die Erklärung, die wir in seinen eigenen Worten niedergeschrieben finden. »Weißt du nicht«, antwortete er mir (sagt Condivi), »daß keusche Frauen sich viel frischer halten als die, welche das nicht sind? Um wieviel mehr aber eine Jungfrau, welcher sich niemals die geringste sündhafte Begierde in die Seele verirrte! Aber noch mehr, wenn eine solche Jugendblüte auf die natürlichste Weise schon in ihr erhalten blieb, so müssen wir glauben, daß die göttliche Kraft ihr noch zu Hilfe kam, damit der Welt die Jungfräulichkeit und unvergängliche Reinheit der Mutter Gottes um so deutlicher erschiene. Nicht so notwendig war das bei dem Sohne; im Gegenteil, gezeigt sollte werden, wie er in Wahrheit menschliche Gestalt annahm und allem ausgesetzt war, was einem sterblichen Manne begegnen kann, die Sünde ausgenommen. So war es hier nicht nötig, das göttliche Teil an ihm vor dem irdischen zu bevorzugen, sondern er mußte in dem Alter dargestellt werden, das dem Laufe der Jahre nach ihm zukam. Deshalb darf es dir nicht wunderbar erscheinen, wenn ich die heiligste Jungfrau und Mutter Gottes im Vergleich zum Sohne viel jünger darstellte, als die Rücksicht auf das gewöhnliche Älterwerden des Menschen verlangt hätte, und daß ich den Sohn in seinem natürlichen Alter ließ.«
Es ist den romanischen Völkern eigen, das Reich der Religion körperlicher zu empfinden, als uns möglich wäre. Bei uns fallen Religion und Sittlichkeit zusammen, bei den Romanen sind es getrennte Gebiete. Das Reich Gottes, das in unserer Seele jeder Gestaltung widerstrebt, ist den Romanen ein über den Wolken gelegenes Reich, ein ideales Abbild menschlichen Treibens enthaltend. Um den Thron Gottes (des sommo Giove, wie ihn Dante nennt) lagern sich die Heiligen in verschiedenen Rangstufen bis hinunter zu den geringeren Seelen, wie um den Papst die Fürsten, der Adel und das niedrige Volk sich scharten. Die Verzückung ist der Weg, der dahinführt. Das Bedürfnis, in diesem paradiesischen Staate einst einen sicheren Platz zu erhalten, ist jedem Romanen angeboren, und die römische Religion enthält die Lehre von seinem Wesen und von den Wegen, die zu ihm hinaufleiten. So ist dem Romanen seine Unsterblichkeit in Bildern bereits vorausgezeigt. Verhüllter, wenn er sie klar bedenkt, sicherer, wenn ihn die von der Phantasie erfüllte Sehnsucht zu ihr auf ihre Flügel nimmt. Er träumt von Glanz und Gold und Edelsteinen, zittert vor einem Meer brennenden Feuers oder badet sich mit vorauseilender Sinnlichkeit in den Sonnenfluten der Erkenntnis. Was besitzen wir Germanen dagegen? Einsam muß da jeder seinen Weg sich selbst suchen. Eine stille Erwartung mit der Gewißheit, nichts zu wissen, aber dennoch keine vergebene Hoffnung auf höheres Dasein gehegt zu haben, ist alles, was an die Stelle jener festen, strahlenden Bilder tritt. Das Heilige zeigt sich uns mehr in Gedanken und Taten, und Christus selber, wenn wir lesen, wie er auf Erden umherging und lebte, tritt uns dennoch nicht mit festem Antlitz und in irdischer Gestalt entgegen, daß wir seine Hände, die Falten seines Gewandes, den Gang seiner Füße in scharfen Linien zu sehen begehrten, sondern wir suchen die Gedanken zu ahnen, die er hegte, und begleiten ihn bis zu seinen letzten Augenblicken. Das äußerliche Bild seiner Qualen ist zu ergreifend beinah, als daß wir seine bildliche Darstellung ertragen könnten.
Bei den Romanen tritt dies Innerliche mehr zurück. In dem Maße, als sie das Körperliche vor Augen sehen, verschwimmen ihnen die Gedanken zu allgemeineren Gefühlen. Bei uns war gerade das Entgegengesetzte der Fall. Und diese Gefühle, die weniger dem, was tagtäglich getan und gedacht wird, entspringen, sondern wie eine ewige höhere Atmosphäre über ihren Herzen schweben, sind ihnen notwendig wie die Luft, die sie atmen. Auch in jenen Zeiten der höchsten Verderbnis mangelten sie nicht. Verworfen war nur die Geistlichkeit, die sich gerade am Ruder befand und die Religion repräsentierte: die Sehnsucht nach dem Reinen, Göttlichen war immer vorhanden, und das Aufhorchen von ganz Italien bei der Stimme Savonarolas beweist am besten, welch ein Drang die Gemüter erfüllte, sich frei zu machen von der Last jener parasitischen Vertreter Gottes auf Erden und zu dem reinen Inhalte des wahren Christentums zurückzukehren.
Ja, es kann behauptet werden, daß jene Zeiten befähigter waren als die unsrigen, die Gestalten und Ereignisse zu begreifen, deren Zusammenhang im Neuen Testamente erzählt wird. Was gehört nicht dazu, um die Verklärung auszudrücken auf dem Antlitze Christi, die dem Kampfe folgte, der seit achtzehn Jahrhunderten die Welt zu Tränen rührt. Man spricht uns heute zuerst davon als Kindern, wo wir nicht wissen können, was Verrat und Verlassenheit, was Leben und Sterben bedeutet. Und auch unser folgendes Leben, selbst wenn wir Schiffbruch leiden, läßt uns nie so offen gegen die Felsen anprallen. Es sind immer nur gemischte Gefühle, die uns bewegen, wenige von uns werden durch persönliches Schicksal auf die Tragödie vom Leiden Christi hingewiesen, die alles erschöpft, dessen unsere Phantasie an Mitleid fähig ist. Zu sterben wie der niedrigste Verbrecher zwischen Verbrechern, verraten zu sein und verleugnet aus der Mitte der nächsten Freunde, endlich selbst zu zweifeln und sich von Gott verlassen zu fühlen, einen Moment lang, und in ihm den Trost entbehren zu müssen, der einzig treu blieb! Und das alles der Lohn wofür? Daß man still und rein seinen Weg verfolgte, den Menschen hilfreich war und keinen beleidigte. Wer geht heute durch Ereignisse hindurch, die ihn einen Abglanz wenigstens dieses furchtbaren Geschickes erleben ließen?
Solche Zeiten waren die Michelangelos aber. Nun erfüllten sich die Prophezeiungen, die Savonarola über sich selbst getan. Er hatte mehr als einmal verkündet, daß seine Laufbahn ihm den Tod bringen müsse. Schritt für Schritt näherte er sich diesem Ausgang, bis er eintraf Und in Rom, wo man die Nachrichten aus Florenz täglich und in den genauesten Einzelheiten erfuhr, waren sie das, was unaufhörlich die Gedanken Michelangelos erfüllen mußte, während er an seiner Pietà beschäftigt war.
Das Jahr 96, in dem er Florenz verließ, war noch ein ruhiges gewesen im Vergleich zu dem folgenden. Die Piagnonen, diesen Namen führte die Partei Savonarolas, hatten das Übergewicht, und weder die Pest und Hungersnot in der Stadt noch der Krieg mit Pisa oder die Drohungen des italienischen Bundes vermochten sie irre zu machen. Sie hofften auf Frankreich, wo man zu einem neuen Feldzuge rüstete. Auch die Herkunft des römischen Königs erschütterte sie nicht.
Der italienische Feldzug Maximilians entsprang einer der romantischen Ideen, welche diesen Fürsten zu Unternehmungen veranlaßten, aus denen nichts wurde. Er hatte Lodovico Sforza als Herzog von Mailand anerkannt und belehnt, nachdem der junge Visconti, an dessen Leben der Besitz hing, endlich zugrunde gegangen war. Lodovico, der auf alle Weise Pisa wiederzugewinnen suchte und sich gegen die Venezianer, die denselben Zweck verfolgten, beide einstweilen vereint gegen Florenz, nicht stark genug fühlte, wollte Max in seinem Interesse benutzen und wußte ihm klar zu machen, daß ein Zug nach Italien die großartigsten Folgen haben müßte. Pisa und Florenz wären alte kaiserliche Lehen; käme er, so würde er zu entscheiden haben. Die Verbündeten würden sich natürlicherweise seinem Worte unterordnen und auch Florenz sich ihm fügen, und so, indem er durch die Schlichtung der wichtigsten Streitigkeit seine eigene Autorität stärke, verhelfe er ihm, seinem treuesten Bundesgenossen, zum Besitze Pisas, das in anderen Händen nur ein Machtzuwachs seiner Feinde sei. Max hatte weder Geld noch Truppen, beides stellte ihm Lodovico in Aussicht. So erschien er dann und segelte von Genua auf Livorno los, das die Florentiner hielten. Der Erfolg entsprach seinen Erwartungen nicht. Die Venezianer, statt sich zu fügen, schickten frische Truppen nach Pisa, die Florentiner wiesen ihn absolut zurück, und er mußte, wie er gekommen war, nach Deutschland wieder abziehen.
Als man aber in Florenz erfuhr, daß des Königs von Frankreich neuer Kriegszug sich ins Ungewisse hinausziehe, als die Getreideschiffe der florentinischen Kaufleute, die aus der Provence anlangten, dicht vor Livorno weggefangen oder zurückgescheucht wurden und die Pest zunahm, traten die Parteien immer schärfer sich entgegen. Es gab deren drei in der Stadt: die Freunde der Medici, die Feinde Savonarolas, und seine Anhänger. Die ersteren, nach dem Wappen der Medici, das aus einer Anzahl Kugeln, palle, bestand, die Pallesken genannt. Die Gegner Savonarolas, die Arrabiati, das heißt die Wütenden, er selbst hatte ihnen den Namen gegeben. Die Piagnonen aber überboten beide. Ihre Prozessionen erfüllten die Stadt, ihre Gebete und die Predigten ihres Führers waren die Hauptwaffen, mit denen sie siegten. Er aber herrschte, und alles befestigte nur seine Macht und sein Ansehen. Als die Anerbietungen des italienischen Bundes immer lockender und die Aussicht auf das Kommen der französischen Armee immer unsicherer wurden, hielt er an der Hoffnung fest und bestand auf seinem Willen. Mitten in der Hungersnot, die die Stadt und Umgegend überdeckte, daß die Landleute in Scharen hereinkamen und halbtot vor Erschöpfung in den Straßen lagen, organisierte er die Wohltätigkeit der Seinigen. Die Karnevalsumzüge, wo die Kinder mit Blumenkränzen, in weißen Kleidern und mit roten Kreuzen in den Händen Gaben sammelten, schlossen mit einer Verteilung an die verschämten Armen. Einmal, als die Not am größten war, im Jahre 96, ließ er eine ungeheure Prozession veranstalten, und gerade, als alle Straßen voll von Menschen sind, kommt ein Kurier durch das Tor gesprengt mit der Nachricht, daß eins der erwarteten Getreideschiffe angelangt sei. Es hat etwas Rührendes zu lesen, wie der Reiter, einen grünen Zweig hoch in der Hand haltend, durch das begeisterte Gedränge sich durcharbeitet über die Arnobrücke das Ufer entlang zum Palaste der Regierung. Solche augenscheinliche Wunder erhöhten die Macht Savonarolas ins Unbegrenzte. Es findet sich aber keine Spur, daß er sie mißbraucht hätte.
Zu Weihnachten 1496 versammelte er mehr als dreizehnhundert Knaben und Mädchen bis zu achtzehn Jahren in Santa Maria del Fiore und ließ sie kommunizieren. Die Frömmigkeit der Kinder mitten in der drohenden Zeit rührte das Volk, das sie umgab, so, daß es in laute Tränen ausbrach. Der Karneval 97 brachte eine Wiederholung der geistlichen Spiele des vorigen Jahres. Abermals eine Pyramide, aus Gegenständen der Verdammnis aufgebaut in lichten Flammen und eine Segnung der Häuser, aus denen man dazu beigesteuert, abermals Tänze, Absingen geistlicher Lieder und das Geschrei: viva Cristo il rè di Firenze! viva Maria la regina! Zu Zeiten aber wurde dies Geschrei Savonarola selber zu viel, und er warnte von der Kanzel gegen den Mißbrauch der heiligen Worte.
Die Begeisterung, die er erregte, hatte ihre ziemlich nüchternen Seiten. Wenn wir von den Tänzen hören und die Lieder ansehen, die zu diesen Festen der höheren Tollheit, maggior pazzia, wie er es selber nannte, gedichtet wurden, wenn wir uns vorstellen, wie Jung und Alt dahineingezogen ward, wie er die Kinder gegen ihre unfrommen Eltern aufhetzte, sie zu einer öffentlichen Sittenwache gestaltete, daß sie die Leute auf der Straße anreden und in die Häuser eindringen durften, wie Gebet und Gesang das Leben des Tages unaufhörlich unterbrechen, so scheint alles auf den Kopf gestellt und die Herrschaft krankhafter Ideen durchgeführt, deren Steigerung zur Verrücktheit führen muß; genauer betrachtet aber stellen sich die Dinge anders dar. Die Grundlage seiner Lehre ist keine puritanische Moral, sondern die Bekämpfung des Lasters und Aufrechthaltung der öffentlichen Sittlichkeit, wie sie etwa heute bei uns überall ohne Widerspruch durchgeführt wird. Nirgends verlangt er Außerordentliches von den Leuten, aber freilich war das öffentliche Leben der Art, daß den Florentinern Beschränkungen, die uns natürlich erscheinen, unerträglich dünkten. Seine Anweisungen, wie man den Tag zu beginnen und seine Geschäfte zu betreiben habe, wie man im Hause und auf der Straße auf den Anstand achten solle, sind kaum der Rede wert; wo sie seltsam erscheinen, liegt dies mehr in den allgemeinen Sitten der Zeit als darin, daß unerhörte neue Dinge von ihm ersonnen werden. Nirgends tritt er kategorisch befehlend auf, sondern die Abscheulichkeit der Laster und der übermäßigen Leidenschaften erklärt er logisch aus sich selbst. Nirgends gibt er pedantische Normen, sondern appelliert an die eigene Einsicht der Zuhörer. Er wettert gegen seine Feinde und fordert auf, sich gegen sie zu kehren wie er selber tue, aber es läßt sich kein Wort nachweisen, womit er zur Gewalt gegen sie aufgereizt. Ja, es geht aus seinen Predigten hervor, daß er auch in den Zeiten, wo er wirklich alles vermochte, keinen Zwang ausübte. Wenn er ehrbare Frauen immer wieder ermahnt, sich züchtig anzuziehen und auf der Straße den Dirnen und Kurtisanen nicht aus dem Wege zu weichen, sondern sie stolz und furchtlos zur Seite zu drängen, so sieht man schon daraus, wie wenig er die Üppigkeit in Florenz zu überwältigen vermochte, denn diese Aufforderung finden wir ununterbrochen in seinen Predigten, ein Zeichen, daß die Dirnen sich nicht abhalten ließen, auf den Straßen eine Rolle zu spielen.
So auch der Kampf der Parteien gegeneinander, der im Consiglio grande unablässig auf- und abwogte. Er zeigt, wie frei man sich bewegte und wie vorsichtig die Piagnonen trotz ihrer Übermacht sich von einem feindlichen Zusammenstoße zurückhielten. Sogar die Tänze haben etwas Natürliches. Es war eine alte Vorstellung, sich die ewige Seligkeit als einen Tanz zu denken. Fiesole malt die Freuden des Paradieses in Gestalt von Tänzen der Engel, die abwechselnd mit frommen Mönchen Hand in Hand lange Ketten bilden und singend emporschweben. Dies war die Idee der Aufzüge, zu denen Savonarola in den Sitten der Stadt eine Aufforderung fand. Wenn er in früheren, stilleren Zeiten als Prior seines Klosters mit den Mönchen hinaus ins Freie gezogen war und sie im Walde sitzend zuerst über theologische Dinge gelehrter Weise disputiert und seine Worte gehört hatten, ließ er sie nach beendigten Übungen einen Tanz ausführen. Endlich die gesungenen Lieder mit ihren seltsamen Worten dürfen nicht nach gemeinem Sinne genommen werden, sie hegen einen tieferen mystischen Inhalt, wie er gleichfalls den damaligen theologischen Anschauungen natürlich war.
Gerade diese Zurückhaltung der Piagnonen machte den Arrabiaten eine immer wirksamere Opposition möglich. Man arbeitete von Florenz aus in Rom darauf hin, Savonarola das Handwerk legen zu lassen. Ende 96 war die dritte Ermahnung vom Papste eingetroffen, sich des Predigens zu enthalten. Savonarola hatte sie schriftlich beantwortet und sich eine Zeitlang still gehalten, dann aber auf Bitten der florentinischen Regierung trotz dem Papste die Kanzel aufs neue bestiegen. Vielleicht hätte er die Sache durchsetzen können, denn man fühlte in Rom zu tief die Notwendigkeit einer Reform und wollte zugleich die Florentiner durch Nachgeben herüberziehen. Wir haben einen Brief Michelangelos an seinen Bruder Buonarroto, der die gerade in jenen Tagen in Rom herrschende Stimmung beschreibt. Alle Welt spreche dort von Savonarola und erkläre ihn für einen stinkenden Ketzer. Am besten würde sein, wenn er in Person erscheinen und als Prophet auftreten wolle: man werde ihn dann zum Heiligen machen. Freilich schimpfe Fra Mariano auf ihn, und es seien neulich erst fünf Ketzer gehangen worden, aber er möge nur den Mut nicht verlieren. Aus dem Schreiben klingt recht heraus, daß die Anhänger Savonarolas damals noch obenauf waren und den Mut nicht verloren hatten. Savonarola aber tat jetzt nach anderer Seite hin etwas Entscheidendes. Er begann sich tiefer in die Verfassungsverhältnisse der Stadt einzumischen, seine Partei beging Fehler auf diesem Gebiete und trug selber zu seinem Sturze bei.
Die Vereinigung der Arrabiaten und Pallesken war allmählich eine so vollständige geworden, daß sie im Consiglio grande die Majorität bildeten. Aus dem Schoße des Consiglio aber wurden die Staatsämter besetzt, und die Majorität gab den Ausschlag. Bisher hatten die Pallesken mit den Piagnonen zusammengestimmt, weil sie unter einer Signorie von Piagnonen besser für die Medici wühlen konnten als unter den Arrabiaten, die sich energisch nach beiden Seiten hin kehrten und die Freiheit ohne Savonarola, aber auch ohne die Medici, verlangten. Die Piagnonen dagegen mußten zum Danke für die geleistete Hilfe stets einige von den Pallesken in die Signorie hineinlassen, und hierauf hatte Piero dei Medici seine Pläne gebaut.
Die Piagnonen wußten das. Sie wollten nun keine Pallesken mehr in der Signorie haben. Die Arrabiaten, deren Wut gegen Savonarola täglich wuchs, machten den Pallesken Konzessionen, und so kam es zu gemeinschaftlichem Handeln der beiden gegen das Zentrum.
Die Piagnonen sahen sich in der Minorität und sannen darauf, sich zu verstärken. Francesco Valori, der für Januar und Februar 97 Gonfalonier war, setzte eine Verfassungsänderung durch, die seiner Partei das verlorene Übergewicht einbringen sollte. Valori stand in so enger Verbindung mit Savonarola, daß anzunehmen ist, von diesem sei der Plan erdacht oder wenigstens gutgeheißen worden.
Bisher war ein Alter von dreißig Jahren erforderlich gewesen, um Eintritt in das Consiglio zu erlangen. Von jetzt ab sollte das zurückgelegte vierundzwanzigste genügen. Savonarola zählt auf die begeisterte Jugend, auf die jungen Männer, welche ihn als Kinder gehört, und auf die Kinder, welche ihn noch hörten und rasch heranwuchsen.
Um den Vorschlag durchzubringen, hatten sich die Pallesken noch einmal zur Verbindung mit den Piagnonen bereitfinden lassen, verlangten dafür aber, sich in die Signorie für März und April in bedeutendem Maße gewählt zu sehen. Sie hatten ihre geheimen Pläne. Die Hungersnot hielt die Stadt in Aufregung; am 10. März wurde der Markt vom gemeinen Volk gestürmt; die Massen waren den Medici immer günstig gewesen, und die Pallesken taten das ihrige, um das Andenken an die alten, milden Herren nicht einschlafen zu lassen.
Um ja nicht den mindesten Verdacht zu erregen, befürwortete die Regierung dem Papste gegenüber die Sache Savonarolas. Im stillen verhandelten sie mit Piero. Geheime Boten gingen hin und her mit Briefen. Es wurde festgesetzt, wenn er vor der Stadt eintreffen solle, wenn er die Tore offen finden würde. Die Orsini hatten die nötigen Truppen aufgebracht. An einem Festtage, wenn jedermann auf dem Lande wäre, sollte der Überfall ausgeführt werden. Am 28. April geschah es. Piero erschien mit seinen Reitern vor dem Tore San Piero di Gattolini; sperrweit standen die Flügel offen, und er konnte die Straße entlang bis tief in die Stadt sehen, die niemand verteidigte. Vier Stunden aber stand er so und wagte sie nicht zu betreten, denn keine Seele regte sich zu seinen Gunsten.
Derweilen hatte man drinnen Zeit gehabt, sich zu fassen. Die Signorie war schon vorher verdächtig erschienen, jetzt hielt man die Herren im Palaste fest, schloß die Tore der Stadt und fuhr Kanonen auf. Piero machte kehrt mit seinen Reitern und kam abends in Siena wieder an, wie er früh morgens ausgeritten war. Gegen die Signoren hatte man in Florenz keine Beweise in der Hand. Ihre Amtszeit war abgelaufen, sie traten ab und die gesetzlichen Nachfolger an ihre Stelle. Diesmal aber waren es die Arrabiaten, die ans Ruder kamen!
Valoris Maßregel war schuld daran. Die neuen jugendlichen Mitglieder des Consiglio hatten zum ersten Male mitgestimmt. Statt jedoch für Savonarola entflammt zu sein, offenbarten sie eine ganz andere Gesinnung. Junge Männer sind keine Kinder mehr. Bis dahin hatten sie die Abbestellung des alten fröhlichen Lebens still ertragen müssen, jetzt besaßen sie Stimme, Macht und Einfluß, und indem sie mit klingendem Spiel in das feindliche Lager einzogen, bewirkten sie, daß mit einem Male die Situation umschlug, und während von den früheren Regierungen alles für Savonarola geschehen war, nun nichts versäumt wurde, wodurch man ihn unterdrücken zu können vermeinte. Pasquille und Sportgedichte gegen ihn tauchten auf. In Rom, wo der florentinische Gesandte bisher auf das künstlichste die beabsichtigte Exkommunikation aufzuhalten gewußt hatte, trafen plötzlich entgegengesetzt lautende Instruktionen ein. Fra Mariano da Genazzano, der einst in Lorenzos Auftrage gegen Savonarola gepredigt hatte und kürzlich aus Florenz verwiesen worden war, weil er den verunglückten Aufstand zu Gunsten Pieros vorbereiten half, drängte im Vatikan zu entscheidenden Maßregeln. Die Franziskaner- und Augustinermönche in Florenz, die alten Feinde der Dominikaner, erhoben sich mit ungewohnter Kühnheit, und bald kam es so weit in der Stadt, daß Savonarolas persönliche Sicherheit gefährdet schien.
Unter den vornehmen, jüngeren Leuten der Florentiner Bürgerschaft bildete sich eine Verbindung, die Genossen, gli compagnacci, genannt. Ihr Zweck war, den alten Florentiner Straßenunfug wieder herzustellen. Am 1. Mai war die neue Signorie eingetreten, und am dritten bereits, als Savonarola im Dome predigte, kam es durch die Compagnacci zu öffentlichem Skandal. Er wollte die Kanzel besteigen und fand sie mit einer Eselshaut behangen und mit Unrat beschmutzt. Man entfernte das, die Predigt begann, mittendrin brach ein höllischer Lärm aus; Savonarola mußte aufhören. Umgeben von seinen Anhängern, die bewaffnet mit ihm zogen, kehrte er nach San Marco zurück, und in derselben imponierenden Begleitung erschien er tags darauf im Dome wieder, wo diesmal die Ruhe nicht gestört wurde.
Am 12. Mai unterzeichnete Alexander Borgia die Exkommunikation. Die Nachsicht sei erschöpft, Savonarolas Ausstoßung solle öffentlich bekannt gemacht und ihm das Predigen mit Gewalt unmöglich gemacht werden. Aber der Kommissar des Papstes wagte es nicht, die Exkommunikation persönlich nach Florenz zu bringen; von Siena aus ließ er sie der Signorie einhändigen, die sie gleichfalls öffentlich anzuschlagen nicht den Mut besaß. Sie entschuldigte sich damit, daß man sie ihr nicht direkt, sondern durch zweite Hand habe zukommen lassen. Dagegen erklärten die Augustiner und Franziskaner, sie würden sich an der großen Prozession des Sankt Johannisfestes nicht beteiligen, wenn die Dominikaner zugelassen würden. Man deutete deshalb diesen an, sich an jenem Tage zu Hause zu halten.
Savonarola aber, nachdem der Schlag endlich gefallen war, fühlte sich nun aller Fesseln frei und ledig. Auf die Bannbulle des Papstes erließ er eine Antwort, worin er Fra Mariano, den geistigen Urheber dieses Verdammungsbriefes, als einen Menschen darstellt, der gegen den Papst selber die schändlichsten Dinge aussagt und verräterisch gegen ihn gehandelt habe. In einem offenen Briefe, der an alle Christen gerichtet ist, verwahrt er sich gegen den Vorwurf, ketzerische Dinge gepredigt und dem Papste und der Kirche den Gehorsam verweigert zu haben. Die Exkommunikation sei ungültig. Nur dann dürfe man seinen Oberen gehorchen, wenn ihre Befehle nicht gegen Gottes Wort verstoßen.
Damit aber sagte er sich allerdings vom Gehorsam los. Um jedoch den Beweis dafür zu geben, wie notwendig seine Handlungsweise sei, donnerte er nun gegen die Laster Roms mit einer Schärfe und Offenherzigkeit, gegen die seine früheren Predigten nur verblümte Andeutungen erscheinen. Und ihm zur Seite versuchten seine literarischen Freunde die Kompetenz des Papstes in Frage zu stellen.
Mai und Juni gingen hin. Die Arrabiaten hatten trotz ihrer Energie nichts Entscheidendes bewirken können. Die Pallesken lösten sich wieder los von ihnen und schufen vereinigt mit den Piagnonen für Juli und August eine Signorie, die sogleich alles rückgängig machte, was die Arrabiaten vor sich gebracht. In Rom wurde das Unmögliche aufgeboten, eine Rücknahme der Kirchenstrafe zu erwirken. Einflußreiche Kardinäle verwandten sich in diesem Sinne. Die Dominikaner von San Marco verfaßten eine Verteidigungsschrift, die mit einer langen Liste beistimmender Unterschriften versehen nach Rom abging.
Borgia aber hatte seine eigene Methode. Er bestand darauf, Savonarola solle sich persönlich stellen. Entschuldige er sich hinreichend, so werde er ihn mit seinem Segen entlassen; werde er schuldig befunden, so wolle er ihn gerecht, aber barmherzig bestrafen. Jedermann aber wußte, was Segen und Barmherzigkeit hier zu bedeuten hatten. Einfacher war das Mittel, das der Kardinal Piccolomini vorschlug. Fünftausend Goldgulden würden den Papst umstimmen, meinte er. Die Summe hätte sich leicht aufbringen lassen. Savonarola schlug das aus, wie er früher den Kardinalshut ausgeschlagen, mit dem sein Stillschweigen erkauft werden sollte.
So unterhandelte man zwischen Rom und Florenz, als hier plötzlich Geheimnisse zutage kamen, welche den Streit der Parteien zur Wut aufstachelten. Die Verschwörung, durch welche Piero im April sich der Stadt hatte bemächtigen wollen, wurde entdeckt. Es stellte sich heraus, daß die Signorie für März und April den Umsturz der Dinge vorbereitet hatte, und das Ärgste, daß für Mitte August eine neue Erhebung zugunsten der Medici in Vorbereitung war.
Fünf Männer von den ersten Familien, darunter der ehemalige Gonfalonier, wurden eingezogen und nach rascher Verhandlung zum Tode verurteilt. Der Plan lag offen da, die Schuld war nicht abzuleugnen. Alles wurde verraten, nicht nur der verabredete Tag, sondern die Liste der Familien, deren Häuser und Paläste der Zerstörung des niederen Volkes preisgegeben werden sollten. Noch mehr, zwei von den Verurteilten, Gianozzo Pucci und Lorenzo Tornabuoni, die bis dahin als die gläubigsten Anhänger Savonarolas aufgetreten waren, hatten, wie nun zum Vorschein kam, diese Maske angenommen, um sich in die Beratungen der Piagnonen einzudrängen und ihre Geheimnisse zu besitzen. Denen war zumute, als hätten sie auf einem Vulkan geruht. Um sich zu rächen, brauchten sie nur Gerechtigkeit fordern.
Aber den Verurteilten stand ein Ausweg offen: die Appellation an das Consiglio grande. Valori hatte diese Berufung selbst eingeführt. Jetzt trat zum zweiten Male der Fall ein, daß Institute, die seine Partei zu ihren eigenen Gunsten gemacht hatte, von entgegengesetzter Wirkung waren. Die Tornabuoni, Pucci, Cambi, Ridolfi gehörten zu den ersten Häusern der Stadt und konnten auf ihren Anhang im Volke rechnen. Bernardo del Nero, der hochverrätische Gonfalonier, ein ehrwürdiger, die aus alter Freundschaft und Dankbarkeit erwachsene Anhänglichkeit an die Medici ausgenommen, rein und unbescholten dastehender Mann von fünfundsiebzig Jahren, hatte nicht vergebens das Mitleid der Bürger angesprochen, zu welcher Partei sie auch gehören mochten.
Die Signorie war in der schwierigsten Lage. Die Freisprechung der Angeklagten durch das Consiglio grande hätte die Piagnonen dahin gebracht, sich in Waffen zu erheben, um die Rache zu vollziehen, welche die Regierung verweigerte. Die Appellation aber nicht zu gestatten, war gegen das Gesetz. In Rom, in Mailand, in Frankreich boten die Medici alle Kräfte auf, um ein Interesse für die Opfer ihrer Politik heraufzubeschwören. Francesco Valori jedoch machte jeden Rettungsversuch zunichte. Sein Haus war unter denen gewesen, die gestürmt und geplündert werden sollten. Giovio behauptet, der brennende Haß dieses Mannes gegen Bernardo del Nero habe den Ausschlag gegeben. Die übrigen vier wären seine Freunde gewesen, aber um diesen einen zu treffen, habe er sie mitgeopfert. Nach den heftigsten Szenen im Schoße der Regierung gab diese die Erklärung ab, daß die höhere Rücksicht auf das Wohl des Staates die Suspension des Gesetzes für den vorliegenden Fall notwendig mache, und die Fünfe wurden vom Leben zum Tode gebracht.
Ob Savonarola diese Tat herbeiführte oder ob er sie verhindern konnte, seinen Einfluß jedoch geltend zu machen unterließ, ist nicht festzustellen. Sicher ist nur, daß man schwankte und daß Valoris Energie den Ausschlag gab. Er, als eifrigster Anhänger Savonarolas, wälzt auf diesen eine höhere Verantwortung. Es liegt das in der Natur der Sache und so wurde geurteilt. Savonarola erschien als der Urheber des Entschlusses, und seine Schuld strahlte zurück über die Sekte der Piagnonen. Sie hatten das Gesetz gemacht, sie es umgangen. Es gab keine schwerere Anklage in dem auf Beobachtung der Gesetze so peinlich gerichteten Kaufmannsstaate. Ein Vorwurf ließ sich erheben von nun an, der nicht zurückzuweisen war. Mochten die Verhältnisse noch so zwingend gewesen sein, das Gesetz war mißachtet worden. Von diesem Momente an, sagt Machiavelli, ging es abwärts mit Savonarola.
Dennoch blieb die Regierung bis zum März 98 im Besitze seiner Anhänger. Zu Rom dieselben Verhältnisse. Der Papst verlangt persönliches Erscheinen, Savonarola antwortet mit Briefen und Büchern. Die Geistlichkeit von Santa Maria del Fiore, der Erzbischof voran, wollen nicht dulden, daß ein Exkommunizierter ihre Kanzel besteige, die Regierung beseitigt ihren Widerspruch. Der Andrang des Volkes war ungeheuer, wenn Savonarola predigte. Der Karneval wurde zum dritten Male nach dem Ritus gefeiert, den er vorgeschrieben, niemals erschien die Macht des Mannes so groß als in diesen Tagen, und doch standen die so nahe bevor, die die letzten seines Wirkens und seines Lebens werden sollten.
VI
Ich finde, wo von Savonarola die Rede ist, seinen Untergang zu sehr als das Resultat der Bemühungen seiner Feinde und des päpstlichen Zornes dargestellt. Die zwingendste Ursache seines Falles war das Erlöschen seiner persönlichen Gewalt. Das Volk ermüdete. Er mußte stärker und stärker auf die Geister einwirken. Es gelang eine Zeitlang, die einschlafende Begeisterung wieder emporzureizen. Aber während sie nach außen hin sogar zu wachsen schien, zehrte sie doch von ihren letzten Kräften. Savonarola kam auf den Punkt, wo er übermenschlich stark hätte sein müssen, um sich ferner zu behaupten.
Die großen Familien der Stadt gehörten von Anfang an zu den Anhängern der Medici oder doch zu Savonarolas systematischen Gegnern, den Arrabiaten; nur wenige hielten sich zu den Piagnonen, solche, die ebensosehr der Ehrgeiz als die innige Überzeugung auf Savonarolas Seite stellten. Seit der Einführung des Consiglio grande, in welchem jeder Bürger, arm oder reich, seine eine Stimme hatte, empfand der Adel tagtäglich, wieviel er bei der Neugestaltung des Staates verloren. Niedrige Persönlichkeiten, Handwerker, die aus ihrer Werkstatt kamen, gelangten durch die Stimmenmehrheit ihrer Partei zu den höchsten Staatsämtern. Die Strenge, mit welcher die Luxusgesetze durchgeführt wurden, erschien wie eine Rache der weniger Begüterten gegen die Reichen. Diesen Anschein einer Rache nahm auch die Hinrichtung der fünf Verschworenen an: es sollte auf eklatante Weise gezeigt werden, daß sie durch ihren Rang und ihr Vermögen nicht geschützt seien. Immer mehr mischten sich solche Gefühle mit der zuerst rein religiösen Begeisterung. Man war für Savonarola, aber man war auch für Valori und für die anderen, die neben ihm von oben herab die Menge leiteten. Und so hatten also doch wieder einige wenige vornehme Familien durch Savonarola die Führung des Staates usurpiert und die geringeren nach sich gezogen.
Nach außen hin kam man nicht vorwärts. Pisa blieb verloren; Karl der Achte kehrte nicht zurück; mit dem Papste war kein Übereinkommen zu treffen. Hungersnot und Pest hatten die Stadt stark angegriffen, der Handel konnte die dauernde Unsicherheit nicht länger tragen. Es zogen sich die Wolken zusammen gegen Savonarola wie gegen Piero einst, und das Gefühl machte sich geltend, daß der allgemeine Zustand nicht der richtige sei.
Savonarola überblickte die Lage der Dinge. Er hatte seinen Untergang vorausgewußt und verkündet, aber er war nicht willens, ohne Kampf zu weichen. Die Opposition in Florenz konnte er bewältigen, seine Feinde im Vatikan aber blieben unverwundbar, solange der Papst nicht selber beiseite geschafft worden war; ihn mußte er treffen. In energischen Sendschreiben an die höchsten Fürsten der Christenheit: den Kaiser und die Könige von England, Spanien und Frankreich forderte er, mit Berufung auf die anerkannte Verworfenheit Borgias und die Notwendigkeit einer Reform des Kirchenregimentes, die Konstituierung eines Konzils, auf welchem der Papst gerichtet und abgesetzt würde. Einen dieser Briefe, den an Karl den Achten gerichteten, fing Lodovico Sforza auf und ließ ihn in den Vatikan gelangen.
Die scharfen Predigten Savonarolas hatten dem Papst keine Unruhe verursacht bis dahin. Borgia kümmerte sich wenig darum, seine Taten zu verbergen, oder um das, was darüber geurteilt wurde. Großartigere Dinge hatte er im Sinne als den Streit mit diesem Prior von San Marco. Ein Konzil aber war die wunde Stelle seiner Macht, das einzige was die Päpste fürchteten. Denn die Anschauung behauptete sich damals noch als die herrschende, daß die versammelten Kardinäle den Papst zur Verantwortung ziehen und absetzen könnten.
Alexander forderte die Regierung von Florenz kategorisch auf, Savonarola das Predigen zu untersagen und ihn nach Rom auszuliefern. Keiner schriftlichen Rechtfertigung, sondern tatsächlichem Gehorsam sehe er entgegen. Er werde die Stadt mit dem Interdikt belegen im Weigerungsfalle. Savonarola predigte von jetzt an im Dome nicht weiter, in der Kirche seines Klosters aber um so heftiger. Dies geschah in den ersten Tagen des März 98. Er drang von der Kanzel herab auf die Berufung des Konzils. Wütend erließ der Papst eine erneuerte Aufforderung nach Florenz, er werde es die florentinischen Kaufleute in Rom büßen lassen! – aber die neue Signorie, obgleich ihrer Majorität nach aus Arrabiaten gebildet, wagte nicht sogleich einzuschreiten. Nach stürmischen Beratungen wurde Savonarola dann aber dennoch auch das Predigen im Kloster verboten. Mehr wagte man nicht gegen ihn. Am 18. März predigte er zum letzten Male, und indem er dem Papste, der römischen Wirtschaft und den Florentinern das Eintreffen göttlicher Strafen voraussagte, nahm er, bewegt zu gleicher Zeit von der Ahnung seines baldigen Unterganges, Abschied von der Gemeinde.
Liest man diese letzten Predigten, so kann man nicht anders, als den Mann bewundern, der inmitten einer Wüste unklarer Leidenschaften die reine Straße seiner Überzeugungen wandelnd sich freiwillig zum Opfer für seine Lehren hingibt. Er hätte noch immer das Volk zur Wut bringen und einen Kampf heraufbeschwören können, dessen Ausgang zweifelhaft gewesen wäre. Doch er verschmähte andere Waffen als die, welche in der Seele des Menschen liegen. Er wollte nur aussprechen, was ihm klar vorstand. Mochte dann daraus werden, was gut war. Immer blieben seine politischen Ansichten deutlich und einfach. Intrige und Eigennutz kannte er nicht. Seinen Bruder, der durch seine Fürsprache Karriere zu machen wünschte, wies er ab. Die einfachste Lebensart führte er. Ein Ton der Wahrhaftigkeit klingt aus seinen Worten, deren herzgewinnende Macht heute noch auf traurig seltsame Weise anlockt und versöhnend das Widerstreben, das wir empfinden, in Bedauern auflöst.
Man begreift die Täuschung so sehr, der er sich hingab. Zuerst begeisterte er das Volk, das er mit der Ahnung eines edleren Daseins erfüllte. Er vergaß, daß die menschliche Natur nur zu vorübergehenden Augenblicken des Aufschwunges befähigt ist, daß diese Momente sich vielleicht verlängern und einige Zeit festhalten lassen – er aber wollte ihr plötzliches Aufflammen in dauernde Gluten verwandeln, er schürte, er goß den Florentinern sein eigenes Feuer in die Adern, das ihn selber doch verzehrte, er schuf einen Fanatismus, den er, betrogen durch seine Kraft und Beständigkeit, für das wirkliche Eintreten der reineren Natur hielt. Und da endlich, wo er selber ermattend sich auf diese Stärke stützen wollte, mußte er gewahren, daß er allein und einzig die Kraft gewesen und daß das Echo nicht selber eine Stimme geworden war, die fortsprach, als seine eigenen Worte verstummten. Sein beobachtender Geist war zu klar, als daß ihm nicht immer eine Ahnung dieses Endes der Dinge geblieben wäre, sein unerbittlich scharfer Blick ließ es ihn jetzt sogleich gewahren. Deshalb redet er von seinem Untergange mit solcher Gewißheit und schreibt zu Ende seines Briefes an den Papst, der noch in vollem Selbstgefühl und zu einer Zeit verfaßt worden ist, wo er nichts zu befürchten Grund hatte, daß er mit inniger Sehnsucht den Tod erwarte.
Die Signorie erachtete sich nach Savonarolas freiwilliger Resignation weiterer Schritte überhoben. Sie ließ dem Papste durch ihren Gesandten notifizieren, daß seinen Wünschen gemäß verfahren worden sei, und man beruhigte sich dabei für den Augenblick. Allein jetzt begann in Florenz und innerhalb der Partei der Piagnonen selber aus dem Samen, den Savonarola gestreut, eine Saat zu wachsen, die das Gift trug, das ihn tötete.
Er hatte sich nie für einen Propheten ausgegeben, wohl aber als auserwähltes Werkzeug Gottes hingestellt, durch welches die Zukunft verkündet würde. Er lehnte eigentlich nur den Namen eines Propheten ab, um nicht des Hochmutes bezichtigt zu werden, als wolle er sich den Propheten des Alten Testamentes anreihen. In seinen Predigten redete er einzelne an, als durchschaue er ihre Seele ganz und gar, von Wundern hatte er gesprochen, durch welche die Stadt errettet werden würde, Visionen hatte er mitgeteilt, die ihm den Willen Gottes offenbarten, und die Idee nicht zurückgewiesen, daß durch ihn selbst Wunder geschehen könnten.
Daran glaubten die Piagnonen wie an eine unumstößliche Wahrheit. Sie vertrauten auf die Macht seiner Persönlichkeit. Als Piero damals vor der Stadt erschienen war, die unverteidigt offenstand, und man mit der Nachricht zu Savonarola stürzte, antwortete er ruhig, sie brauchten die Tore Pieros wegen nicht zu schließen, dieser werde die Stadt dennoch nicht zu betreten wagen. Und Medici hatte kehrt gemacht nach Siena! Dem Volke war Savonarola als der Prophet, der Zauberer, der Heilige, der Mann, dem Gott die Verfassung der Stadt offenbart hatte, der alles wußte, alles konnte, und dem keine Gewalt etwas anzuhaben vermochte. Seine Feinde aber hielten ihn für einen Betrüger, der dem Volke diesen Aberglauben mit Schlauheit aufzudrängen verstand.
Nun aber liegt es in der Natur der großen Menge, daß sie von Zeit zu Zeit glänzende Beweise von der Machtfülle des Mannes zu sehen verlangt, den sie für so mächtig hält. Savonarola hatte die Ankunft der Franzosen vorausgesagt, hatte das Eintreffen von Getreideschiffen während der Hungersnot vorher verkündet, hatte manches gesagt und gewußt, was der, den es betraf, für sein innerstes Geheimnis hielt, aber das war allmählich alt geworden und man begehrte frische Taten. Man verlangte etwas, woran man sich von neuem berauschen könnte, dessen bloße Erwähnung alles zu Boden schlüge, was Savonarolas Feinde vorbrachten. Die Signorie hatte ihm das Predigen untersagt und er sich zurückgezogen. Man hegte die Erwartung, er werde mit einer ungeheuren Tat plötzlich neu hervortreten und, wie so oft geschehen, glänzend triumphieren über seine Gegner.
So dachte man während der Fastenzeit 98, als Domenico da Pescia, sein treuester Anhänger und Genosse, statt seiner in San Marco predigte, während in den übrigen Kirchen die anders gesinnte Geistlichkeit laut gegen ihn die Stimme erhob. Ein Franziskaner, der in Santa Croce predigte, Francesco da Puglia, forderte Savonarola heraus, durch ein Wunder die Echtheit seiner Lehre zu beweisen. Auf der Stelle entgegnete Domenico, er wolle durchs Feuer gehen für Savonarola. Das Wort, einmal ausgesprochen, greift dämonisch um sich, und bald war die Sache so gedreht, daß Savonarola selber durch die Flammen schreiten werde; seine Freunde drängten ebensosehr als seine Gegner, und so gewiß waren die Piagnonen ihrer Sache, daß alle die dreihundert Mönche von San Marco nebst einer Anzahl von Nonnen, Männern, Frauen und Kindern in Gemeinschaft mit ihm die Probe zu bestehen begehrten.
Die Signorie nahm die Angelegenheit in die Hand. Es wurde angefragt bei Savonarola. Er lehnte die Probe ab, gedrängt aber von Freunden wohl noch mehr als von der Gegenpartei, erklärte er sich endlich bereit. Ein Scheiterhaufen sollte auf der Piazza errichtet werden und von der einen Seite Savonarola, von der anderen der Franziskaner, der seine Person gegen ihn einsetzen wollte, in die Flammen steigen.
Die Sätze, für die Savonarola so mit seinem Leben einstand, waren folgende: »Die Kirche bedarf der Umgestaltung und Erneuung. – Die Kirche wird von Gott gezüchtigt werden. – Danach wird sie umgestaltet, erneuet und blühend werden. – Die Ungläubigen dann bekehrt werden. – Florenz wird gezüchtigt werden, sich dann erneuen und frisch aufblühen. – Alles dies in unseren Tagen. – Die verhängte Exkommunikation ist ungültig. – Wer sich nicht an sie kehrt, sündigt nicht.« – Wichtig war nun der letzte Satz als eine Verneinung der päpstlichen Macht in einem besonderen Falle, der aber doch für alle Fälle gelten konnte.
Savonarola ahnte nicht, als er am 7. April auf der Piazza erschien, daß zu derselben Stunde König Karl von Frankreich sein Leben aushauchte. Ein Schlagfluß raffte ihn hin zu Amboise. Wäre es nach Savonarola gegangen, so hätte er Italien noch einmal befreit, Pisa den Florentinern zurückgegeben, ein Konzil berufen, einen anderen Papst eingesetzt, dann weiter die Ungläubigen bekämpft, besiegt und bekehrt. Viele mächtige Männer teilten diese Idee, wenn auch aus weniger erhabenen Ursachen. So aber war nichts geschehen, der König starb hin, und das Schicksal kehrte sich nicht an die Gedanken derer, die die Zukunft nach ihrem Willen zu gestalten dachten.
Man hatte quer über die Piazza einen erhöhten Pfad bereitet, der zu beiden Seiten mit brennbaren Stoffen umschichtet, in eine Allee von Flammen verwandelt werden konnte. Bewaffnete sperrten den Platz, das Volk umdrängte ihn und füllte die Fenster und Dächer der umliegenden Gebäude. Franziskaner und Dominikaner zogen auf, schweigend jene, diese mit geistlichen Liedern. Die Probe sollte beginnen. Da erhoben die Franziskaner Einwendungen. Savonarola solle die Kleider wechseln. Man vermutete einen Zauber darin. Man untersuchte ihn bis auf die nackte Haut. Man stritt, die Zeit verging, Ungeduld und Hunger ermüdete das Volk; es fing an zu regnen, der Tag war abgenutzt, ohne daß etwas geschah; das Gerücht verbreitete sich, Savonarolas Feigheit sei schuld an dieser Verzögerung. Endlich wurde verkündet, daß es nichts sei für heute mit der Feuerprobe.
Die Piagnonen waren diejenigen, welche das Gefühl der allgemeinen Enttäuschung am stärksten empfanden. Sie hatten auf glänzende Befriedigung ihres Stolzes gerechnet, nun trugen sie Spott davon und hatten nichts zu erwidern. Niemand verfiel darauf, was später oft behauptet worden ist, die Verzögerung sei eine künstliche, von der Signorie im Einverständnis mit den Franziskanern herbeigeführt gewesen, deren Effekt man, wie er eintraf, erwartete. Ohne daß ihnen ein Härchen versengt worden wäre, zogen die Franziskaner triumphierend ab, während Savonarola auf dem Wege nach San Marco mit den Waffen gegen die andrängende Menge geschützt werden mußte. Dort angekommen, betrat er die Kanzel, erzählte alles was sich begeben hatte, und entließ seine Anhänger.
Soviel steht fest: bereits am 30. März, eine Woche also vor diesen Ereignissen, hatte die Signorie den geheimen Beschluß gefaßt, daß die Brüder von San Marco oder die Franziskaner, je nachdem das Gottesurteil ausfallen würde, das florentinische Gebiet verlassen müßten. Am 6. April, als nur von Domenico da Pescia und von Savonarola noch nicht die Rede gewesen war, hatte man den zweiten Beschluß gefaßt, daß Savonarola, falls Domenico im Feuer umkäme, binnen drei Stunden fort müßte. Endlich soll ein dritter Beschluß zustande gekommen sein, des Inhaltes: dem Franziskaner dürfe unter keinen Umständen gestattet werden, die Probe zu bestehen. Man fürchtete also das Eintreffen eines Wunders und glaubte im Lager der Feinde selbst an Savonarolas göttliche Kraft. Doch bleibt das Dasein dieses letzten Beschlusses noch zu beweisen.
Viele von den Piagnonen flohen auf der Stelle, andere hielten sich bewaffnet in den Häusern oder zogen ins Kloster von San Marco, wo man sich in Verteidigungszustand setzte. Es war nichts Seltsames damals, daß Klöster in Festungen verwandelt wurden. Aus den angesehensten Familien waren die Söhne in San Marco eingetreten, um sich dem geistlichen Stande zu weihen; ihre Verwandten kamen jetzt, um an ihrer Seite den Sturm zu erwarten und zurückzuschlagen.
Der nächste Tag, 8. April, war der Palmsonntag. Von ihm ist der Beschluß der Signorie datiert, daß Savonarola aus Florenz verbannt sein sollte. Morgens früh predigte er in der Kirche des Klosters. Am Schlusse verkündete er voraus, was geschehen würde, nahm Abschied von den Seinigen und gab ihnen seinen Segen. Erst gegen Abend regten sich die Arrabiaten. Im Dome predigte ein Dominikaner. Die Compagnacci sprangen auf, schrien und drängten auf die Piagnonen ein, die flüchtend ins Freie stürzten. Draußen stand eine ungeheure Menge, der Ruf ertönte plötzlich von allen Seiten: zu den Waffen, zu den Waffen! nach San Marco, nach San Marco! Dort war die Kirche gefüllt, von draußen schlug man die Türen zusammen und stürmte hinein, von innen leistete man Widerstand und wehrte sich. Da erschien die Garde des Palastes. Sie fand die Eingänge des Klosters verrammelt und verzweifelte Verteidiger hinter den Toren, Mönche mit Panzern über ihren Kutten und mit Arkebusen, aus denen sie Feuer gaben, und mitten darunter die Frauen und Kinder, die die Kirche nicht hatten verlassen können und deren Geschrei dem Gebrüll der Menge draußen antwortete. Ein junger, blondbärtiger Deutscher, Heinrich mit Namen, war der tapferste unter den Mönchen von San Marco und wußte mit seiner Büchse besonders gut umzugehen.
Nachdem die Diener der Signorie sich Gehör verschafft, verkündeten sie den Befehl, daß alle die, welche nicht ins Kloster gehörten, dasselbe zu verlassen hätten. Wer nicht ginge, würde als Hochverräter behandelt werden. Viele gehorchten. Savonarola wollte sich freiwillig ausliefern, aber die Seinigen hielten ihn gegen seinen Willen zurück. Sie fürchteten, das Volk möchte ihn in Stücke zerreißen. Das Kloster hatte eine kleine Gartentür, durch diese suchten einige der angesehensten Piagnonen zu entrinnen. Unter ihnen Francesco Valori. Dem aber paßten die Tornabuoni, Pucci und Ridolfi auf mit den anderen, die diesen Tag der Rache so sehnsüchtig erwartet hatten. Umringt, wird er sogleich zu Boden geschlagen, daß er tot liegen bleibt, und weiter geht es nun zu seinem Palaste. Seine Frau, die oben am Fenster stand, erschießen sie von der Straße aus mit einer Armbrust, stürmen das Haus, plündern es und erdrosseln ein Enkelkind Francescos, das noch in der Wiege lag. Besser erging es den Soderinis. Hier trat der Bischof von Volterra, der ein Soderini war, im vollen Ornate den sich heranwälzenden Massen entgegen und brachte sie durch seinen Anblick und donnernde Rede zur Umkehr.
Vor San Marco war es stiller geworden, die Nacht lag längst über dem Kloster, als das wütende Volk dahin zurückkehrte. Feuer wurde angelegt, die Tore verbrannt und durchbrochen und Savonarola von den Leuten der Signorie, ohne deren Schutz er verloren gewesen wäre, in den Palast abgeführt. Mit ihm Domenico da Pescia und ein dritter Dominikaner, Silvestro mit Namen. Kaum vermochte man ihn vor Mißhandlungen des Pöbels zu schützen. Sie stießen ihn und schrien lachend, er solle doch prophezeien, wer es gewesen sei. Sie riefen: Arzt hilf dir selber! Auf dem Platze vor dem Kloster lagen Tote und Verwundete. Die Mönche kamen heraus und trugen sie zu sich hinein, um ihnen zu helfen oder sie zu begraben.
Und nun begann ein Prozeß, der kurz war, aber der unendlich erscheint, wenn man Schritt vor Schritt den Qualen folgt, die Savonarola zu erdulden hatte. Der Papst verlangte ihn nach Rom, bequemte sich jedoch, einen Kommissar zu schicken. Savonarola ward gefoltert; es wird genau berichtet auf welche Weise; die Kräfte verließen ihn unter den Händen seiner Peiniger, denn er war eine zarte kränkliche Natur; kaum losgelassen widerrief er alles. In diesem Zustande noch verfaßte er rührende Schriften. Die Tortur wiederholte sich zu verschiedenen Malen. Nardi, der in seinen Angaben sehr gewissenhaft ist, versicherte, er habe aus den besten Quellen gehört, daß die Akten gleich beim Niederschreiben gefälscht seien. Der Kommissar des Papstes gestand später gleichgültig offen ein, Savonarola sei ohne Schuld gewesen und der Prozeß erfunden, den die Florentiner nur ihrer Rechtfertigung wegen hätten drucken lassen. Savonarola wurde zum Tode verurteilt und am 23. Mai 1498, am Himmelfahrtstage, das Urteil vollzogen.
Auf dem Platze vor dem Palaste der Regierung war der Scheiterhaufen errichtet. Aus seiner Mitte ragte ein hoher Pfahl mit drei Armen, die sich nach verschiedenen Seiten ausstreckten. Als die drei Männer über eine Art fliegende Brücke zu diesem Galgen hinschritten, steckte der florentinische Pöbel spitze Pflöcke von unten auf zwischen den Brettern des Ganges hindurch, in die sie mit ihren nackten Füßen hineintraten. Savonarolas letzte Worte waren Trost für seine Genossen, die mit ihm duldeten. Da hingen sie nun alle drei und die Flammen schlugen zu ihnen auf. Ein mächtiger Windstoß trieb diese noch einmal zur Seite; einen Moment lang glaubten die Piagnonen, ein Wunder werde sich ereignen. Doch schon hatte sie das Feuer wieder verhüllt, und bald stürzten sie mit dem brennenden Gerüste in die Glut nieder. Ihre Asche wurde von der alten Brücke herab in den Arno geschüttet. Welche Gedanken müssen Savonarolas Seele bewegt haben, als das Volk, das er Jahre lang gespornt oder gezügelt hatte, das er so völlig mit seinen Lippen beherrschte, stumpf und teilnahmlos umherstand.
VII
Das härteste, dessen man Savonarola beschuldigt hat, ist der Vorwurf, er habe seine Partei angestachelt, ihre Gegner mit Gewalt aus dem Wege zu räumen. Dies sagt Machiavelli. Es sei nur darum nichts daraus geworden, behauptet er, weil das Volk seine Andeutungen nicht scharf genug verstanden habe. Darauf ist zu antworten, daß die Piagnonen zu verschiedenen Malen im Begriff standen, mit den Waffen dreinzuschlagen, und daß Savonarola sie zurückhielt. Es ist ferner zu erwidern, daß Machiavelli, dessen Unbefangenheit in anderen Fällen so bewunderungswürdig erscheint, sich dennoch diesem Manne gegenüber vom Haß der Partei zu einseitigen Behauptungen verführen ließ. Er gehörte zu denen, die Savonarola für einen bewußten Lügner hielten und nach Rom über ihn in diesem Sinne berichteten. Das älteste Schriftstück, das wir von Machiavelli haben, ist ein Brief über Vorgänge aus jenen stürmischen Tagen. Gründlicher Haß atmet aus diesem Schreiben. Machiavelli war damals noch nicht dreißig Jahre alt und eben in den Staatsdienst eingetreten.
Wo liegt nun das, das über die Verehrung, die der Mann einflößt, dennoch einen trüben Schatten wirft? Ich will ihn mit einem anderen Mönche von San Marco vergleichen, der lange vor ihm lebte und der das Kloster nicht weniger berühmt gemacht hat als er. Die Wände seiner Gänge, seiner Kapellen, niedriger, dunkler Zellen sogar, sind bedeckt von den Malereien Fiesoles, eines von den Nachahmern Giottos, dessen Werke, erfüllt von reizender Reinheit der Empfindung und verklärt durch eine Art süßer, in sich selbst beschlossener Begeisterung, zu den merkwürdigsten und ergreifendsten Denkmalen einer Künstlerseele gehören.
Seine Arbeiten sind in der Tat beinahe nicht zu zählen; in gleichmäßiger sanfter Schwärmerei scheint er ohne Aufhören seine Träume dargestellt zu haben. Die Gestalten trugen etwas Ätherisches an sich. Er malt Mönche, die am Kreuze niedersinkend, mit zitternder Inbrunst seinen Stamm umarmen, er malt Scharen von Engeln, die aneinandergedrängt die Luft durchschweben, als wären sie alle ein langgestrecktes Gewölk, dessen Anblick uns mit Sehnsucht erfüllt. Es waltet ein so unmittelbares Verhältnis zwischen dem, was er darstellen wollte, und dem, was er zu malen vermochte, und zugleich war das, was er wollte, stets so einfach und verständlich, daß seine Bilder auf jeden einen unmittelbaren, unvergeßlichen Eindruck machen, und so manche Naturen in dieselbe Begeisterung zu versetzen fähig sind, in der sie selbst geschaffen zu sein scheinen.
Im Jahre 1387 geboren, also ein Zeitgenosse Ghibertis und Brunelleschis, legte Fiesole mit einundzwanzig Jahren sein Gelübde ab; achtundsechzigjährig starb er in Rom, wo sein Grabmal noch vorhanden ist. Eigentlich war er Miniaturmaler, man sieht das auch seinen Freskobildern an. Sein Leben nach Vasaris Beschreibung klingt wie eine Legende aus uralten frommen Zeiten. Er sollte Prior des Klosters werden, lehnte jedoch die Würde demütig ab, und all seine Schicksale und Werke spiegeln das Gefühl, das ihn so bescheiden zurücktreten ließ. Und dennoch war die Wirkung, die von ihm ausging, groß und dauert jetzt noch.
Vergleichen wir den Geist seiner Gemälde mit dem der Predigten Savonarolas, die dieser inmitten der Klosterhallen hielt, von deren Wänden die Werke Fiesoles niederschauten, so empfinden wir am schärfsten, was Fiesole besaß und was Savonarola fehlte, was ihn bei seinen Gegnern so furchtbar verhaßt machte. Ein heiliger Eifer für das Gute, Wahre, Sittliche, Große entflammte sein Herz, aber daß ohne die Schönheit das Gute nicht gut, das Wahre nicht wahr, das Heilige selbst nicht heilig sei, das entging ihm. So wurde er, das weichste Gemüt, unversöhnlich und zwang seine Gegner, es auch zu sein, und so vernichtete er sich. Er vergaß, daß das, was die Menschen am meisten zwingt und bildet, nicht der bewußte Gehorsam, der heftig unterdrückte Hang zum Bösen, das gewaltsam sich selbst leitende Beharren auf einer scharf gezogenen Linie ist, die zu Gott leiten soll, sondern daß das unbewußte Aufnehmen eines freundlichen Beispiels, das leise Nachgeben, wenn das Gute und Schöne mit lockender Stimme redet, und das schmetterlingsartige Fortflattern, dem Göttlichen dennoch immer zugewandt, die Mächte eigentlich sind, die die Menschheit geheimnisvoll, aber sicher weiterführen. Und so haben Fiesoles sanfte, stumme Bilder mehr getan als Savonarolas Donner, die beinahe spurlos verhallten. Kaum aber war Savonarola gestorben, so umgab ein Heiligenschein seine Gestalt, der Inhalt seiner letzten Tage wurde als das ruhmvolle Leiden eines Märtyrers von Mund zu Mund getragen und mit Erzählungen von Wundern untermischt. Wie sein Herz nicht mit verbrannt, aus den Tiefen des Arno wieder emporgewirbelt und von seinen Verehrern unversehrt aufgefischt worden sei. Dem Unterliegen in den Qualen der Tortur setzte man das Beispiel des Apostel Petrus entgegen, der unter weniger dringenden Umständen den Herrn verleugnet hätte. Dagegen der jämmerliche Tod des Königs von Frankreich, der hingerafft wurde, nachdem ihm sein Kind vorausgegangen war, erschien als die unmittelbare Strafe des Himmels, die Savonarola vorausverkündete. Savonarolas Bild mit einer Strahlenkrone ums Haupt wurde in Rom selber auf den Straßen feilgeboten.
Der Gedanke drängt sich uns auf, daß sein Leiden und sein Tod auf den schaffenden Künstlergeist Michelangelos nicht ohne Einwirkung geblieben sei. Im November 1498 ging er nach Carrara, um den Marmor für die Pietà selbst zu holen. An Ort und Stelle dort scheint er die erste Arbeit getan zu haben und im April mit dem Blocke nach Rom zurückgekommen zu sein. Nur ein Jahr war für die Ausführung bedungen worden, über zwei Jahre jedoch sehen wir Michelangelo vom Beginn der Arbeit an in Rom noch bleiben: ohne Zweifel, weil die Vollendung seines Werkes ihn dort festhielt.
Fünftes Kapitel
1501-1504
I
Der Tod des Königs von Frankreich war für Florenz von glücklichen Folgen gewesen. Seinem Nachfolger, dem Herzog von Orleans, der als Ludwig der Zwölfte den Thron bestieg, standen die geistigen Fähigkeiten zu Gebote, deren Karl der Achte ermangelte. Es hatte ein Ende mit dem dilettantischen Erringenwollen von Ruhm und Königreichen. Ludwig war, als er die Regierung antrat, ein gereifter Mann, dessen langgehegte Pläne nun mit systematischer Arbeit ausgeführt wurden. Seine Gedanken waren längst in vollem Maße Italien zugewandt. Ludwigs Großmutter war eine Visconti gewesen, daraufhin machte er Ansprüche auf Mailand geltend, und zu gleicher Zeit bereitete er sich vor, den Krieg um Neapel mit frischen Kräften aufzunehmen.
Jetzt belohnt sich die Treue der Florentiner gegen Frankreich. Zwei Feinde drohten der Stadt, die Medici und Cesare Borgia, dessen mittelitalischen Reichen, das er für sich zu gründen im Begriff war, Florenz nicht fehlen sollte. Medici und Borgia standen beide vortrefflich mit Frankreich und hofften auf die Hilfe des Königs, der ihnen gerade so viel Hoffnungen ließ, als es bedurfte, um sie an seine Politik zu fesseln, dennoch aber keinem von beiden gestattete, den Florentinern ernstlich zu Leibe zu gehen. Denn die französische Gesinnung der freien Bürger erschien dem Könige mit Recht als eine sicherere Bürgschaft für die Anhänglichkeit der Stadt, als die Dankbarkeit Pieros oder Cesares, die er aus Erfahrung kannte.
So stand es denn gut in Florenz. Mit Venedig hatte man sich geeinigt, es unterstützte Pisa nicht weiter, Ludwig schickte sogar Hilfstruppen. Auch im Innern der Bürgerschaft waren bessere Verhältnisse eingetreten. Anfangs ging es den Piagnonen freilich schlecht und am übelsten den armen Klosterbrüdern von San Marco. Bittschriften der gemeinsten Unterwürfigkeit an den Papst erforderte es, um Verzeihung zu erwirken. Ihre Glocke, die Piagnona genannt, ward als Verbrecherin rechtskräftig verurteilt und aus dem Kloster fortgenommen und der arme Cronaca mit Ausführung des Urteils beauftragt; man schonte die Anhänger des gestürzten Propheten also nicht, sondern ließ sie selber Hand anlegen. Die Arrabiaten räucherten die entweihten Kirchen mit Schwefel aus, durch Santa Maria del Fiore jagten sie ein Pferd und töteten es am Ausgange. Die Piagnonen selber, gedrückt, uneins und voll Furcht, wagten kaum, sich auf der Straße zu zeigen, wo die alte Üppigkeit in glänzenden Kleidern wieder triumphierend einherzog.
Jedoch verhöhnte man sie zuerst auch und wurden sie durch den Tod und die Verbannung ihrer Häupter als politische Partei vernichtet; dennoch gab man denen, welche die Schriften Savonarolas hatten ausliefern müssen, bald ihre Bücher zurück. Gegen den König von Frankreich entschuldigte die Signorie die Hinrichtung und wälzte die Schuld von sich ab. Die Piagnonen entrissen durch die Auflösung, der sie anheimfielen, den Arrabiaten das Band, das diese ihnen gegenüber vereinigte. Die Parteien fanden sich alsbald zu anderen Verbindungen zusammen, es kam wieder darauf an, den Pallesken Widerstand zu leisten und zu verhindern, daß sie die Oberhand gewännen. Das Consiglio grande Savonarolas wurde beibehalten.
Für den Augenblick wagten die Medici nichts gegen die Freiheit der Florentiner, wohl aber hatten diese Pisa zu erobern und Frankreich bei gutem Willen zu erhalten. Darauf wendete sich ihre Politik mit allen Kräften. Die Verhältnisse waren schwieriger Natur, oft hingen die finsteren Wolken dicht über der Stadt und drohten gewaltig, Gold, Glück und Gewandtheit aber leiteten die Blitze gefahrlos nebenab, und mitten in den kriegerischen Unruhen, die ganz Italien ringsum bis dicht an ihre eigenen Mauern erfüllten, herrschte das alte unvermeidliche Jagen nach Reichtum, Ehre und Lebensgenuß.
Unter diesen Umständen kam im Jahre 1501 ein neues Unheil, das mit einem Schlage all die Vorteile der eben überwundenen harten Zeit hätte vernichten können. Cesare Borgia hatte siegreich in der Romagna gekämpft und wollte sich gegen Bologna wenden. Die Bentivogli aber erkauften den Schutz Frankreichs, und der König befahl dem Herzog, von seinem Plane zurückzutreten. Statt dessen wollte sich Cesare nun zur Eroberung von Piombino aufmachen, und dazu mußte er quer durch Toskana und das Gebiet von Florenz ziehen. Er unterhandelte darüber aufs freundschaftlichste, denn die Florentiner hielten die Pässe der Apenninen besetzt und konnten ihm den Eintritt verwehren. Kaum jedoch hatte er erreicht, was er wollte, als er andere Saiten aufzog und brandschatzend in das flache Land hinunterkam.
Plötzlich waren nun auch die Medici bei ihm, die mit ihren Freunden in Florenz diesen Moment für den günstigsten erachteten. Die Verabredung mit den Pallesken in Florenz war getroffen und Überrumpelung der Stadt, Berufung eines Parlamentes und Umsturz der Verfassung die drei Stufen, die man rasch zu ersteigen hoffte. Und wie die Medici auch darin stets den richtigen Moment zu treffen suchten, daß sie Zeiten wählten, in denen das gemeine Volk aufgeregt war, so kamen sie jetzt während einer furchtbaren Trockenheit, wo die Früchte auf dem Felde verdorrten und eine Mißernte und Teuerung zu erwarten stand.
Cesare verlangte, daß das Verbannungsdekret gegen die Medici zurückgenommen werde. Er stand so drohend da, daß die Regierung schwankte, welche Antwort zu geben sei. Die Medici hatten nur das eine bescheidene Begehren gestellt, man solle ihnen den Aufenthalt in ihrer Vaterstadt wieder erlauben; sie besaßen Freunde in allen Kreisen der Bürgerschaft, die ihre Bitte unterstützten. Unruhe bemächtigte sich des Volkes. Man begriff nicht, daß über die Antwort, die man Cesare zu geben hätte, auch nur beraten werden könne. Die Häuser wurden in Verteidigungszustand gesetzt und die Waffen in Bereitschaft. Eines Tages kommt von den Mitgliedern der Regierung einer erhitzt aus der Türe des Palastes. Man fragt ihn unten auf dem Platze, was er habe. Er wolle nicht dabei sein, antwortete er, wenn da oben verhandelt würde, ob man das Vaterland verraten sollte. Diese Worte erfüllten die ganze Stadt. Man wußte, daß nahe Verwandte der Medici unter den Signoren säßen. Die Stimmung wurde eine so gefährliche, daß Cesares Vorschlag verworfen ward. Aber man wolle über die Höhe der Summe mit ihm unterhandeln, wurde geantwortet, für die er als Oberbefehlshaber der florentinischen Truppen auch fernerhin der Freund der Bürgerschaft bliebe. Mit anderen Worten, man wollte sich loskaufen.
Cesare, dem es mit der Restitution der Medici nicht so ganz Ernst war, ließ sich das gefallen. Vielleicht hatte er nur gedroht mit den alten Feinden, um sowohl von diesen die Summe zu beziehen, mit denen sie seine Hilfe unfehlbar im voraus bezahlt hatten, als auch von der Stadt günstigere Geldbedingungen zu erlangen. Man kam auf 36 000 Gulden überein; dafür trat er als Oberbefehlshaber der florentinischen Truppen dem Namen nach in die Dienste der Stadt und zog nach Piombino weiter, das er Anfang September einnahm.
Piero blieb nichts als die Hoffnung auf bessere Zeiten. Es ist seltsam, wie das Mißlingen auch dieses Handstreichs wiederum durch den Stolz und Hochmut seines Charakters, wenn auch auf weiten Umwegen, herbeigeführt worden ist. Zu der Zeit nämlich, wo er noch in Florenz fest saß und Alexander Borgia Erzbischof von Pampelona war, studierte Cesare, dessen Zukunft damals weniger versprach, das kanonische Recht auf der Universität zu Pisa. In Sachen eines Freundes, der in einen peinlichen Prozeß verwickelt war, kam er nach Florenz herüber und begehrte bei Piero vorgelassen zu werden. Man ließ ihn einige Stunden warten und endlich wieder fortgehen, so daß er unverrichteter Dinge nach Pisa zurückkam. Das soll er Piero nie vergessen haben.
In die Zeit, als Cesare Borgia das florentinische Gebiet verließ und in das von Piombino einfiel, fällt die Bestellung des David bei Michelangelo.
Vor langen Jahren hatte man einen neun Ellen hohen Marmorblock von Carrara nach Florenz geschafft, aus dem die Konsuln der Wollenweberzunft, in deren Besitz die Kirche Santa Maria del Fiore war, einen Propheten arbeiten zu lassen beabsichtigten, als eine der Figuren, welche die Kuppel der Kirche außen umgeben sollten. Die Bestellung war in der Folge zurückgenommen worden, der Stein aber bereits behauen und für eine andere Gestalt nicht zu gebrauchen. Vergebens hatte man ihn einst Donatello angetragen, kein Bildhauer glaubte sich imstande, etwas Rechtes daraus zu machen, und so lag er seit Menschengedenken im Hofe der Werkstätte für Dombauarbeiten.
Jetzt aber meldete sich jemand, der es damit wagen wollte. Unter der Zahl derer, die im Garten der Medici gelernt hatten, befand sich ein Bildhauer, der von Lorenzo dem Könige von Portugal gesandt wurde, und nachdem er dort großartige Bauten und Skulpturen zustande gebracht, um 1500 wieder nach Florenz zurückgekehrt war. Andrea Contucci del Monte Sansovino, so hieß der Mann, bat, man möge ihm den Marmor übergeben. Die Konsuln aber, ehe sie auf dies Verlangen eingingen, wollten erst Michelangelos Meinung hören, ob er nicht selber vielleicht etwas Gutes aus dem Marmor zu schaffen wüßte.
Michelangelo hatte soeben über eine andere Arbeit abgeschlossen. Der Kardinal Piccolomini, dessen Familie aus Siena stammte, wollte im dortigen Dome eine Grabkapelle mit Werken der Skulptur ausschmücken und bestellte fünfzehn Marmorstatuen in Lebensgröße bei Michelangelo. Der Kontrakt, ein interessantes Aktenstück, das die genauesten Bestimmungen enthält, war am 19. Juni 1501 in Rom unterzeichnet worden. Jacopo Galli, Michelangelos römischer Freund, vermittelte auch hier und verbürgte die eventuelle Rückerstattung vorausempfangener Gelder, falls die bedungenen Ablieferungstermine nicht eingehalten würden oder die Qualität der Statuen dem Vertrage nicht entsprechend erschiene. Michelangelo aber, als er den ungeheuren, prächtigen Stein vor Augen sah und den Ruhm erwog, den er durch eine Arbeit dieser Ausdehnung in Florenz erwerben könnte, ließ die fünfzehn Statuen für Siena auf sich beruhen, unterwarf den Marmor einer sorgfältigen Prüfung und übernahm die Arbeit. Sansovino hatte doch nur unter der Bedingung daran gehen wollen, daß er den Block durch Anfügung einiger anderer Marmorstücke vervollständigte. Michelangelo aber erklärte, daß er ohne jede Zutat arbeiten würde. Dies gab vielleicht die Entscheidung. Am 16. August 1501 wurde der Auftrag ausgefertigt.
Zwei Jahre sind ihm darin zugestanden, vom 1. September an gerechnet, und monatlich, so lange er arbeitete, sechs schwere Goldgulden Gehalt. Was am Ende noch nachzuzahlen sei, sollte dem Gutdünken und Gewissen der Auftraggeber überlassen bleiben. Am 13. September morgens in der Frühe, es war an einem Montage, brach er den Stein an. Einzige Vorbereitung für seine Arbeit war die Anfertigung eines kleinen Wachsmodells, das in den Uffizien noch vorhanden ist. So meißelte er im Vertrauen auf sein gutes Auge darauf los, und Ende Februar 1503 war schon soviel geschafft worden, daß er seine Arbeit als halb vollendet zeigen konnte. Er bat bei dieser Gelegenheit um Feststellung des Gesamtpreises, und man vereinigte sich über vierhundert Goldgulden.
Während Michelangelo, der nicht, wie es heute geschieht, den Stein bis auf die letzte Überarbeitung fremden Händen überließ, sondern vom ersten Anfang an bis zur letzten Vollendung alles allein tat, so in seine Arbeit versenkt war, wurde im Jahre 1502 von den Medici ein neuer Versuch gemacht, sich der Stadt zu bemächtigen. Diesmal kamen sie weiter, sie hatten bessere Verbündete und größere Mittel. Die Petrucci, die in Siena herrschende Familie, die Baglioni von Perugia, die Vitelli und Orsini standen ihnen zur Seite. Arezzo und Cortona, zwei florentinische Städte, hatten sie bereits eingenommen, und der Papst mit Cesare Borgia schien ihren Fortschritten kein Hindernis in den Weg zu legen. In dieser Not wandte sich die Republik an Frankreich, und ihre Vorstellungen von der Wichtigkeit der eigenen unabhängigen Existenz für den König wirkten so schlagend, daß sie auf seine drohenden Befehle hin die verlorenen Städte zurückerhielt. Michelangelo aber trug diese neue Schuld der Dankbarkeit gegen Frankreich eine neue Arbeit ein.
Zu den Mitteln nämlich, mit denen man am Hofe des Königs operierte, gehörten nicht bloß verlockende Geldsummen, sondern auch Werke der Kunst, die zu Geschenken verwandt wurden. Schon im Jahre 1501 hatten die florentinischen Gesandten am Hofe des Königs aus Lyon geschrieben, der Herzog von Remours wünsche lebhaft eine Bronzekopie des von Donatello gearbeiteten und im Hofe des Regierungspalastes stehenden Davids zu besitzen; zwar wolle der Herr die Kosten wiedererstatten, scheine aber nicht abgeneigt, das Werk als ein Geschenk anzunehmen. Der Herzog hatte übrigens schon 1499 eine Anzahl Marmor- und Bronzebüsten als Geschenk der Stadt erhalten, darunter eine, die Kaiser Karl den Großen darstellte.
Die Signorie antwortete auf dieses vom 22. Juni datierte Schreiben am 2. Juli, es sei augenblicklich Mangel an guten Meistern in der Stadt, die einen solchen Guß auszuführen imstande wären, doch werde man die Sache jedenfalls im Auge behalten. Dabei blieb es. Als jetzt aber im Sommer 1502 die Not mit den Medici einbrach und es mehr als jemals auf den guten Willen Frankreichs ankam, fand sich auch alsbald ein guter Meister für diesen Guß. Michelangelo übernahm ihn am 2. August des Jahres, gerade als die Franzosen zugunsten der Florentiner in Arezzo einrückten.
Die Statue sollte dritthalb Ellen hoch sein und in sechs Monaten fertig abgeliefert werden. Das Metall gibt die Regierung. Fünfzig Gulden werden angezahlt, der endgültige Preis wie gewöhnlich erst nach Vollendung des Ganzen bestimmt. In der Folge indessen wurde auch durch diesen Kontrakt die Sehnsucht des Herzogs von Nemours nach seinem David nicht erfüllt. Die Gesandten erinnern, die Signorie entschuldigt sich, endlich wird die Statue bestimmt zu Johanni 1503 in Aussicht gestellt, vorausgesetzt, daß der Meister Michelangelo sein Versprechen halte, aber es sei freilich bei der »Denkungsart solcher Leute« auf Versprechungen nicht viel zu geben. Dieser Vorbehalt erwies sich als begründet. Der Herzog erhielt nichts, er fiel beim König in Ungnade, und als Jahre später die Arbeit endlich vollendet worden war, wurde sie einem anderen hohen Herrn am französischen Hofe dargebracht. Heute weiß man nichts mehr von ihr. Ebensowenig von einer zweiten Bronzearbeit, die Michelangelo damals für Piero Soderini, den Gonfalonier der Stadt, vollendet und die gleichfalls nach Frankreich ging. Condivi sagt nicht einmal, was sie darstellte.
Dagegen müssen in diese Jahre zwei andere Arbeiten gesetzt werden, die Statue und ein Gemälde, welche beide wohlerhalten dastehen und von denen die erstere zu Michelangelos schönsten Werken gehört. Pierre Moscron, ein flandrischer Kaufmann, kaufte sie ihm ab, und Michelangelo sandte das Werk nach Brügge, wo die Madonna heute noch steht, rein und unberührt, als wäre sie eben aus seinen Händen gekommen. Pierre Moscron ließ sie dort im Dome aufstellen, nachdem die Kapelle, deren Altar sie schmücken sollte, auf eigene Kosten von ihm erbaut worden war. Schon 1521, als Albrecht Dürer durch Brügge kam, stand Michelangelos Werk im Dome, und er wurde hingeführt, um es zu bewundern.
Diese Madonna ist mit ungemeiner Sorgfalt ausgeführt. Sie ist einfacher als die römische. Sie ist lebensgroß. Sie sitzt da, von der zartesten Gewandung umhüllt, das Kind steht zwischen ihren Knien, an das linke angelehnt, dessen Fuß auf einen Steinblock auftritt, so daß es um ein geringeres höher als das rechte aufragt. Auf diesem Steine steht auch das Kind, und zwar als wollte es eben herabsteigen. Seine Mutter hält es mit der linken Hand zurück, während die Rechte mit einem Buche in ihrem Schoße ruht. Sie blickt geradeaus, ein Tuch ist ihr über das Haar gelegt und fällt zu beiden Seiten auf Hals und Schultern anschmiegsam herab. In ihrem Antlitz, ihren Blicken hegt sie eine wunderbare Hoheit, einen königlichen Ernst, als fühle sie die tausend frommen Blicke des Volkes, das zum Altare zu ihr aufsieht. Wollte man ihr, wie es Sitte ist, von irgendeinem kleinen Abzeichen einen Beinamen geben, so könnte dies von der straffen Falte ihres Gewandes sein, die von der Spitze des linken Knies durch das darauftretende Kind seitwärts niedergezogen wird. Das Kind aber gleicht durchaus dem kleinen Johannes auf dem Gemälde der Nationalgalerie zu London. Die Ähnlichkeit erscheint so auffallend, daß die Verwandtschaft der Arbeiten, einer doppelten Blüte gleichsam, die demselben Gedanken entsprang, kaum abzuweisen ist.
Wir haben einen Abguß der Madonna in Berlin. Ich ging eines Morgens in das Museum, als die bleiche Januarsonne auf die Statue fiel. Ein leichtes goldnes Licht streifte sie von der Seite, das sanft leuchtete, ohne das übrige in Schatten zu bringen. Ein wunderbares Leben sah ich über die Gestalt ausgegossen. Das Antlitz, als atmete es, ein liebliches Profil, eine entzückend sanfte Modellierung des Mundes und des Kinnes. Die Hände so weich; der Faltenwurf ist leicht. Besonders schön die Hand, in deren Finger die des Kindes hineingreift. Dabei bot sich die Gestalt, von allen Seiten ringsum betrachtet, in vollendeter Durchführung dar.
Verwandt mit der Madonna in Brügge auch ist ein in Florenz befindliches, unvollendetes Basrelief einer sitzenden Madonna, vor deren Knien das Jesuskind steht, das Händchen auf ein offenes Buch gelegt. Unvollendete Werke großer Meister erwecken in der Phantasie des Betrachtenden immer unbestimmte Erwartungen: auch hier möchte man vermuten, es könne etwas zustande gekommen sein, was andere Arbeiten Michelangelos vielleicht noch übertroffen hätte.
Das Gemälde, das ich in die gleiche Zeit setze, ist für Angelo Doni gemalt worden und steht heute, ebenfalls in vorzüglichem Zustande, in der Tribüne der Uffizien zu Florenz. Die Jungfrau kniet dem Zuschauer entgegen mit beiden Knien auf den Boden und empfängt nach rückwärts gewandt in ihre Arme das Kind, welches ihr Joseph über ihre rechte Schulter von hinten herreicht. Die Figuren sind etwas weniger als lebensgroß genommen. Johannes kommt von weitem heran, klein und ohne Zusammenhang mit der Hauptgruppe; den Hintergrund füllt eine Anzahl nackter männlicher Gestalten, die, in verschiedenen Bewegungen im Halbkreise stehend oder sitzend, durchaus nichts mit der heiligen Familie zu tun haben. Sie sind entfernt und klein, aber mit großer Sorgfalt gemalt und musterhaft gezeichnet. Die Gruppierung der heiligen Familie selbst dagegen erscheint mir gesucht. Die Farben sind mit der erdenklichsten Sorgfalt aufgetragen, aber das Kolorit hat an der Stelle, wo das Gemälde steht, nichts Frisches, Blühendes. Ich sah es einmal, aber in einem der helleren Seitenräume der Tribuna. Nun erschien es ganz licht und unglaublich zart ausgeführt. Alles feiner, durchsichtiger, ja anmutiger, als ich es vorher je gesehen. Angelo Doni bezahlte es mit siebzig Dukaten. Die Angabe dieser Summe bei Condivi widerlegt die Anekdote, welche Vasari erzählt, derzufolge Michelangelo von Doni zweimal siebzig Dukaten erhalten hätte. Es ist derselbe Doni, dessen Porträt, samt dem seiner Frau, Raffael wenig Jahre später gemalt hat, der in Donis Hause wohl aufgenommen war; Gesichter, die wenig Neugier Erweckendes für die Welt haben würden, wenn sie nicht durch die Hand eines solchen Mannes der Vergessenheit entrissen worden wären. Dreißig Jahre später ward Michelangelos Gemälde für zweihundertzwanzig Scudi weiterverkauft, und der Käufer hoffte mehr noch dafür wiederzuerhalten. Aus Lyon, wo dieser Handel damals abgeschlossen wurde, muß es dann nach Florenz zurückgekehrt sein.
Was diesem Werke noch ein besonderes Interesse verleiht, ist der Umstand, daß die Malerei und auch die Auffassung an einigen Teilen lebhaft an Signorelli erinnert. Und nun findet sich, daß zu der Zeit gerade, wo Michelangelo aus Rom nach Florenz zurückkehrte, Luca Signorelli im Dome zu Orvieto die Wandgemälde schuf, auf denen heute sein Ruhm zumeist beruht. Orvieto liegt so sicher an der Straße von Rom nach Florenz, daß es nicht umgangen werden kann: der Weg führt durch das Städtchen, und Michelangelo, den wir später als alten Bekannten Signorellis wiederfinden, kann ihn dort bei der Arbeit getroffen haben. Diese Malerei muß Eindruck auf ihn gemacht haben: wir würden das sogar annehmen, auch wenn wir keinen Beweis dafür hätten. Michelangelos Heilige Familie aber liefert ihn in bester Form. Und nicht diese allein: noch ein zweites Gemälde, freilich ein elend verdorbenes, unfertiges Stück, wird heute Michelangelo zugeschrieben, das in jener Zeit entstanden sein kann und was eine noch größere Verwandtschaft mit Signorelli bekundet. Es ist eine Grablegung, in Besitz der englischen Nationalgalerie. Die am besten erhaltene Figur, die eines Mannes, welcher den Leichnam Christi in das Grab heruntertragen hilft, ist eine bewunderungswürdige Gestalt. Über die Farbe kann ich nichts sagen, da mir das Werk nur aus einer Photographie bekannt ist.
Die Komposition weist schon deshalb auf Michelangelo hin, weil hier ein Versuch vorliegt, bei einer Szene des Neuen Testamentes die typische Darstellung zu ignorieren und von fremder Seite her etwas Neues zu geben. Das Motiv, den Leichnam Christi in schwebender Stellung tragen zu lassen, war unerhört in der Kunst bis dahin und ist es auch in der Folge geblieben. Wie heidnisch im tiefsten Herzen, was die Vermischung des rein Formalen anlangt, Michelangelos Jahrhundert war, tritt hier in fast abschreckender Weise hervor. Das von ihm in dieser Grablegung ausgebeutete Motiv nämlich ist einer Komposition Mantegnas entnommen worden: einem Bacchanale, wo wir einen trunkenen Silen von zwei Faunen fast in derselben Weise fortgeschleppt sehen.
Wir wissen, wie tief religiös Michelangelo dachte und fühlte. Wenn er deshalb unbefangen hier Mantegna benutzte, so liefert das eben nur den Beweis dafür, wie sehr kirchliches und heidnisches Altertum damals zusammenflossen und wie wenig man, wo es sich um Kunstformen handelte, auf den Inhalt achtete, an dem sie zur Erscheinung kamen. Nicht anders ist es zu erklären, wenn Raffael später dieselben Kindergestalten hier als Engel mit einer Maria und dort als Amoren bei einer Venus erscheinen läßt.
Daß solche Arbeiten neben Michelangelos großen Schöpfungen zur Entstehung kamen, darf nicht wundernehmen bei seinem Fleiße. Er war in unablässiger Tätigkeit. Eine ganz andere Aufgabe, als diese einzelnen Werke boten, wurde ihm in der Bestellung von zwölf Statuen der Apostel zuteil, jeder vier und eine viertel Elle hoch, über welche dieselben Konsuln der Wollenweberzunft, für die Michelangelo den David arbeitete, im Frühling 1503 einen Kontrakt mit ihm abschlossen. Ein Jahr gerade vor Vollendung des David. Die Leute kannten ihn jetzt einigermaßen und erfanden ein geniales Mittel, ihn zuverlässig zu machen. Alle Jahre sollte ein Apostel abgeliefert werden. Michelangelo würde auf Kosten der Besteller nach Carrara gehen und die Blöcke auswählen. Der Preis bliebe dem Gutdünken überlassen. Dagegen ginge mit jeder Statue ein Zwölftel des Eigentums an einem Hause auf Michelangelo über, das der Kirchenvorstand nach seinen Vorschlägen als Werkstätte für ihn erbauen ließ, so daß es mit der Ablieferung des letzten Apostels völlig in seinen Besitz gelangte. Dies war gewiß lockend, und trotzdem kam nichts zustande als der Apostel Matthäus in den gröbsten Umrissen, der heute im Hofe der Akademie von Florenz steht.
Michelangelo wollte seinen David fertig bringen. Hier hielt er Wort. Zwar vollendete er ihn nicht, wie Condivi sagt, in achtzehn Monaten, auch nicht in den bedungenen zwei Jahren: die Arbeit dauerte einige Monate darüber hinaus; aber wenn man die unruhigen Verhältnisse der Stadt bedenkt und die Zwischenaufträge, denen Michelangelo sich nicht zu entziehen vermochte, so erscheint dieser Zeitraum gering genug. Er arbeitete so fleißig, daß er nachts oft angekleidet schlief, wie er von der Arbeit hinfiel, um anderen Tages gleich wieder daranzugehen. Am 25. Januar 1504 beriefen die Konsuln der Wollenweberzunft eine Versammlung der ersten florentinischen Künstler. Der David des Michelangelo sei so gut wie fertig: es solle beraten werden, wo er am besten aufzustellen sei.
Das hierüber geführte Protokoll ist noch vorhanden. Es teilt den Wortlaut der vorgebrachten Meinungen mit und ist auch deshalb wichtig, weil es über den Personalbestand der im Jahre 1504 zu Florenz befindlichen Künstler von Bedeutung Auskunft gibt. Es führt uns in die Bewegung jenes Tages, an dem Michelangelo zum ersten Male sein Werk den Blicken der Meister preisgab. In der Werkstätte angesichts der Statue traten die Männer zusammen. Michelangelo hatte die letzte Zeit einen Bretterzaun um sein Werk gezogen und niemandem Zutritt gestattet, jetzt aber stand der jugendliche Riese unverhüllt vor aller Augen und forderte Lob und Tadel von denen, die in der ganzen Stadt zu einem Urteil die Berufensten schienen.
Messer Francesco, erster Herold der Signorie, eröffnete die Sitzung. »Ich habe die Sache in meinem Geiste hin und her überlegt und reiflich erwogen«, beginnt er. »Zwei Orte habt ihr, wo die Statue stehen kann, entweder da, wo die Judith steht, oder im Hofe des Palastes, wo der David steht.« Eingeschaltet sei hier die Bemerkung, daß beides Werke Donatellos sind. Die Judith, ein Bronzeguß, der jetzt unter einem Bogen der Loggia bei Lanzi seinen Platz hat, wurde im Jahre 1495 aus dem Palaste Medici fortgenommen und neben dem Eingange des Regierungspalastes aufgestellt, eine mehr seltsame als anziehende Arbeit. Der David, der mit dem einen Fuße auf das Haupt Goliaths tritt und in der Hand ein Schwert hält, ist dieselbe Statue, die Michelangelo für den Herzog von Nemours zu kopieren hatte. Der Hof des Palastes, in dem sie damals befindlich war, ist eng, weil das Gebäude sich so hoch erhebt und von schöner Architektur, und das Licht, das aus der Höhe herabfällt, von eigentümlich bläulichem Schimmer. – »Für den ersten Ort«, fährt Messer Francesco fort, »spricht, daß er für die Judith, als ein böses Omen, nicht geeignet ist. Denn unsere Abzeichen sind das Kreuz und die Lilie, und es ist nicht gut, daß da eine Frau stehe, welche einen Mann tötet. Auch wurde sie unter einer ungünstigen Konstellation daselbst aufgestellt. Deshalb ist es auch seit der Zeit immer schlechter und schlechter bei uns gegangen und Pisa verloren worden. Was dagegen den David im Hofe des Palastes anbetrifft, so ist er unvollkommen, denn von hinten angesehen, bietet sein eines Bein einen häßlichen Anblick dar. Deshalb geht mein Rat dahin, dem Giganten einen dieser beiden Plätze zu geben, am liebsten den, wo die Judith steht.«
Wie seltsam klingt der politische Aberglaube dieses Mannes! So war der Boden beschaffen, auf dem Savonarola festen Grund gefunden zu haben glaubte. Ein Wust solcher Ideen flatterte in der Atmosphäre jener Zeit umher und umspann Hoch und Niedrig mit seinen Fäden.
Der Architekt Monciatto ist der Zweite, der seine Meinung abgibt. »Ich glaube«, sagt er, »daß alle Dinge ihren Zweck haben und daß sie dafür angefertigt werden. Da nun diese Statue dafür gemacht worden ist, um auf einem von den Pilastern außerhalb der Kirche oder auf einem der inneren Pfeiler ihren Platz zu finden, so sehe ich keinen Grund ein, sie jetzt daselbst nicht aufzustellen. Sie schiene mir da als ehrenvolle Zierde der Kirche und des Kirchenvorstandes und auch an einem vom Verkehre berührten Orte zu stehen. Indessen, da ihr doch einmal von der ersten Ansicht abgegangen seid, so sage ich, man möge sie im Palaste oder im Inneren der Kirche aufstellen. Da ich übrigens nicht sicher hin, wo sie am besten stehen wird, so halte ich mich an das, was die anderen sagen: die Zeit war zu kurz, um über einen besseren Platz nachzudenken.«
Nach ihm nimmt Cosimo Roselli das Wort, einer der älteren Meister, der etwas steif und hölzern in seinen Bildern erscheint. Er drückt sich ebenso konfus wie sein Vorgänger aus. Er stimme den beiden Herren bei. Am besten würde die Statue im Inneren des Palastes stehen. Übrigens sei seine Ansicht gewesen, man solle sie an der Treppe vor der Kirche rechter Hand auf einen hohen verzierten Unterbau stellen. Da würde er sie hinbringen, wenn er zu bestimmen hätte.
Sandro Botticelli äußerte hierauf, Roselli habe gerade den Ort getroffen, den er auch meine. Alle Vorübergehenden sähen den David da am besten. Als Pendant auf die andere Seite könne man eine Judith hinstellen. Doch meint er, auch unter der Loggia neben dem Palaste der Regierung sei ein guter Platz für sie.
Nun kommt Guiliano di Sangallo zu Worte, einer der berühmtesten Architekten und Ingenieure in Italien. Er und sein ebenso berühmter Bruder Antonio standen in Diensten der Republik und waren oft mit der Errichtung von Festungswerken oder städtischen Bauten beauftragt. Er ist dafür, die Statue unter den mittelsten Bogen der Loggia zu stellen. Der Marmor sei zart und durch die Witterung bereits angegriffen, er müsse bedeckt stehen. Doch könne man sie auch an die innere Rückwand der Loggia bringen mit einer schwarz ausgemalten Nische dahinter.
Diese Meinung, daß der David ein Dach über sich haben müsse, erhält erneute Wichtigkeit, weil seine heutige Versetzung zum Teil ähnlicher Gründe wegen erfolgt ist. Sangallo wurde nicht gehört. Drei Jahrhunderte lang stand die Statue an der freien Luft, bis ihr Zustand es notwendig machte, sie unter Dach und Fach zu schaffen. Die heutigen Florentiner waren dagegen, weil der David auf seinem alten Platze bleiben müsse. Damals hätte man besser getan, ihn unter die Loggia zu stellen.
Am 25. Januar 1504 hatte man die wichtigsten Bedenken gegen die Loggia. Der zweite Herold der Signorie tat sofort Einspruch. Die Loggia werde zu öffentlichen Feierlichkeiten gebraucht; sollte der David durchaus darunter stehen, so möge man ihn unter ihren offenen Seitenbogen nach dem Palaste hin aufstellen. Da stände er unter einem Dache und zugleich niemandem im Wege. Auch machte er den Vorschlag, ob die versammelten Herrschaften sich nicht lieber, bevor sie einen Beschluß faßten, an die Herren von der Regierung selber wenden wollten, unter denen Leute wären, die mit solchen Dingen Bescheid wüßten.
Nachdem eine Anzahl anderer Künstler nichts Neues vorgebracht, begegnen wir jetzt einem Manne, der sich in dieser Versammlung durch seine Worte allerdings nicht hervortat, der aber als der größte aller damals lebenden Künstler nach kurzer Zeit auch Michelangelo gegenüber hohe Bedeutung gewinnt: Leonardo da Vinci.
Leonardo war schon im Jahre 1499 nach Florenz zurückgekehrt und vielleicht bereits dort anwesend, als Michelangelo aus Rom kam. Lodovico Sforza, sein Herr, dem er beinahe zwanzig Jahre lang gedient, fiel als das Opfer der eigenen ränkevollen Politik. Die Franzosen nahmen ihm sein Land, er flüchtete nach Deutschland, kam zurück, wurde abermals geschlagen, erkannt, als er in erbärmlicher Verkleidung davonzukommen versuchte, und nach Frankreich geschleppt, wo er nach zehn Jahren elenden Gefängnisses abstarb.
Leonardo nahm an des Herzogs Hofe und in Mailand eine Stellung ein, wie er sie nirgends wiederzufinden hoffen durfte. Bei allen künstlerischen Unternehmungen zu Rate gezogen, als Baumeister am Dome angestellt, als Gründer einer Malerakademie, als Ingenieur für Wasserbauten und Kriegswesen im höchsten Ansehen, malte er Bild auf Bild zur Vergrößerung seines Ruhmes und krönte zuletzt alles, was er geleistet, durch das Abendmahl im Kloster Santa Maria delle Grazie, wo dies Gemälde eine Wand des Speisesaals einnimmt. Es war hergebracht in den italienischen Klöstern, eine solche Darstellung an dieser bestimmten Stelle anbringen zu lassen.
Heute noch, wo das Werk beinahe verschwunden ist, wirkt es mit unwiderstehlicher Gewalt durch die Bewegung der Gestalten und durch die Kunst, mit der sie zu Gruppen verbunden sind. Christus bildet die Mitte; zur Rechten und zur Linken zwei Gruppen, jede von drei Gestalten. Dadurch nun, daß im ganzen die größte, fast architektonische Symmetrie herrscht, im einzelnen aber eine Freiheit, durch die in der Stellung jeder Figur ihr ganzer Charakter zum Ausdruck kommt, entsteht eine Wirkung, die in Momenten der Bewunderung zu der Behauptung nötigen könnte, es sei dies die schönste und erhabenste Komposition, die jemals ein italienischer Meister zustande brachte. Sicherlich ist sie das früheste Werk jenes großartigen neuen Stiles, in dem Michelangelo und Raffael später malten, denen dies Gemälde jedoch niemals zu Gesicht kam, da keiner von beiden in Mailand gewesen ist.
Leonardos Lieblingsarbeit aber war eine Reiterstatue, die Francesco Sforza, den Vater des Herzogs Lodovico, darstellte. Sechzehn Jahre brauchte er, um das Modell zu verfertigen. Im Jahre 1493, als Bianca Sforza den Kaiser Maximilian heiratete und die Hochzeit in Mailand prachtvoll begangen wurde, war es unter einem Triumphbogen ausgestellt. Und jetzt, bei der Eroberung der Stadt durch die Franzosen, hatte es den gascognischen Armbrustschützen zum Ziel für ihre Bolzen gedient. Der Herzog war gefangen, Leonardo verließ die Stadt. Er hat Unglück gehabt mit seinem Ruhme. Denn es war doch nur eine böse Laune des Schicksals, daß dieses Werk, an dem er zuletzt auf eigene Kosten hatte arbeiten lassen, weil dem Herzog das Geld ausging, nun so verlassen werden mußte, und daß das Abendmahl von der feuchten Mauer, auf die es gemalt worden ist, vorzeitig abblätterte, während viel ältere Malereien in demselben Saale unversehrt geblieben sind. Von dem Modelle der Statue hören wir zuletzt 1501, wo der Herzog Ercole von Ferrara sich vergeblich bemühte, das Pferd für Ferrara zu erhalten, das er zu seiner eigenen Statue verwenden wollte.
Dennoch besitzen wir noch genug Werke des großen Meisters, um die Erzählungen vom Zauber seiner Kunst nicht als inhaltslose Übertreibungen betrachten zu müssen. Man ist immer geneigt, hier ungläubig zu sein. Leonardos Gemälde aber sind von solchem Reize, daß die wahrhaftigste Beschreibung hinter ihnen zurückbliebe. Man würde es nicht für möglich halten, wenn man es nicht mit Augen sähe. Er besitzt das Geheimnis, das Klopfen des Herzens beinahe aus dem Antlitze derer lesen zu lassen, die er darstellt. Er scheint die Natur in ewigem Sonntagsglanze zu erblicken, gar nicht anders. Wir, weil unsere Sinne sich abstumpfen allgemach und weil wir denselben Verlust bei unseren Freunden entdecken, glauben zuletzt, der frische, frühlingsreine Anblick der Natur und des Lebens, der sich uns auftat, solange wir Kinder waren, sei nur eine Täuschung des Glücks gewesen, und das gedämpftere Licht, in dem sie uns später erscheinen, gewähre die wahrhaftigere Betrachtung. Aber treten wir vor Leonardos schönste Werke, ob da nicht die Träume idealen Daseins wieder natürlich und inhaltsreich erscheinen! Wie einem Magnete, der durch eisenhaltigen Sand fährt, die Splitter des Metalls zufliegen und in tausend feinen Spitzen an ihm haften bleiben, während die Sandkörner machtlos abfallen, gibt es Menschen, die, durch das tote Gewühl des ewigen Verkehrs hinstreifend, die Spuren des echten Metalls darin allein mit sich forttragen, willenlos, nur ihrer Natur nach, die es von allen Seiten her aufsaugt. Es sind seltene, bevorzugte Männer, denen das zuteil ward. Leonardo gehörte zu diesen Begünstigten des Schicksals. In Begleitung eines wunderschönen Jünglings erschien er jetzt in Florenz, Salainos, der ihm aus Mailand dahin gefolgt war, nach dessen krausen, ineinander geringelten Locken (begli capelli ricci e inanellati, sagt Vasari) er das goldschimmernde Haar mancher Engelsgestalten gemalt hat. Salaino war sein Schüler; noch deutlicher aber offenbart sich der Grundsatz, daß das Gleiche Gleiches an sich ziehe, in einem anderen seiner Schüler, einem schönen, jungen Mailänder aus guter Familie, Francesco Melzi mit Namen, dessen Gemälde von denen Leonardos kaum zu unterscheiden waren. Aber er malte wenig, weil er reich war. Beinahe dasselbe kann von Boltraffio, einem anderen seiner Schüler und mailändischem Edelmanne, gesagt werden.
Als Leonardo nach Florenz kam, war er der erste Maler Italiens. Filippino Lippi trat ihm eine Bestellung ab, ein Altarbild für die Kirche eines Klosters, in dem Leonardo mit seiner Dienerschaft sich einquartierte, dann aber lange zögerte, ehe er seine Arbeit in Angriff nahm. Ganz ebenso hatte er es in Mailand gemacht, ehe er das Abendmahl begann. Tagelang saß er dort, ohne die Hand zu rühren, vor seinem angefangenen Werke, in Betrachtungen verloren, und erwartete den Moment, wo sich ihm das Antlitz Christi so offenbaren würde, wie er es im Geiste zu erblicken wünschte. Es half nichts, daß der Prior des Klosters sich beim Herzog selber beklagte.
Endlich brachte er auch in Florenz etwas zustande, einen Karton, Christus, Maria und die heilige Anna. Das Volk von Florenz strömte in das Kloster, um dieses Werk zu bewundern. Sein höchster Triumph aber war das Bildnis der Mona Lisa, der Frau des Francesco del Giocondo, eine Schöpfung, die alles übertrifft, was die Kunst in dieser Richtung geschaffen hat. Franz der Erste erkaufte es nach Frankreich, wo es heute noch im Louvre zu sehen ist. Alle Beschreibung würde vergeblich sein. Wie das Antlitz der sixtinischen Madonna die reinste Jungfräulichkeit darstellt, so sehen wir hier die schönste Frau, weltlich, irdisch, ohne Erhabenheit, ohne Schwärmerei, aber von einer stillen, ruhenden Gelassenheit, mit einem Blick, einem Lächeln, einem sanften Stolze, der sie umgibt, daß man mit unendlichem Vergnügen ihr gegenübersteht. Es ist, als schlummerten in ihr die Gedanken, als lägen Liebe, Sehnsucht, Haß, alles was ein Herz erregen kann, eingesummt vom Gefühle genügsamen Glückes. Vier Jahre arbeitete er daran und gab das Bild, das die höchste Stufe der Vollkommenheit erreicht zu haben scheint, als unvollendet hin. Wenn er daran malte, mußte immer Saitenspiel und Gesang im Gemache sein, oder er lud geistreiche Leute ein, um die schöne Frau zu erheitern und den melancholischen Zug verschwinden zu lassen, der sich so leicht in ein Gesicht einschleicht, das stillhält, um gemalt zu werden. Ein solches Porträt war nicht geschaffen worden, solange es Künstler in Italien gab. Und so wuchs der Ruhm, den Leonardo aus Mailand mitgebracht, durch den, den er nun in seiner Vaterstadt frisch dazuerwarb.
Michelangelo konnte sich ihm als Maler nicht im Entferntesten vergleichen. Als Bildhauer aber nahm er die erste Stelle ein. Dennoch war es nicht möglich, daß die Gebiete scharf geschieden blieben, da jeder von beiden Bildhauer und Maler zugleich war. Dazu die Differenz des Naturells und des Alters. Michelangelos noch keine Dreißig, stolz und voll Bewußtsein dessen, was er getan hatte und tun wollte: Leonardo, ein bald fünfzigjähriger Mann, der seit langen Jahren am Hofe des reichsten Fürsten von Italien die erste Stelle eingenommen, empfindlich von Natur, durch die letzten Erfahrungen vielleicht sogar erbittert und nicht gewillt, mit einem anderen das Gebiet zu teilen, das er allein zu beherrschen gewohnt gewesen.
Bei dem Marmorblocke, den Sansovino gefordert hatte, geriet Michelangelo (wenn Vasari wahr ist) mit Leonardo zuerst zusammen, dem der Stein gleichfalls zugedacht gewesen war. Es wäre jedoch zuviel gewagt, wollten wir annehmen, daß Leonardos Abwesenheit im Jahre 1502 und im folgenden schon durch Eifersucht auf Michelangelo herbeigeführt worden sei. Während dieser Zeit stand er in Diensten Cesare Borgias als Architekt und General-Ingenieur der Romagna. Leonardo kannte den Festungsbau und was dazu gehört von Grund aus, es verlangte ihn nach einer Tätigkeit, die seine Kräfte in Anspruch nähme, endlich, er war daran gewöhnt, einem Fürsten zu dienen. Keinen besseren Herrn konnte er finden als den Herzog, dessen edlere Eigenschaften den seinigen entsprachen. Dieselbe Stärke war auch Leonardo eigen, der ein Hufeisen wie Blei zusammenbog. Cesare war von königlicher Freigebigkeit und einer der schönsten Männer. Seine ausgezeichneten Feldherrngaben erkannte jeder an, seine Armee, die Artillerie besonders, galt für die beste in Italien. Seine Zukunft schien gesichert. Er wollte sich ein Königreich zusammenerobern, und der Anfang, den er gemacht hatte, ließ große Dinge erwarten.
Damals nämlich, als die Medici im Jahre 1502 mit ihrer Expedition verunglückt waren, und auch ihm selber das florentinische Gebiet vom König von Frankreich als unangreifbare Ware erklärt worden war, hatte er sich gegen Urbino gewandt und dieses Herzogtum in seine Gewalt gebracht. Immer noch als Freund der Republik, die ihn sogar mit Mannschaften dabei unterstützte. Leonardos Dienst also war keine Verräterei an seinem Vaterlande, obgleich das nicht zu leugnen blieb, daß Cesares Absichten auf die Stadt sich nicht änderten, sondern nur aufgeschoben wurden.
Wie lange Zeit er beim Herzoge blieb, ist nicht genau anzugeben. 1503 finden wir ihn im florentinischen Lager vor Pisa und 1504 endlich wieder in der Stadt selbst, wo er neben anderen Arbeiten noch immer mit dem Porträt der Mona Lisa beschäftigt war.
In der Versammlung spricht er nur wenig Worte, mit denen er sich für Sangallos Ansicht erklärt; die Statue sei unter die Loggia zu stellen; es werde sich schon so einrichten lassen, daß die öffentlichen Festlichkeiten nicht darunter zu leiden hätten. Diese Meinung hatte an jenem Tage die Majorität für sich, scheint es. Zur Annahme gelangte sie jedoch nicht. Einer von den Herren, der Goldschmied Salvestro, trat mit dem Vorschlage auf, man möge doch denjenigen, der die Bildsäule gearbeitet hätte, auch den Ort bestimmen lassen, den sie künftig einnehmen solle. Er würde am besten wissen, wohin sie paßte. Darauf scheint man späterhin zurückgekommen zu sein. Michelangelos Ansichten aber stimmten mit denen des ersten Herolds der Signorie überein. Er verlangte den Platz neben der Türe des Palastes, und dafür entschied man sich.
Aus der Zahl derer, welche versammelt waren, nenne ich noch Filippino Lippi, Granacci, Pier di Cosimo, Lorenzo di Credi und zuletzt den, der nach Leonardo der wichtigste ist, Pietro Perugino. Er und Leonardo waren Jugendfreunde und bei Verrocchio zusammen in der Lehre gewesen. Perugino, schon an sechzig Jahre alt, hatte sich Ruhm und Geld erworben und besaß ein Haus in Florenz, wo er, umgeben von Schülern und von Bestellungen überhäuft, das tätigste Dasein führte. Er hatte in Florenz eine neue festere Manier an die Stelle der hergebrachten Delikatesse zu setzen gewußt und wird als der Gründer derjenigen Richtung betrachtet, in der Raffael so Großes leistete. Mit kräftigem Schatten rundete er seine Gestalten und löste sie los vom Hintergrunde, statt des üblichen Gedränges von Figuren, das die Gemälde der florentinischen Meister zu erfüllen pflegt, gab er geordnete Gruppen, die weniger zahlreich, aber vollendeter erschienen. Seiner Natur nach war er derb, zu handwerksmäßiger Ausbeutung seiner Kunst immer stärker hinneigend und ohne die Gabe, seinen Arbeiten den geheimnisvollen Reiz zu geben, der den Werken der größten Meister innewohnt.
Nehmen wir ihn in erneuter Verbindung mit Leonardo, zählen wir die Schüler und Genossen hinzu, die sich zu beiden hielten, und denken wir sie in Opposition gegen Michelangelo, so sehen wir diesen allein einer gewaltigen Gegnerschaft gegenüber. Es wäre nicht zulässig, dergleichen anzunehmen und die Gefühle, die durch spätere Ereignisse erregt wurden, auf diese Zeiten schon zurückzudatieren, wenn nicht die bestimmtesten Andeutungen vorlägen, die dazu berechtigten. Denn noch war der David nicht auf seiner Stelle, und all der Ruhm, der Michelangelo daraus erwuchs und den Neid der anderen hätte erwecken können, kaum im Entstehen begriffen, als schon der bittere Haß gegen ihn zum Durchbruch kan.
Die Statue hatte ein Gewicht von 18 000 Pfund. Cronaca erfand das Gerüst, um sie fortzuschaffen, ein Balkengestell, innerhalb dessen sie an hänfenen Stricken ausgehangen war. Sie blieb so in leise schaukelnder Bewegung ohne anzustoßen, während das Ganze, auf vierzehn geölten Balken liegend, durch Winden langsam fortgezogen wurde. Vierzig Mann arbeiteten daran. Vasari lobt die eigentümlich geschlungene Schleife des Strickes, die sich bequem umlegte und von selbst immer fester anzog.
Am 14. Mai abends um Ave Maria wurde die Statue aus der Werkstätte ins Freie gezogen. Die Mauer über dem Tor hatte müssen durchbrochen werden, um den Ausgang zu ermöglichen. Die Figur hing aufrecht schwebend inmitten des Gerüstes. Man kam langsam vorwärts und verließ sie mit einbrechender Nacht, um am Morgen weiterzuarbeiten. Nun zeigte sich, was Giovanni Piffero, einer der beratenden Meister vielleicht damit gemeint, als er gesagt, es könne ihr, wenn sie in der Loggia stände, leicht ein schlechter Kerl mit einer Stange einen Stoß versetzen: denn bei Nacht wurde jetzt mit Steinen nach ihr geworfen. Eine Wache mußte geordert werden, um sie zu schützen. Drei Tage dauerte der Zug durch die Straßen und nachts die Angriffe. Man attackierte die Wachen, und acht von denen, die ergriffen wurden, kamen ins Gefängnis. Kein Gedanke daran, daß Leonardo oder Perugino auch nur eine Ahnung von diesen Schändlichkeiten gehabt, zu natürlich aber die Annahme, daß die später offen ausbrechende Feindschaft zweier künstlerischer Parteien beginnend hier schon ihren Einfluß geäußert.
Am 18. Mai 1504 mit Anbruch des Tages langte man auf dem Platze an. Die Judith des Donatello wurde beiseite geschafft und der David an ihre Stelle gesetzt. Michelangelo hatte die Größe des Blockes so vollständig benutzt, daß oben auf dem Haupte der Statue ein Stückchen von der natürlichen Rinde des rohen Steins sichtbar geblieben war. Der David steht einfach da. Mit scharfem Blicke scheint er ein Ziel ins Auge gefaßt zu haben. Der rechte Arm, in dessen Hand die Schleuder liegt, fällt in natürlicher Ruhe an der Seite herab. Die Linke ist vor der Brust erhoben, als wolle sie einen Stein in die Schleuder legen. Sonst nichts Fremdes an ihm; völlig nackt ist er, das ungeheure Bild eines etwa sechzehnjährigen Jünglings.
Seine Aufstellung war ein Naturereignis, nach dem das Volk zu rechnen pflegte. Man findet: so und so viel Jahre nach der Aufstellung des Giganten. Das wird angeführt in Aufzeichnungen, in denen sonst keine Zeile für die Kunst übrig war. Seit Jahrhunderten stand der David nun an der Tür des dunklen, gewaltigen Palastes, die Schicksale der Stadt sind mit an ihm vorübergegangen, und die Florentiner hatten recht, den David als den guten Genius ihrer Stadt zu betrachten, der da stehen bleiben sollte, wohin der Meister selber ihn gestellt hatte.
Es hat dreißigjähriger Verhandlungen bedurft, ehe man sich entschließen konnte, ihn heute dennoch von seinem Posten hinwegzunehmen. Es zeigten sich Risse im Marmor, welche, wenn die Statue nicht an einen geschätzten Ort gebracht wurde, verderblich zu werden drohten. Wie bei jener ersten Verhandlung der alten florentinischen Meister wurde nun abermals die Loggia dei Lanzi in Vorschlag gebracht, endlich aber der Bau eines besonderen Saales in der Akademie der Künste beschlossen, wohin das Werk im Jahre 1876 gestellt worden ist und wo es, gereinigt und vortrefflich aufgestellt, größer und schöner erscheint als vor dem Palaste, da der Marmor an vielen Stellen schmutzig oder dunkel geworden war, so daß einzelne Teile, besonders das Antlitz, verändert und entstellt erschienen.
Um die Stadt für den Verlust jedoch zu entschädigen, hat man die Statue in Erz gießen lassen und sie auf erhabenem Postamente inmitten des nach Michelangelo genannten neuen Platzes aufgestellt, der, am nördlichen Abhange von San Miniato gelegen, jetzt einen schönen Blick weit über das Land bietet. Von hier aus beherrscht die Gestalt Florenz und das Tal des Arno, bis fern zu den Gebirgen, die es nach rechts hin abschließen, und weit in die Ebene hinein, die sich, zur Linken, nach Pisa hin auftut. Alles, was Michelangelo an seiner Vaterstadt teuer war, umspannt unser Auge hier in leichter Bewegung. Die Statue selber in ihrem dunklen Erze, mit dem lichten Himmel oder auch mit Gewölk als Hintergrund, scheint wie in ein neues Element erhoben zu sein: sie wirkt kolossaler als sie unten auf dem Platze getan. Sie erscheint schlanker, und das Momentane der Bewegung tritt schärfer hervor.
Ja, es ließe sich behaupten, daß das Erz günstiger für die Gestalt sei als der Marmor, und daß Michelangelo, wenn er heute lebte, die Vertauschung des Materiales nicht mißbilligt hätte.
II
Die Vollendung des David traf in einer Weise mit der Befreiung der Stadt von ihren drei gefährlichen Feinden zusammen, daß seine Aufstellung auch dadurch zu einem denkwürdigen Moment ward.
Die beiden ersten, die zugrunde gingen, waren die Borgia, Vater und Sohn. Cesare Borgia oder, wie er nach seiner Heirat mit einer französischen Prinzeß gemeinhin genannt wurde, der Duca Valentino stand im Jahre 1503 auf dem Gipfel seiner Macht. Die Romagna, Urbino und Piombino gehorchten ihm, Ferrara dem Gemahle seiner Schwester, Pisa, Siena und Florenz lag die Schlinge um den Hals, mit Venedig stand man in gutem Einvernehmen; Neapel war der letzte große Fang, den er zu tun hoffte. Einstweilen, im Herbste des Jahres, hatte er auf Pisa sein Auge geworfen, an dem sich Florenz noch immer fruchtlos abarbeitete.
Er verstärkte seine Truppen und schaffte mehr Geld zusammen. Vater und Sohn bedienten sich verschiedener Mittel zu diesem Endzweck. Reiche Leute, denen sich beikommen ließ, vergifteten sie und setzten sich in Besitz der Erbschaft. Das Gift, dessen sich der höchste Priester der Christenheit zu diesem Zwecke gewöhnlich bediente, war ein schneeweißes Pulver von großer Feinheit und angenehmem Geschmacke, das langsam wirkend in den Körper überging, aber sicher bis zum gewünschten Ende fortwirkte. In anderen Fällen wandte man raschere Mittel an. Am beliebtesten war der einfache Mord, der dann sogar notwendig erschien, wenn derjenige, auf den die Borgia es abgesehen, in Essen und Trinken Vorsicht anwandte. Denn man suchte sich zu schützen. Es kam vor, daß große Herren, welche von den Päpsten gefangen gesetzt wurden, beinahe verhungerten, weil sie sich die fremden Speisen anzurühren weigerten.
Der 15. August 1503 war zu einer jener stilleren Hinrichtungen bestimmt, der Kardinal von Corneto das ausersehene Opfer. Der Papst gab sich gegen Abend nach seiner dicht beim Vatikan gelegenen Villa, dem Belvedere, wo man sich von der Hitze des Tages erholen wollte. Einige Flaschen vergifteter Wein waren vom Herzoge einem der aufwartenden Diener mit der Weisung übergeben worden, nur den Kardinal und keinem anderen daraus einzuschenken.
Die Hitze war groß, der Papst fühlte sich ermattet und durstig, die Mahlzeit war noch nicht bereit, ja der Mundvorrat, den man erwartete, noch gar nicht eingetroffen. Er verlangte zu trinken; nur einige Flaschen Wein fand man vor, niemand wußte, wie gefährlich sie waren, oder die, welche es wußten, wollten sich nicht daran erinnern – er trank davon und Cesare, der dazukam, ließ sich ebenfalls verlocken. Der Papst stürzte sogleich wie tot zu Boden und wurde sterbend in den Vatikan getragen. Am dritten Morgen lag seine Leiche in Sankt Peter. Ungeheurer Jubel erfüllte die Stadt, die Römer stürzten herbei und konnten sich nicht sättigen an dem Anblick dieses Mannes, der, blau und aufgedunsen, endlich machtlos und vernichtet war wie eine Schlange. die sich mit ihrem eigenen Gifte getötet hatte.
Cesare kam davon. Er kannte Gegenmittel und war rechtzeitig damit versehen worden. Seine Riesennatur überwand den Angriff, aber jetzt im wichtigsten, entscheidendsten Momente seiner Laufbahn sah er sich krank und beinahe unfähig, seine Macht wirken zu lassen. Daß der Papst sterben müßte, hatte er vorausgewußt; die spanischen Kardinäle waren von ihm gewonnen, er wollte einen Papst machen, wie er ihn brauchen konnte. Jetzt beklagte er sein Schicksal, daß er alle Möglichkeit berechnet, nur die eine nicht, die Krankheit, die ihm die Hände fesselte.
Gewählt wurde der Kardinal Piccolomini, derselbe, für den Michelangelo in Siena zu arbeiten hatte, alt und kränklich, ein Auskunftsmittel, weil man sich noch nicht verständigen konnte. Er bestieg als Pius der Dritte den heiligen Stuhl. Während seiner Regierung vereinigten sich die Kardinäle: er wurde vergiftet und mit seltener Einstimmigkeit nun der Kardinal Vincula an seine Stelle gewählt. Mitbewerber waren die Kardinäle d'Amboise und Ascanio Sforza. Vincula trat unter dem Namen Giulio der Zweite die Regierung an. Ein alter Mann, zerfressen von Leidenschaften und von der Krankheit, die damals Europa peinigte. Man hat in einem Zuge ein Bild seines Charakters, wenn man erwägt, daß es ihm, dem unermüdlichen Todfeinde der Borgias, trotz allem Geschehenen gelang, Cesare durch Versprechungen auf seine Seite zu bringen. Nach einem solchen Meisterstücke waren die übrigen Kardinäle leichtere Arbeit. Seine Verheißungen überstiegen alles Maß und wurden doch für bar angenommen. Wer ihm nur irgend nützlich sein konnte, empfing zugesagt, was er begehrte. Sein Leben lang war Vincula als ein Mann bekannt gewesen, der das gegebene Wort hielt. Alexander Borgia sogar hatte das anerkannt. Jetzt verwertete er den so mühsam erworbenen guten Namen. Dennoch war es kein Geiz, der ihn so handeln ließ, denn was er besaß, gab er hin. Er wollte unter allen Umständen Papst werden.
Am ärgsten wurde aber dem Herzoge mitgespielt, der im Besitz der Engelsburg die Stadt beherrschte und dessen Truppen drohend in der Romagna lagen. Cesare erhielt das Versprechen, alles werde ihm erhalten bleiben; ferner, seine Tochter solle mit Maria Francesco della Rovere, dem Neffen des Papstes, verheiratet werden; zum Schluß, er solle, wozu ihn sein Vater gemacht, Generalkapitän des päpstlichen Heeres bleiben. Giulio nahm ihn zu sich in den Vatikan; sie wohnten da zusammen; in der innigsten Übereinstimmung lebend, berieten sie die Zukunft. Endlich macht sich Cesare auf, um seine Staaten zu erreichen. In Ostia aber holen ihn die Leute des Papstes ein, er müsse noch einmal mit ihnen zurück. Er wittert Unrat und rettet sich vor der Gewalt auf ein spanisches Schiff, das ihn nach Neapel bringt, wo er von Gonsalvo di Cordova, dem spanischen Vizekönig, glänzend aufgenommen wird. Von dort will er sich nun in die Romagna begeben, allein als er eben das Schiff bestiegen hatte, wird er plötzlich zum Gefangenen erklärt und nach Spanien geführt, von wo er nie wieder nach Italien zurückkehrte. Wie dieses Ende der Borgias ein ihrem Leben entsprechendes war, so ist der Tod Piero dei Medicis mit dem seinigen im Einklang. Nach dem für ihn so beschämenden letzten Rückzuge aus Toskana hatte er Florenz einstweilen aufgegeben und war zur französischen Armee nach Neapel gegangen. Aber auch hier verfolgte ihn das Unglück. Die Spanier begannen gerade die Oberhand zu gewinnen. Am 28. Dezember kommt es am Garigliano zur Schlacht. Es handelte sich darum, den Fluß mit Gewalt zu überschreiten. Die Franzosen werden geschlagen, und Piero ertrinkt. In Montecassino liegt er begraben.
Den Florentinern blieb jetzt nur eine Sorge noch: Pisa war wieder zu erobern. Erlöst aber von dem Drucke der Befürchtung, die ihnen von den Borgias und Medicis erwuchs, konnten sie den Krieg mit den besten Hoffnungen auf Erfolg fortsetzen
III
Nachdem Michelangelo sich in solcher Weise ausgezeichnet hatte, fühlte man, scheint es, in Florenz, daß auch Leonardo da Vinci Gelegenheit gegeben werden müsse, etwas Großes zu tun. Soderini, seit dem Herbste 1502 zum Gonfalonier auf Lebenszeit erwählt, weil die Stadt ihm und seinem Bruder, dem Bischof von Volterra, die rettende Hilfe Frankreichs zu verdanken hatte, war Leonardos besonderer Freund. An Soderini lag es wohl, daß man einen würdigen Auftrag als Ehrensache ansah. Er machte den Vorschlag, die leeren Wände des Saales, in welchem das Consiglio grande tagte, mit Gemälden bedecken zu lassen. Anfangs Februar 1504, kurze Zeit also, nachdem über den David beraten worden war, erhielt Leonardo den Auftrag, die eine große Wand des Saales auszumalen. Zur Anfertigung des Kartons richtete man ihm den sogenannten Saal des Papstes im Kloster Santa Maria Novella ein, wo in früheren Zeiten die Päpste und anderer fürstlicher Besuch abzusteigen pflegten,
Über den Inhalt des von ihm geschaffenen Gemäldes sind wir nicht ganz im klaren, da es samt dem Karton zugrunde gegangen ist und die vorhandene Kopie nicht mit der Beschreibung stimmt, welche von Leonardos eigener Hand davon auf unsere Tage kam. Seine Worte umfassen ein kompliziertes Werk mit vielen Gruppen, die sich zu einem Ganzen verbinden, die Kopie dagegen gibt nur eine einzige Gruppe, ein Gefecht von Reitern, die wahrhaft furienmäßig ineinander verbissen sind. Menschen und Pferde fallen sich an und bilden ein Knäuel, dessen Mittelpunkt ein seine Fahne verteidigender Krieger ist. Eine Art kannibalischer Mordwut erfüllt die Gesichter und die ganzen Gestalten; seltsame Rüstungen nach Art der alten Römer bedecken sie; in kühnen Stellungen winden sich die Körper – alles meisterhaft gezeichnet. Jedenfalls bildeten diese kämpfenden Reiter den Mittelpunkt des Gemäldes. Die uns erhaltene Kopie ist von Rubens, sehr wirkungsvoll gestochen von Edelinck. Doch wissen wir nicht, wie viel Rubens von seinem Eigenen dazutat und wie treu er sich an das Original gehalten hat. Die Florentiner müssen wie verblüfft vor dem Werk gestanden haben. Es war durchaus etwas Neues. Niemand konnte erwarten, daß derselbe Künstler, der bisher so zarte Bilder nur seiner sanft hinträumenden Phantasie entlockte, in kolossalen Figuren die entfesselten Leidenschaften wütender Soldaten darstellen würde.
Michelangelo verbrachte den Sommer 1504, währenddem Leonardo mit diesem Werke beschäftigt war, ohne anstrengende Arbeit. Er las die Dichter und dichtete selbst, sagt Condivi. Zu tun war indessen immer noch so viel, daß er vom Morgen bis zum Abend hätte arbeiten können. Der David von Bronze wartete auf seine Vollendung; für den David vor dem Palaste mußte noch das Postament geschafft werden: erst im September waren alle Arbeiten daran beendet; die zwölf Apostel für Santa Maria del Fiore warteten: endlich die Arbeiten für den Dom von Siena. Hieran scheint er zunächst gedacht zu haben, bewogen wohl durch Piccolominis Wahl zum Papste. Im Oktober 1504 waren vier Stück Statuen fertig, andere aber bereits vorausbezahlt. Der Kontrakt wurde erneuert und mehr Zeit zugestanden. In zwei Jahren sollten die übrigen elf nachgeliefert werden. Würde Michelangelo krank, heißt es in dem Schriftstücke, so käme die verlorene Zeit in Abzug.
Die Klausel scheint mehr allgemeiner Vorsicht als besonderer Befürchtung entsprungen zu sein, denn obgleich Michelangelo in seiner Jugend von zarter Konstitution war, so änderte sich das in der Folge. Sein Körper wurde immer kräftiger. Er war mager, von festen Sehnen und gedrungenem Körperbau; er hatte breite Schultern, von Natur aber war er eher klein als hoch gewachsen zu nennen. Enthaltsamkeit in jeder Beziehung und die Arbeit stählten ihn. Zu entbehren brauchte er nichts, denn er verdiente große Summen, aber er ließ das Geld liegen oder unterstützte seine Familie damit. »So reich ich bin«, sagte er einmal in hohem Alter zu Condivi, »ich habe doch immer wie ein armer Mann gelebt.« Auch darin stach er ab gegen Leonardo, der im Bewußtsein seiner schönen Gestalt Luxus um sich her bedurfte und mit Gefolge einherzog.
Feurige Augen und ein prachtvoller Bart gaben diesem ein absonderlich imponierendes Aussehen, Michelangelos Kopf dagegen war fast abnorm gebildet. Die Stirn stand mächtig vor, der Schädel war breit, die untere Partie des Gesichtes geringer als die obere, er hatte kleine, lichte Augen; was ihn aber geradezu entstellte, war die Nase, die ihm Torrigiano, einer seiner Mitschüler im Garten der Medici, durch einen Faustschlag zerschmettert hatte. Michelangelo soll ihn gereizt haben; doch wird anders behauptet, es sei der bloße Neid gewesen. Er wurde damals für tot nach Hause getragen. Torrigiano mußte flüchten und durfte lange Jahre nicht nach Florenz zurückkehren. Er war ein roher Mensch, der sich öffentlich seiner Tat rühmte (Benvenuto Cellini erzählt es) und später elend ums Leben kam.
Vielleicht war es die Entstellung seines Gesichtes, die Michelangelos natürliche Neigung zu Melancholie und Einsamkeit erhöhte und ihn herb und ironisch machte. Er war im höchsten Grade sanft, duldsam und gutmütig, er hatte eine natürliche Scheu, den Leuten wehzutun, aber in Sachen der Kunst duldete er keine Kränkung seines guten Rechtes. Er erkannte die anderen unparteiisch an, aber auch sie sollten ihn nicht für leichter nehmen, als er in der Tat wog. Er besaß ein gewaltiges Selbstgefühl; wo ihm deuchte, daß er der Erste sein könnte, sollte es nicht an ihm liegen, daß dies verborgen bliebe.
Dieser Gesinnung entsprachen vielleicht die Gründe, die ihn zum Entschlusse brachten, nun auch als Maler zu zeigen, was er vermochte. Leonardo war der größte: mit ihm mußte er sich messen. Leonardo malte die eine Wand des großen Saales; er wollte die andere malen. Die Nachrichten fehlen, ob sein Wille oder anderer Leute Meinung den ersten Anstoß gab, daß ihm im Herbste 1504 der Auftrag zukam, die zweite Wand des Saales mit einem Gemälde zu versehen. Soderini forderte ihn dazu auf, Michelangelo schlug ein. Diese Bestellung zeigte deutlicher als andere, welch ungemeinen Begriff man von seiner Fähigkeit hegte.
Er hatte so gut wie nichts gemalt bis dahin; die beiden Madonnen waren doch kaum zu rechnen. Diese Bilder, so ziemlich das einzige, das er zustande gebracht, konnten unter gewöhnlichen Umständen nicht genügen, um das Zutrauen zu erwecken, er werde jetzt ein kolossales Werk zu liefern imstande sein, würdig, einem Gemälde Leonardos gegenübergestellt zu werden. Und man traute es ihm dennoch zu! Leonardo, dem von Rechts wegen, wenn er seine Aufgabe würdig löste, die andere Wand hätte zufallen müssen, mußte sich gekränkt und gleichsam im voraus aufs ungünstigste beurteilt sehen, denn sein Karton war fertig, als Michelangelo den seinigen begann. Man räumte diesem einen großen Saal im Spital der Färber zu Sant Onofrio ein. Einige Daten aus Rechnungen, die Gaye auffand, kommen hier sehr zustatten. Am 31. Oktober 1504 erhält der Buchbinder Bartolommeo di Sandro sieben Liren für vierzehn Bogen bologneser Royalpapier zum Karton des Michelangelo; der Buchbinder Bernardo di Salvadore fünf Liren, um den Karton zusammenzukleben; im Dezember werden die Handwerker bezahlt, die das Papier auf das Gerüst aufgespannt haben; auch finden sich die Rechnung des Apothekers für Wachs und Terpentin, womit man Papier tränkte, das zu Fenstern dienen sollte. So sehen wir Michelangelo hier zeichnen, Leonardo dort malen, und Florenz nach innen und außen in zufriedenstellenden Verhältnissen. Niemals entwickelte sich die Blüte der Stadt ruhiger als in jenen Tagen, nie hat die Kunst in Florenz Größeres getan und Größeres verheißen als damals.
IV
Um diesem Anblick für unsere Augen den höchsten Glanz zu verleihen, stellt nun auch Raffael sich ein. Sein Vater, Giovanni Santi, ein Mann, der als Maler und Verfasser einer gereimten Chronik, welche die Geschichte seiner Landesherren, der Herzöge von Urbino, enthält, Ehrenwertes, wie man zu sagen pflegt, geleistet hatte, ließ ihn elfjährig als verwaistes Kind zurück. Er wurde von Hause fort zu Perugino nach Perugia in die Lehre getan und war genötigt, sich ganz auf sich selbst zu stellen. Wenig älter als zwanzig Jahre, hatte er es in Perugia schon dahin gebracht, als einer der besten Meister der Stadt bekannt zu sein. Er bedurfte einen größeren Wirkungskreis. So, vom Schicksal gezwungen, sich in die Welt zu schicken, und von der Natur mit einer Liebenswürdigkeit begabt, die das Wohlwollen der Menschen ihm zuwandte, betrat er in Florenz den günstigen Boden für eine höhere Entwicklung, und seine Werke zeigen, welch ungemeine Förderung ihm dort zuteil ward.
Wie kostbar wäre eine nähere Mitteilung aus dem Florentiner Leben dieses einzigen Winters, wo die drei größten Künstler der neueren Zeit zusammentrafen. Leonardo im Begriff, mit Michelangelo einen Zweikampf einzugehen, in dem es sich um eine ungeheure Beute von Ruhm handelte, Raffael zwischen beiden noch ohne feste Pläne und eigene Gedanken und nur mit einer Ahnung der großen Zukunft erst im Herzen, der er entgegenging. Wichtig wäre die nähere Kenntnis jener Epoche, weil in ihr die Keime zu den späteren persönlichen Verhältnissen der drei Meister zu liegen scheinen. Raffaels verstorbener Vater war mit Leonardo näher bekannt gewesen, Perugino, Raffaels Lehrer, mit ihm befreundet. Raffael, jung, feurig, anschmiegsam, sieht zum ersten Male die erstaunlichen Werke da Vincis und gerät hinein in die eifersüchtige Erregung der Parteien. War es nicht natürlich, daß er, statt an das zu glauben, was der Gegner all seiner Freunde und Gönner erst tun wollte, sich an das hielt, was diese selbst bereits geleistet hatten? Es ist so viel von dem gesprochen, was Raffael und Michelangelo in der Folge getrennt hielt: dies aber waren die Umstände, unter denen sie sich zum ersten Mal begegneten.
Wie verschiedenartig ist die Jugend dieser drei Männer und die Art, wie sie in die Kunst hineinkamen. Michelangelo gegen die Wünsche seiner Eltern durch unbeugsamen eigenen Willen; Leonardo als ein reicher, junger Mensch mit seinem Talente spielend; Raffael als der Sohn eines Malers, unter Farbentöpfen aufwachsend, als gäbe es auf der Welt nur diese eine Tätigkeit. Michelangelo von Anfang an selbständig, eigene Ideen verfolgend und in Opposition gegen Eltern und Meister; Leonardo nicht weniger eigenwillig seiner Phantasie nachgehend und im ganzen Gebiete des geistigen Schaffens umhersuchend nach Aufgaben, die ihn zur Erprobung seines Geistes verlockten; Raffael in einer stillen Nachahmung gegebener Vorbilder so sehr befangen, daß seine Werke kaum von den Arbeiten derer zu unterscheiden sind, mit denen er sich zusammenfand. Und auch die Zukunft, die sich diese Drei bereiteten, doch nur ein Produkt des einen hervorstehenden Charakterzuges, der genialen Launenhaftigkeit bei Leonardo, des heftigen Willens bei Michelangelo und einer fast weiblichen Hingabe an die Verhältnisse, die sein Schicksal gestalteten, bei Raffael.
Bei allen Dreien sollte hierin bald eine entscheidende Wendung eintreten, und zwar am ersten bei Michelangelo, den das Jahr 1505 mit dem Manne bekannt werden ließ, durch den er in seiner ganzen Größe erkannt und in allen seinen Fähigkeiten zur höchsten Entwicklung gezwungen ward.
Sechstes Kapitel
I
Die Politik des Vatikans hatte durch den Wechsel der Personen keine allzugroße Veränderung erlitten. Cesare Borgias Zweck war die Herstellung eines nationalen einigen Reiches gewesen, Giulio der Zweite wollte nichts anderes. Auch er hatte eine Familie, die er groß zu machen suchte, auch ihn unterstützte Gift, Mord, Verstellung und offene Gewaltsamkeit. Wie die Borgias mußte er zwischen Spanien und Frankreich die vorteilhafteste Mitte zu halten suchen. In zwei Punkten aber unterschied er sich vom Papste Alexander: er ließ nicht durch andere Krieg führen, sondern zog in eigener Person zu Felde, und was er eroberte, sollte der Kirche gehören und nicht den Roveres, seiner Familie. Diese beschränkte er auf Urbino, ihr Herzogtum. Als er starb, hinterließ er einen Schatz in den Gewölben der Engelsburg, den seine Verwandten nicht berühren durften, den kein anderer, als der auf ihn folgende Papst besitzen sollte. Eine rauhe, stolze Würde liegt in Giulios Auftreten, und seine Wildheit artet nie in Grausamkeit aus. Was ihn aber vor allen anderen Päpsten vor ihm und nach ihm geadelt hat, ist seine Freude an den Werken großer Künstler und der Blick, mit dem er sie erkannte und zu sich emporzog.
Unter den Männern, die er sogleich nach Rom berief, war einer der vornehmsten Giuliano di Sangallo. Dieser hatte in früheren Zeiten Ostia für ihn als Kardinal Vincula befestigt. Man setzt diese Bauten in den Anfang der Achtziger Jahre. Sangallo kam, als er damals nach Ostia berufen ward, aus Neapel, wo er im Auftrage des alten Lorenzo dei Medici einen Palast für den Herzog von Kalabrien, den Sohn des Königs baute. Er gehörte zu den glücklichen Leuten, die überall Ruhm und fürstliches Wohlwollen finden. In Mailand war er von Lodovico Sforza glänzend empfangen worden, in Rom mußte er für Vincula einen Palast bauen, Alexander der Sechste beschäftigte ihn, Cesare Borgia desgleichen; in Savona, dem Geburtsorte der Rovere, baute er für Vincula wiederum, dem er dann nach Frankreich folgte, wo ihm der König wohlgeneigt war, endlich nach Florenz zurückgekehrt, wurde er von der Regierung mit fortlaufenden Aufträgen versehen, bis ihn jetzt sein alter Gönner abermals nach Rom befahl.
Sangallo machte den Papst auf Michelangelo aufmerksam, und mitten aus der Arbeit am Karton heraus wurde dieser jetzt nach Rom berufen. Hundert Scudi Reisegeld zahlte man ihm auf der Stelle aus. Anfang März 1505 ist er in Rom eingetroffen.
Giulio wußte, trotz der Eile, mit der er ihn verlangt hatte, nicht gleich, was er ihm zu tun geben sollte. Einige Zeit ging darüber hin, bis er ihm den Auftrag zu einem kolossalen Grabmonument erteilte, das er für sich selber im Sankt Peter errichten lassen wollte. Michelangelo entwarf eine Zeichnung, und der Papst, entzückt davon, befahl ihm, in der Basilika von Sankt Peter sogleich den besten Platz für das Monument ausfindig zu machen.
Diese Kirche, ein ungeheures Werk aus den ältesten Zeiten des Christentums, an dem Jahrhunderte hindurch weiter gebaut worden war, besaß eine Fülle von Kunstschätzen. Giotto hatte Mosaikbilder für sie geliefert, die Pollaiuolli waren unter den letzten Florentinern, die in ihr arbeiteten. In einer ihrer Nebenkapellen, derjenigen, welche der heiligen Petronella geweiht war, stand Michelangelos Pietà. Mit all ihren Nebengebäuden, Klöstern und Kapellen, den Wohnungen der Geistlichkeit und dem vatikanischen Palaste selber, der dicht an sie stieß, bildete die Basilika von Sankt Peter eine Art geistlicher Festung, wie sie denn mehr als einmal mit Gewalt verteidigt und erobert worden ist. In ihr wurden die Kaiser gekrönt, die Tribute der Länder in Empfang genommen, die Bannflüche ausgesprochen oder aufgehoben. Zwei lange Reihen antiker Säulen trugen das Gebälke des Dachstuhls. In dem von Säulengängen umschlossenen Hofe vor ihr stand der ungeheure bronzene Pinienapfel, der einst die Spitze des Mausoleums des Hadrian gebildet hatte und jetzt hier zu einem Brunnen diente, dessen Wasser zwischen den Facetten herabrieselte. Die Fassade der Kirche mit ihren sechs Eingängen war mit Fresken geschmückt. Unaufhörlich wurde an diesem Zentralheiligtum der christlichen Welt gearbeitet und im Großen oder Kleinen Altes verändert und Neues hinzugefügt, wie das überhaupt bei den italienischen Kirchen der Fall zu sein pflegt.
Nikolaus der Fünfte faßte zuerst den Plan einer Umgestaltung, er wollte Palast und Kirche von Grund aus erneuern. Ein Modell wurde angefertigt und der Bau im Jahre 1450 begonnen. Fünf Jahre später jedoch starb der Papst. Paul der Zweite baute nach ihm weiter. Alles, was bei Michelangelos Ankunft hergestellt worden war, bestand aus dem Anfange einer neuen Tribüne, deren begonnenes Mauerwerk hinter der alten Basilika wenige Fuß über dem Erdboden emporragte.
Michelangelo sah sich die Arbeit an und erklärte, am geratensten würde sein, diese Tribüne zu vollenden und das Monument darin aufzustellen. Der Papst fragte, wie viel es kosten könne. 100 000 Scudi, meinte Michelangelo. »Sagen wir 200 000«, rief Giulio aus und gab Sangallo Befehl, die Lokalitäten in Augenschein zu nehmen.
Allein er beauftragte damit nicht bloß Sangallo, sondern ordnete diesem einen zweiten Architekten bei, den er ebenfalls in seine Dienste genommen hatte und der in Rom den Ruf als einer der ersten Baumeister seiner Zeit genoß: Bramante von Urbino. Dieser stand mit Sangallo in einem Alter. In Mailand hatte er zuerst gebaut, dann in Rom für die Borgia und verschiedene Kardinäle Kirchen und Paläste. An jenem Palast, den der Kardinal di San Giorgio ausführen ließ, als Michelangelo nach Rom kam, war Bramante mit beschäftigt. Jetzt hatte der Papst großartige Arbeiten für ihn vor, den Ausbau des vatikanischen Palastes, der mit dem durch ein Tal von ihm getrennten Belvedere zu einem großen Ganzen verbunden werden sollte.
Bramante und Sangallo, die einem Manne gegenüberstanden, dem das Gewaltigste eben groß genug war, brachten die Sache dahin, daß der Beschluß gefaßt wurde, die gesamte Basilika umzustürzen und einen neuen gewaltigen Tempel an ihre Stelle zu setzen. Beide entwarfen Zeichnungen dazu. Bramantes Vorschläge gefielen dem Papste besser als die Sangallos, dem der Bau bereits zugesagt worden war. Bramantes Pläne waren auch in der Tat von ausgezeichneter Güte; Michelangelo gibt ihm in späteren Zeiten dieses Lob, er sagt, daß jeder, der sich von seinen Zeichnungen entfernt hätte, sich von der Wahrheit entfernt habe. Sangallo aber, nichtsdestoweniger tief beleidigt, nahm seinen Abschied und kehrte, ohne sich durch Versprechungen halten zu lassen, nach Florenz zurück, wo er von Soderini mit offenen Armen aufgenommen ward.
Bramante behauptete das Feld. Sein Charakter läßt sich in starken Umrissen zeichnen. Erfindungsreich, unermüdlich und gewandt, wußte er sich trefflich in die Launen seines Herrn zu schicken, dessen ungeduldiger Hast, einen merklichen Fortgang der unternommenen umfangreichen Arbeiten mit Augen zu gewahren, er sogar durch Kunststücke zu genügen wußte. Auch blieb er, solange der Papst lebte, in Gnaden bei ihm, und es kam damals nicht zutage, daß er zu schwache Fundamente gelegt und für hohe Bezahlung schlechtes Mauerwerk geliefert hatte. Er war lebenslustig und brauchte Geld und suchte, im Gefühl seiner Schwächen mißtrauisch, die zu entfernen, von deren Scharfblick er Enthüllungen erwartete.
Diesem Manne mußte Michelangelo jetzt schon dadurch verdächtig erscheinen, daß er so jung so Bedeutendes geleistet hatte, verdächtig in noch höherem Grade, weil der Papst Gefallen an ihm fand. Durch Sangallo war er empfohlen und nach Rom gebracht. Was war natürlicher, als daß er diesen zurückzubringen strebte? Intrigante Naturen wittern überall heimliche Gegenbestrebungen. Bramantes nächste Sorge ging dahin, deshalb nun auch Michelangelo wieder fortzuschaffen.
Von dem Grabdenkmale des Papstes, wie es von Michelangelo damals projektiert worden war, haben wir die Beschreibungen der Biographen, und von seiner eigenen Hand, scheint es, eine getuschte Federzeichnung, die nach mannigfachem Wechsel der Besitzer jetzt in der Sammlung der Uffizien in Florenz aufbewahrt wird. Zwar bedurfte es vieler Entwürfe, ehe der Papst sich entschied, und es ist nicht sicher, ob das uns vorliegende Blatt gerade dasjenige war, auf das hin Giulio das Ganze für 10 000 Scudi in Auftrag gab. Allein, da die Zeichnung mit Condivis Beschreibung stimmt und keine abweichende Auffassung bekannt ist, so darf sie wohl einstweilen als die authentische betrachtet werden.
Das Monument bestand aus drei sich übereinander türmenden Teilen. Zuerst ein dreizehn Fuß hoher Unterbau auf einer Grundfläche von sechsunddreißig Fuß Breite zu einer Tiefe von vierundzwanzig. Die Florentiner Skizze stellt das Werk von einer der beiden schmaleren Seiten aus gesehen dar, und zwar wiederum nur zwei von den drei übereinander liegenden Teilen; das Papier scheint oben abgetrennt zu sein; die Spitze fehlt also. Wir sehen den Unterbau auf dieser Zeichnung in zwei architektonische Gruppen geteilt, die, nebeneinander liegend, die uns zugewandte Fläche bilden. Rechts und links zwei Nischen mit Statuen darin, zu beiden Seiten einer jeden Nische auf viereckigen, vorspringenden Piedestalen nackte Jünglingsgestalten, mit den Rücken an flachen Halbsäulen ruhend, an die sie wie Gefangene angefesselt sind, und die über ihren Köpfen, nach Art der Hermen, zu Gestalten römisch gepanzerter Männer werden, über deren Köpfen wiederum das den ganzen Unterbau umschließende, stark vorspringende Gesims liegt. Die Statuen in den Nischen sind Siegesgottheiten mit den besiegten Städten unter ihren Füßen, die nackten Jünglinge bedeuten die Künste und Wissenschaften, die mit dem Tode des Papstes zugleich ihr Leben aushauchen.
Sehen wir also auf der uns zugewandten Seite vier Jünglinge, vier nach oben in Männergestalten auslaufende Säulen und zwei Viktorien, und denken wir diese Anzahl viermal wiederholt, entsprechend den vier Seiten des Denkmals, so erhalten wir für dies mächtige Piedestal des übrigen Werkes vierzig Statuen allein.
Jede der beiden Nischen mit Statuen, Basis und Krönung bildet ein Ganzes, beide Ganze nebeneinander liegend die eine Seitenfläche. Doch stoßen sie nicht unmittelbar aneinander, sondern es liegt ein Raum dazwischen, der etwas zurücktritt und auf der Skizze eine glatte Fläche zeigt. An den beiden breiteren Seiten mußte dieser Zwischenraum bedeutend breiter sein, fast so breit als die beiden architektonischen Gruppen selbst, zwischen denen er lag. Ich vermute, daß in diese Flächen die Bronzetafeln mit Basreliefs und Inschriften eingelassen werden sollten, die Condivi im allgemeinen als zu dem Werke gehörig anführt.
Mitten auf diesem Unterbau erhebt sich das zweite Stockwerk, das eigentliche Grabgewölbe, in welchem der Sarkophag mit dem Leichnam ruhen sollte. Es ist offen an den Seiten, so daß man den Sarkophag darin erblickt. Wir sehen auf unserer Skizze das Kopfende desselben. An den vier Ecken dieses Grabgewölbes sitzen je zwei kolossale Gestalten, immer zwei nach jeder Seite hingewandt, und zwar so postiert, daß jede in der Mitte über einer jener architektonischen Gruppen des Unterbaues ihren Stand erhält. Man könnte danach das Ganze auch so beschreiben: es seien vier gewaltige Piedestale ziemlich nahe zusammengerückt, auf deren jedem zwei sitzende Gestalten erscheinen, an den vier Ecken eines Monumentes, das, mitten auf diese Masse gesetzt, auf jedem der vier Piedestale mit einer Ecke aufstände.
Die acht sitzenden Statuen sind Moses, Paulus, das tätige und das beschauliche Leben, mehr werden nicht genannt. Vasari und Condivi behaupten, es seien überhaupt im ganzen nur vier Statuen, an jeder Ecke eine also, gewesen. Die Zeichnung aber deutet deren acht bestimmt an, was auch der Idee und den Verhältnissen entsprechend erscheint.
Von dem, was sich endlich als Spitze über diesem zweiten Aufbau erhob, haben wir nur die Beschreibung. Zwei Engelgestalten sollten da gesehen werden, welche einen offenen Sarkophag mit der Statue des in Todesschlaf versunkenen Papstes darin auf ihren Schultern trügen; Vasari gibt ihnen den Namen Cielo und Cybele; Cybele, der Genius der Erde, weinend, weil die Erde einen solchen Mann verloren hat, Cielo, der Himmel, lächelnd, weil die Seligen bei Giulios Eintritt in Entzücken geraten.
Rechnet man die Höhe des Unterbaues dreizehn Fuß, die des zweiten darauf ruhenden Teiles neun, die des obersten etwa sieben, so ergeben sich dreißig Fuß für das gesamte Werk eher zu tief als zu hoch gegriffen. Über fünfzig Statuen, reichliche Bronzearbeiten und die feinste ornamentale Verzierung der Architektur durch Arabesken, Blumen und andere Ornamente –: ein Menschenleben scheint kaum ausreichend zur Ausführung eines solchen Projektes. Aber dergleichen Berechnungen schreckten weder den Künstler noch den Papst ab, der in hohen Jahren dennoch auftrat, als wollte er von frischem ein langes, ruhmgekröntes Leben beginnen.
II
Giulio drängte zu sofortiger Abreise nach Carrara. Michelangelo erhielt eine Anweisung auf tausend Dukaten an ein Florentiner Haus und verließ Rom.
Carrara liegt im nördlichen Teile von Toskana an der Grenze des genuesischen Gebietes, wo die Apenninen dicht an das Ufer des tyrrhenischen Meeres stoßen, nicht weit davon Sarzana und Pietrasanta. Acht Monate blieb Michelangelo in den Steinbrüchen dort. Er hatte zwei Diener und ein Gespann Pferde bei sich. Zwei von den an die Säulen angefesselten Gestalten ließ er dort schon im Groben zuhauen, der übrige Marmor wurde in Blöcken fortgeschafft. Der Kontrakt mit Schiffseigentümern aus Lavagna, einem nördlich gelegenen genuesischen Küstenstädtchen, lautet vom 12. November 1505. Für zweiundzwanzig Golddukaten übernehmen es die Leute, den Marmor nach Rom zu schaffen. Einen Teil der Steine schickte Michelangelo jedoch nach Florenz, wo die Arbeit bequemer und billiger zu haben war. Auch bei diesen ließ sich der Transport bis an Ort und Stelle zu Wasser bewerkstelligen.
Als er im Januar 1506 in Rom wieder ankam, lag ein Teil seiner Blöcke schon am Tiberufer; dennoch ging es schlecht mit dem Transport der übrigen, wie ein am letzten des Monats an seinen Vater geschriebener Brief zeigt. »Hier würde ich ganz zufrieden sein«, heißt es darin, »wenn nur mein Marmor kommen wollte. Ich habe Unglück bei der Sache, nicht zwei Tage, so lange ich wieder hier bin, ist gutes Wetter gewesen. Vor einigen Tagen wäre eine Barke, die gerade ankam, um ein Haar zugrunde gegangen. Als darauf bei schlechtem Wetter die Blöcke ans Land geschafft waren, trat der Fluß über und setzte sie unter Wasser, so daß ich bis heute noch nichts habe tun können. Den Papst muß ich durch Redensarten hinzuhalten suchen, damit ihm nicht die gute Laune ausgeht. Hoffentlich ist bald alles in Ordnung, und ich kann einen Anfang machen mit der Arbeit. Gott gebe es.«
»Nehmt alle meine Zeichnungen«, fährt er fort, »das heißt die Blätter, die ich in den Sack zusammenpackte, von dem ich euch sagte; macht ein Paket daraus und schickt es mir durch einen Fuhrmann. Aber verwahrt es gut, damit die Feuchtigkeit keinen Schaden tut, und paßt auf, daß auch nicht das kleinste Blättchen davon fortkomme, bindet es dem Fuhrmann auf die Seele, denn es sind Sachen von großer Wichtigkeit für mich dabei. Schreibt auch, durch wen ihr es schickt und was ich dem Manne zu zahlen habe. Michele (wahrscheinlich einer von den Arbeitern für das Denkmal) hatte ich brieflich gebeten, meine Kiste an einen sichern und bedeckten Ort zu schaffen und dann hierher nach Rom zu kommen und mich unter keinen Umständen im Stiche zu lassen. Ich weiß nicht, was darauf geschehen ist, bitte, erinnert ihn daran, und überhaupt, darum bitte ich besonders, laßt euch zwei Dinge recht sehr angelegen sein: einmal, daß die Kiste ganz sicher stehe, und zweitens, daß ihr meine Madonna von Marmor zu euch ins Haus schaffen laßt und daß sie kein Mensch zu sehen bekommt. Ich schicke kein Geld mit für die Auslagen, weil sie nur unbedeutend sein können. Aber selbst wenn ihr es borgen müßtet, nur recht schnell. Sobald mein Marmor hier ist, bekommt ihr Geld für alles.
Bittet Gott, daß meine Angelegenheiten hier günstigen Verlauf nehmen, und legt, wenn es irgend möglich ist, bis zu 1000 Dukaten in Ländereien an, wie wir ausgemacht haben.«
Wir sehen, wie er von seinem Gelde gleich eine bedeutende Summe dem Vater in die Hände gibt.
Mit dem Marmor scheint es bald besser gegangen zu sein. Michelangelo ließ die Steine auf den Platz vor der Basilika von Sankt Peter hinter Santa Caterina bringen, wo er wohnte. Ganz Rom staunte die Blöcke an, die den Platz bedeckten, vor allem aber hatte der Papst seine Freude daran, die er Michelangelo durch herablassende Vertraulichkeit zu erkennen gab. Oft besuchte er ihn in seiner Werkstätte, saß dort bei ihm und besprach die Arbeit oder andere Dinge; endlich, um es bequemer zu haben, ließ er vom Palaste, der in der Nähe lag, einen Gang mit einer Zugbrücke einrichten und kam so zu ihm, ohne daß es jemand gewahr ward.
Wenn irgendein Geist damals in Italien den hohen Gedanken gewachsen war, welche Giulio hegte, so war es Michelangelo. Was er wollte, ging noch über die Peterskirche hinaus. Er hätte ganze Gebirge zu Kunstwerken umgestaltet, wenn ihm freie Hand gelassen worden wäre. Einen Felsen, der bei Carrara am Ufer sich erhebend fern auf dem Meere sichtbar blieb, wollte er in einen Koloß umwandeln, der den Schiffern als Wahrzeichen dienen sollte. Von da war es nicht mehr weit zu Gedanken, wie sie ein griechischer Künstler hegte, der einen Berg in eine Statue Alexanders des Großen verwandeln wollte, die in der Hand eine Stadt hielte.
Michelangelo galt damals für den ersten Bildhauer in Rom. Nur einen Nebenbuhler finden wir genannt, Cristoforo Romano, ein Künstler, der, wenn er nicht zufällig noch an anderer Stelle erwähnt würde (im Cortigiano des Grafen Castiglione, wo er zu der in Urbino versammelten geistreichen Gesellschaft gehört, aus deren Gesprächen das Buch besteht), in der Kunstgeschichte längst verloren und vergessen wäre, denn das Grabmal der Visconti in der Certosa zu Pavia, an dem sich sein Name befindet, wird ihm trotzdem kaum zugeschrieben. Zugleich mit Michelangelo aber kommt er jetzt in einem Briefe vor, den Cesare Trivulzio aus Rom an Pomponio Trivulzio über den neuesten antiquarischen Fund, die Entdeckung des Laokoon schrieb.
Im Frühling 1506 wurde die berühmte Gruppe in den Ruinen des Tituspalastes vom Eigentümer des Platzes, einem römischen Bürger, entdeckt. Sie steckte noch im Boden drin, als der Fund schon dem Papste gemeldet ward. Dieser schickt zu Giuliano di Sangallo, er möge gehen und nachsehen, was es gäbe. Francesco, der Sohn Giulianos, erzählt es. »Michelangelo«, sagt er, »der fast immer bei uns im Hause war (mein Vater hatte ihn kommen lassen und ihm die Bestellung des Grabmals verschafft), war gerade da. Mein Vater bat ihn mitzugehen, und so machten wir uns alle drei, ich auf dem Rücken meines Vaters, auf den Weg. Als wir herunterstiegen, wo die Statue lag, sagte mein Vater sogleich, das ist der Laokoon, von dem Plinius spricht. Man erweiterte nun die Öffnung, so daß er herausgeholt werden konnte. Nachdem wir ihn dann betrachtet, gingen wir nach Hause und frühstückten.«
Der Eigentümer der Figur will das Werk an einen Kardinal verkaufen, für 500 Scudi, als der Papst dazwischentritt, den Preis zahlt und im Belvedere eine »Art Kapelle« für die Gruppe einrichten läßt. Nun soll erprobt werden, ob Plinius' Behauptung, daß die Gruppe aus einem einzigen Stücke gearbeitet sei, mit der Wahrheit stimme. Cristoforo Romano und Michelangelo, die »ersten Bildhauer in Rom«, werden herbeigeholt. Sie erklären, daß die Gruppe aus mehreren Stücken bestände und zeigen vier Nähte, die aber so fein versteckt sind und deren Verkittung sich als eine so ausgezeichnete erweist, daß Plinius, als in verzeihlichem Irrtum befangen, freigesprochen wird, es sei denn, daß er absichtlich die Unwahrheit gesagt habe, um das Werk berühmter zu machen.
Der Laokoon bewegte ganz Rom damals. Beigelegt waren dem Briefe die Verse, die von den ersten Gelehrten zum Lobe der Gruppe gemacht wurden, von Sadolet, Beroalda und Jacopo Sincero. Von einem dieser Gedichte sagt Trivulzio, es sei so vortrefflich, daß man, wenn man es gelesen hätte, den Anblick der Arbeit selbst entbehren könne. Wahrscheinlich meinte er die (in einer Anmerkung zu Lessings Laokoon am bequemsten abgedruckte) poetische Beschreibung des Werkes von Sadolet, zu deren Ruhme Lessing zufällig auch sagt, daß sie die Stelle einer Abbildung vertreten könnte.
Heute liegt neben der Gruppe, wie sie neu restauriert im Vatikan steht, ein im Groben zugehauener Arm mit Schlangen, von dem gesagt wird, daß er ein Werk Michelangelos sei, und der, was die Bewegung anlangt, richtiger ist als der, welcher aus anderer Hand der Schulter des Laokoon angesetzt worden ist. Allein, da sich dieser Versuch Michelangelos nirgends erwähnt findet, so bleibe die Wahrheit der Angabe dahingestellt. Rührt der Arm von ihm her, so müßte er in viel späterer Zeit entstanden sein.
Mitten in der Blüte seiner Gunst bei Giulio kam nun jedoch ein plötzlicher Abbruch dieser Verbindung. War es Bramante gelungen, über Giuliano di Sangallo beim Bau der Peterskirche den Sieg davonzutragen, so sollte nun auch Sangallos Günstling, Michelangelo, aus der schon begonnenen Arbeit herausgedrängt werden. Von zwei Seiten her wurde der Papst darauf hin bearbeitet, und in beiden Richtungen gelang der Plan.
Man leitete Giulio die Meinung zu, daß es von übler Vorbedeutung sei, sich bei eignen Lebzeiten ein Grabmonument aufzurichten. Schon im Herbste 1505 muß Michelangelo Zeichen eines möglichen Sinneswechsels beim Papst beobachtet haben. Indem Kontrakte vom 10. Dezember, worin er die Überführung von Marmorblöcken aus Carrara nach Rom stipuliert, wird der doppelte Fall vorgesehen: einmal, daß der Papst nicht leben bliebe, oder, daß er zwar leben bliebe, das Grabmonument aber nicht errichten ließe. Mit der Vorsicht, welche wir in allem Geschäftlichen bei Michelangelo beobachten, hatte er, falls das eine oder andere einträte, den Kontrakt im voraus für ungültig erklären lassen.
Als im Frühjahr 1506 die Blöcke nun ankamen, sollte sich zeigen, ob die Abkühlung des Eifers, mit welchen Giulio die Unternehmung zuerst betrieben hatte, weitere Fortschritte gemacht. Die Barken mit dem neuen Marmor legten an, Michelangelo war zur Stelle, er brauchte Geld, um die Schiffer zu bezahlen. Der Papst hatte zu mehrerer Bequemlichkeit angeordnet, daß Michelangelo jederzeit unangemeldet vorgelassen würde. Jetzt aber macht man ihm Schwierigkeiten, und als er den Einlaß durchgesetzt, empfängt er dennoch kein Geld. Er war gezwungen, sich an Jacopo Galli zu wenden, der ihm die hundertundfünfzig bis zweihundert Dukaten vorschoß, deren er benötigt war.
Nun stellten sich die Marmorarbeiter ein, die er in Florenz gemietet hatte. Er brachte sie in seinem Hause unter, die Arbeit sollte vorwärts gehen, aber Giulio war wie verwandelt, er drängte nicht mehr, noch wollte er Geld geben. Dagegen kam er mit einem ganz neuen Plane zum Vorschein: Michelangelo sollte die Wölbung der Sixtinischen Kapelle, so genannt, weil Papst Sixtus, Giulios Oheim, sie (1473) gebaut hatte, mit den noch mangelnden Gemälden versehen.
Denn daß damals irgendeine Wand, welche Raum für Malerei bot, ungemalt geblieben wäre, war nicht denkbar.
Bramante wollte Michelangelo mit seinem Grabdenkmale auf diesem Wege aus der Peterskirche herausschaffen und ihn zugleich auf ein Feld locken, auf dem seine Erfolge zweifelhaft wären.
Und so kam es denn wirklich zu der Szene, welche Michelangelos Feinde zwischen ihm und dem Papste herbeiführen wollten. An einem Sonnabend, Ende April, als der Papst, während er sein Mittagessen einnahm, mit allerlei Leuten laufende Geschäfte besprach, hörte ihn Michelangelo zu einem anwesenden Goldarbeiter sagen, er habe keine Lust mehr, auch nur einen Pfennig für Steine auszugeben, weder für kleine noch für große. Michelangelo, der dabei stand, wußte sofort, was Giulio ihm hatte zu verstehen geben wollen, und als er mit dem eigenen Anliegen selber nun an die Reihe kam und Geld für seine Arbeiter verlangte, hieß es nun, er möge Montag wiederkommen.
»Und nun«, wie es in dem Briefe heißt, in welchem er kurz darauf seine Erlebnisse beschrieb, »kam ich am Montag wieder, und kam Dienstag und Donnerstag, wie der Papst recht gut wußte, und endlich, am Freitage wurde ich fortgewiesen, d. h. herausgeworfen.«
Wie es bei dieser letzten Audienz am Freitage zuging, hat Michelangelo mehr als einmal erzählt. Er hat es Condivi diktiert und es beinahe mit denselben Worten in einem seiner Briefe wiederholt, man fühlt aus dem Tone, in dem er redet, wie sich das Erlebnis für alle Zeiten in sein Gedächtnis eingestempelt hatte. In anderen Briefen, wo er bei weiten dazwischen liegenden Zeiträumen auf die damals erlittene Schmach zurückkommt, wechselt er mit Einzelheiten, läßt fort, setzt zu, wie ihm im Momente die Phantasie das Geschehene ins Gedächtnis zurückruft. Wir sehen, daß er die Dinge nicht vergessen konnte und wie sie immer anders gewandt in seiner Erinnerung sich herumwälzen.
Michelangelo will in den Palast eintreten, als einer von den Diensthabenden ihn zurückweist. Ein hoher Geistlicher, welcher zugegen ist, fährt den Mann an, ob er nicht wisse, wer Michelangelo sei. »Gewiß weiß ich es«, antwortete er, »aber mein Dienst ist, auszuführen, was mir befohlen wird und nicht weiter nachzufragen, warum?« »Nun«, ruft Michelangelo aus, »so sagt dem Papste, wenn er mich in Zukunft brauche, möge er mich suchen, wo ich zu finden bin.« Dreht um, geht nach Hause, befiehlt den beiden Dienern, die er hatte, seine Habseligkeiten zu verkaufen und ihm dann nachzukommen, setzt sich zu Pferde und reitet ohne Aufenthalt, bis er auf florentinischem Gebiete ist.
Hier erreichen ihn die Leute, die von Rom aus hinter ihm drein geschickt worden sind. Sie sollten ihn mit Gewalt wiederbringen; in Poggibonsi aber, wo sie jetzt mit ihm unterhandelten, durften sie sich nichts herausnehmen. Michelangelo war florentinischer Bürger und droht, sie niederhauen zu lassen, wenn sie ihn anrührten. Sie legen sich aufs Bitten, erreichen aber nichts, als daß er den Brief des Papstes schriftlich beantwortet, damit sie selber sich mit der Unmöglichkeit entschuldigen könnten. Der Papst hatte geschrieben, angesichts dieses solle er sich auf der Stelle nach Rom zurückverfügen oder seiner Ungnade gewärtig sein. Michelangelo erwiderte, er werde nun und nimmermehr zurückkehren; er habe für die guten und treuen Dienste, die er geleistet, einen solchen Umschlag nicht verdient, wie ein Verbrecher Seiner Heiligkeit aus dem Angesicht gejagt zu werden, und da Seiner Heiligkeit an der Ausführung des Grabmonuments nichts mehr gelegen sei, so betrachte er auch sich als seiner Verpflichtungen entbunden und habe keine Lust, andere einzugehen. Hiermit entläßt er die Leute Giulios und geht nach Florenz.
Von hier aus schreibt er jetzt, den zweiten Mai, jenen Brief an Giuliano di Sangallo, von dem ein Stück oben mitgeteilt worden ist. Es habe sich ihm, heißt es weiter darin, das Gefühl aufgedrängt, nicht um das Grabmal des Papstes als vielmehr um sein eignes Grab werde es sich bald handeln, wenn er länger in Rom bleibe. Ihm seien, als man ihm so den Palast verboten, jene Worte wieder eingefallen, welche der Papst, die großen und die kleinen Steine betreffend, eine Woche früher getan, und es habe sich Verzweiflung seiner bemächtigt. Übrigens sei noch etwas anderes an seinem plötzlichen Verschwinden schuld, worüber er sich schriftlich nicht aussprechen wolle.
»Jetzt nun«, fährt Michelangelo fort, »schreibt Ihr mir im Namen des Papstes, und somit bitte ich, auch diese meine Antwort dem Papste vorzulegen: möge Seiner Heiligkeit überzeugt sein, daß ich den besten Willen habe, das Grabmal weiterzuführen, besseren Willen als jemals, aber daß, wenn der Papst es aufzurichten wahr- und wahrhaftig im Sinne hat, es ihm ja gleichgültig sein kann, an welcher Stelle ich dafür arbeite. Die Hauptsache ist, daß es in fünf Jahren fertig aufgemauert dastehe, im Sankt Peter, wo es dem Papst am besten gefällt, und daß es schön sei. Was dies anlangt, gebe ich mein Versprechen: es wird in der ganzen Welt nichts sein, was dagegen aufkommt.«
»Nun aber, wenn Seine Heiligkeit in der Sache weitergehen will, so mögen die nötigen Gelder hier in Florenz angewiesen werden, mir steht in Carrara genügender Marmor zur Verfügung, den ich zu meinem bereits vorhandenen Vorrat hierher dirigieren lasse und Seiner Heiligkeit gutschreibe, ganz abgesehen, ob ich Schaden dabei habe oder nicht; was dann an Arbeit für das Grabmal fertig wird, sende ich Stück auf Stück ein, und Seine Heiligkeit hätte ihre Freude daran, gerade so, als wenn ich selber in Rom wäre, oder vielmehr besser so, denn Seine Heiligkeit sähe, was fertig dasteht, und hätte weiter keinen Ärger davon. Was das deponierte Geld und das Grabmal überhaupt anlangt, so würde ich ganz nach Seiner Heiligkeit Befehl jede irgend erforderliche Garantie stellen: ganz Florenz würde dafür einstehen. Noch eins: käme in Betracht, daß die Unternehmung für Rom zu teuer wäre, so würde sie das für Florenz nicht sein, da mir alles hier viel bequemer liegt; ja ich würde hier besser und lieber arbeiten, da mir nicht soviel dabei zur Last läge. Und somit, teuerster Giuliano, laßt mich, bitte, recht bald günstige Antwort hören.«
So einfach, wie Michelangelo diesem Briefe zufolge glaubte oder zu glauben vorgab, standen die Dinge in Rom jedoch nicht. Offenbar gingen viele Botschaften hin und her, von denen wir nichts mehr besitzen. Nur ein Brief ist noch erhalten, welcher eine Woche nach dem eben mitgeteilten aus Rom nach Florenz geschrieben wurde von der Hand eines derjenigen, die im Vatikan Michelangelos Sache vertraten. Hier lesen wir:
»Teuerster Freund und Bruder. Viele Grüße und Empfehlungen zuvor. Ich und Bramante hatten letzten Sonnabend dem Papste bei Tafel über allerlei Zeichnungen Vortrag zu halten; erst ich, und nach Tische wurde Bramante gerufen, und der Papst sagte ihm: morgen geht der Sangallo nach Florenz und bringt Michelangelo wieder mit. Und Bramante sagte: heiligster Vater, Sangallo wird sich hüten, ich kenne Michelangelo aus Erfahrung, er hat mehr als einmal gesagt, er denke nicht daran, die Kapelle zu malen; Eure Heiligkeit wollten es ihm zwar aufbürden, er jedoch werde sich auf keine andere Arbeit einlassen als auf das Grabmal. Und weiter sagte Bramante: heiligster Vater, ich glaube, er getraut es sich nicht, denn es müssen da Figuren gemalt werden, die man aus der Tiefe sieht und wo viel Verkürzungen vorkommen, das ist etwas anderes, als unten zu malen. Darauf sagte der Papst: kommt er nicht, so tut er mir einen Schimpf an, und deshalb glaube ich, daß er unter allen Umständen kommen wird. Jetzt zeigte ich, daß ich auch da sei, und nannte Bramante vor dem Papste einen Schurken, etwa wie Ihr gesprochen haben würdet, wenn Ihr statt meiner dagestanden hättet, und Bramante war so auf den Mund geschlagen, daß er still schwieg, weil er einsah, daß er schlecht gesprochen hatte. Endlich sagte er: heiliger Vater, der da hat nie mit Michelangelo über diese Dinge verhandelt, und wenn ich die Unwahrheit gesagt habe, so laßt mir den Kopf vor die Füße legen; ich bleibe dabei, daß der da niemals mit Michelangelo darüber gesprochen hat; freilich, wenn Eure Heiligkeit den Willen dransetzt, wird er schon wiederkommen. Damit hatte die Sache ein Ende, und weiter ist nichts mitzuteilen. Gott sei mit Euch. Kann ich etwas für Euch tun, so laßt es mich wissen, ich will es gern tun. Meine Empfehlungen an Simone Pollaiuolo.«
Wir sehen, daß der Hauptanstoß immer noch in dem Willen des Papstes lag, lieber die Kapelle malen zu lassen, als das Grabmal aufzurichten, und zugleich, daß die Ausmalung der Kapelle erst nach Michelangelos Abreise offen aufs Tapet gebracht worden war, sonst würde sich Michelangelo über diesen Punkt Sangallo gegenüber deutlicher ausgesprochen haben. Vielleicht aber auch sollte dem Papste dadurch angedeutet werden, diese Malerei liege ihm so fern, daß er darüber gar nicht verhandeln wolle. Aus einem Schreiben eines anderen Florentiners an Michelangelo, welches zu gleicher Zeit mit diesem Briefe aus Rom an ihn gelangt sein muß, ersehen wir, wie Sangallo dafür einstand, der Papst wolle das Grabmal weiterführen, und Michelangelo werde bald wieder da sein.
Dieser indessen hatte in Florenz sofort wieder zu arbeiten begonnen.
Zu tun fand er genug; der Karton nahm die erste Stelle ein. Kaum hatte er angefangen, als ein Schreiben des Papstes an die Regierung einlief »Geliebte Söhne«, redet Giulio die Signoren an, »alles Heil und meinen apostolischen Segen zuvor. Michelangelo, der Bildhauer, der uns leichtsinniger und unbedachtsamer Weise verlassen hat, fürchtet sich, wie wir hören, zurückzukehren. Wir hegen keinen Zorn gegen denselben, da wir die Manieren dieser Art Menschen kennen. Damit er jedoch jeglichen Verdacht fahren lasse, erinnern wir euch an eure uns schuldige Ergebenheit und fordern euch auf, ihm in unserem Namen das Versprechen zu geben, daß, wenn er zu uns zurückkehren wolle, er frei und ungefährdet kommen könne und daß wir ihn mit derselben Gnade aufnehmen werden, die ihm vor seinem Fortgehen von uns zuteil ward. Rom am 8. Juli 1506, unserer Regierung im Dritten.«
Soderini antwortete darauf, Michelangelo sei dermaßen in Furcht gesetzt, daß es trotz der im Briefe enthaltenen Zusicherungen einer besonderen Erklärung Seiner Heiligkeit bedürfe, daß er sicher und unverletzt bleiben werde. Er habe alles bei ihm versucht, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, und setze diese Versuche noch immer fort, allein er wisse zu gut, daß, wenn man mit Michelangelo nicht ganz sanft umginge, dieser die Flucht ergreifen würde. Zweimal sei er bereits nahe daran gewesen.
Man denke hier nicht an das, was bei uns gewöhnlich Furcht genannt wird, wenn Soderini Michelangelo impaurito, von Furcht erfüllt nennt. Dieser hatte volle Ursache dem Papste nicht zu trauen. Solche Versprechungen, ja die heiligsten Schwüre auf Ehre und Gewissen waren die gewöhnliche Kriegslist, diejenigen, deren man habhaft werden wollte, in die Falle zu locken. Giulio hatte zu vielen gegenüber öffentlich bewiesen, was auf seine Beteuerungen zu geben sei, Michelangelo folgte den einfachsten Regeln der Klugheit, wenn er der milden Sprache nicht traute. Ein zweites Schreiben von Rom lief ein. Soderini ließ ihn zu sich kommen. »Du bist mit dem Papst auf eine Weise umgegangen, wie es der König von Frankreich nicht gewagt haben würde! Es hat ein Ende jetzt mit dem Sichbittenlassen! Wir wollen deinetwegen keinen Krieg anfangen und das Wohl des Staates aufs Spiel setzen. Richte dich ein, nach Rom zurückzukehren!«
Michelangelo dachte, als die Sache diese Wendung nahm, ernsthaft an Flucht. Der Sultan, zu dem sein Ruf gedrungen war, hatte ihm Anerbietungen machen lassen. Er sollte ihm eine Brücke von Konstantinopel nach Pera bauen. Ein Franziskanermönch machte den Unterhändler bei dieser Berufung. Die Florentiner standen seit der Eroberung von Byzanz mit den Sultanen im besten Einvernehmen. Ohne eigene Flotte und Politik in der Levante, flößten sie, anders als die Genuesen und Venezianer, kein Mißtrauen ein; dadurch aber, daß sie obendrein zu gelegener Zeit die Pläne dieser beiden Nebenbuhler verrieten, hatten sie sich Vertrauen erworben. Eine große Anzahl florentinischer Häuser war in Konstantinopel etabliert und der Verkehr zwischen Florenz und dort ein lebhafter. Öfter schon waren italienische Meister so berufen worden. Michelangelo hätte Beschäftigung, Gunst und Freunde gefunden.
Der Gonfalonier berichtete nach Rom, daß nichts mit ihm anzufangen sei. Der Papst müsse feste Garantien bieten, sonst käme er ihm nicht. Doch werde er noch einmal mit ihm sprechen, da die launenhafte Natur des Mannes vielleicht eine Änderung seiner Entschlüsse hoffen lasse.
Guilios dritter Brief scheint enthalten zu haben, was man wünschte. Soderini hörte nun auch von Michelangelos türkischer Reise. Er stellte ihm vor, wie viel besser es sei, nach Rom zu gehen, wäre es auch, um dort zu sterben, als beim Sultan sein Leben zu verbringen. Aber er brauche nichts zu besorgen. Der Papst sei milde von Natur, er verlange ihn zurück, weil er ihm wohlwolle, und wenn er allen Versicherungen keinen Glauben schenke, werde ihn die Regierung in der Eigenschaft ihres Gesandten reisen lassen. Wer ihm dann etwas zuleide täte, der habe die florentinische Republik in eigner Person beleidigt. Da Michelangelo seiner Geburt und seinem Alter nach längst Mitglied des Consiglio grande war und als solches zu jedem Staatsamte die Fähigkeit besaß, so erscheint Soderinis Vorschlag durchaus praktisch. Man würde heute vielleicht einen angesehenen Mann in ähnlicher Weise einer auswärtigen Gesandtschaft zuordnen.
Michelangelo ging darauf ein. Die Regierung gab ihm ein besonderes Empfehlungsschreiben an den Kardinal von Pavia, des Papstes Günstling, mit, durch den die Verhandlungen seinetwegen vorzugsweise geführt worden waren. In diesem Briefe steht allerdings nichts davon, daß er als Gesandter komme, allein da er nur des Namens wegen zum ambasciadore ernannt werden sollte, so ist dies kein Beweis dagegen, daß ihm überhaupt diese Eigenschaft beigelegt worden sei. Datiert ist der Brief vom 21. August 1506; allein schon am 27. hatte der Papst Rom verlassen, um den Krieg zu beginnen, welcher der Anfang der Kämpfe war, in denen er seine alte kriegerische Laufbahn mit all der Energie wieder aufnahm, deren er fähig war.
III
Man war erstaunt gewesen über die stillen Anfänge seiner Herrschaft. Seinem Charakter nach hätte er längst die Waffen ergreifen müssen. Doch es schien sich seine Natur geändert zu haben und er von der alten Rache nichts mehr zu wissen, die er an so vielen Feinden nehmen wollte. Giulio aber sammelte in der Stille Geld für die Soldaten. Die Papstwahl hatte ihn zu viel gekostet. Er mußte erst wieder die Taschen voll haben. Bis dahin suchte er unter der Hand die Dinge so zu lenken, daß sie ihm, wenn er endlich gerüstet aufträte, so bequem als möglich lägen.
So herrschte eine Zeitlang, den ewigen Krieg der Florentiner gegen Pisa ausgenommen, Friede in Italien. Doch wie der Papst seine geheimen Pläne machte, fehlten sie auch den übrigen nicht.
Mailand gehörte Frankreich; Ludwig der Zwölfte war vom Kaiser damit belehnt worden. Florenz erfreute sich des französischen Schutzes in erster Linie; und dennoch, mit dem Besitze Genuas und der Lombardei hatte Ludwig sich die Politik der Sforzas und Viscontis aneignen müssen, die gleichsam an der Scholle haftete: er mußte nach dem Besitze der italischen Westküste streben und Pisa zu gewinnen suchen. Dabei blieben die hergebrachten Ansprüche auf Neapel, das Gonsalvo, der große Capitano, für Spanien glänzend zurückerobert hatte und als Vizekönig regierte. Hinter dem allen aber lauerte der größte Gedanke: das Kaisertum! Ludwig wollte in Rom als Kaiser gekrönt werden, es war auch das die alte Sehnsucht seiner Vorgänger, die auf ihn überging und die seine Nachfolger noch drei Jahrhunderte fruchtlos hegten, bis Napoleon sie zur Erfüllung brachte.
Solange Giulio regierte, war dergleichen aber nicht möglich. Deshalb mußte dieser beseitigt werden. Der Kardinal von Amboise, Giulios einstiger Nebenbuhler bei der Papstwahl (nebst Ascanio Sforza, der als Gefangener in Frankreich an der Pest starb, d. h. vergiftet ward), sollte ihm dazu behilflich sein. Ein Konzil würde Giulio absetzen, rechnete der König, und Amboise an seine Stelle wählen. Es waren noch keine festen Pläne, nur leitende Ideen, die man hegte, aber wie es natürlich war, daß sie Ludwig im Sinne lagen, ebenso natürlich war es, daß Giulio selber sie erkannte und sich zu schützen suchte.
Und dies zeigte sich einstweilen nicht so schwierig. Dem Könige standen zwei Mächte gegenüber, welche dafür sorgten, daß auch nicht ein Schritt von Frankreich getan würde, zu dem sie nicht zuvor ihre Einwilligung gegeben. Spanien in erster Linie, das heißt Aragon, das nach Isabellens Tode von Kastilien wieder getrennt, mit Neapel dagegen nun vereinigt dem alten Könige Ferdinand gehorchte. Maximilian sodann, der römische König, dessen Sohn, Herzog Philipp von Burgund, zur Zeit Kastilien innehatte. Philipp regierte dort für seinen Sohn Karl, nochmaligen Kaiser Karl den Fünften. Der kastilische Adel, der für seine Rechte fürchtete, hatte ihn ins Land gerufen. Denn auch König Ferdinand wollte in Kastilien für Karl regieren, der auch sein Enkel war. In aller Kürze hier die Verwandtschaft: Max heiratete Marie von Burgund; Philipp, der Sohn aus dieser Ehe, eine Tochter Ferdinands und Isabellens. Dadurch hatte Karl, der Ferdinands und Maximilians Enkel zugleich war, Anwartschaft auf beide Spanien, Burgund und auf die Kaiserkrone, was ihm auch in der Folge alles zufiel.
Damals aber, wo Karls Mutter eben im Wahnsinn gestorben und er selber ein zartes Kind war, hatten die Aussichten vorläufig nur die Folge, daß Maximilian sich kräftiger dem Süden zuwandte. Das deutsche Kaisertum wollte er wieder zu Ehren bringen, Mailand natürlich einst für Karl zurückerwerben, Venedig demütigen und den Papst in seine alte abhängige Stellung zurückdrängen.
Das waren die habsburgischen Ideen jener Tage. Und um sie mit den französischen vielleicht zu versöhnen, wurde an einer Heirat zwischen Karl und Claude, der Tochter Ludwigs, gearbeitet.
Zwischen zwei solchen Gewalten stehend, deren Politik ganz Europa umfaßte, blieb den Päpsten geringer Spielraum. Sie mußten der einen oder der anderen anheimfallen. Es stand wieder wie in jenen längst verflossenen Jahrhunderten, wo Frankreich und Deutschland jedes seinen eigenen Papst zu machen strebte. Indessen, die Dinge gestalteten sich erst. Ferdinand von Aragons sowie Venedigs Dasein bewirkten, daß immer vier an der Partie mitspielten; auch England griff ein. So blieb Gelegenheit für Koalitionen, und in der allgemeinen Verwirrung boten sich Schlachtfelder für Giulios Ehrgeiz.
Seine Natur bedurfte gewaltsamer Aufregungen, dies ist der letzte Grund seiner Taten. Er warf sich auf das Nächstliegende. Nach dem Sturze der Borgias hatten die Venezianer einen Teil der Romagna an sich gerissen, Ravenna, Cervia, Rimini, drei wichtige Küstenstädte, und Faenza im Inneren. Die beiden besaßen Salzwerke, die ungemeine Einkünfte gewährten. Rimini bot Venedig noch im Jahre 1504 freiwillig an, Giulio aber antwortete, daß er sie sämtlich mit Gewalt an sich zu bringen hoffe. Zu Anfang 1505 zeigten sich die Venezianer noch williger, sie wollten jetzt alles bis auf Rimini und Faenza ausliefern, nur möchte der Papst die Gesandten der Stadt, die in den Kirchenbann getan worden waren, in Rom zu Gnaden wieder aufnehmen. Hierauf ging er einstweilen ein, ohne Frankreich konnte er nichts gegen Venedig tun, und so gern Ludwig die Venezianer gedemütigt gesehen hätte, so wenig wünschte er doch Maximilian nach Italien zu ziehen, der sich bei einem Kriege gegen die Stadt sogleich in Bewegung gesetzt haben würde.
Giulio konnte deshalb nach dieser Seite hin vorderhand nichts unternehmen. Aber er wollte einen Krieg haben. Er beschloß, Bologna und Perugia, zwei päpstliche Städte, die sich seit langen Jahren unter den Bentivoglis und Baglionis zu selbständiger Politik erhoben hatten, in seine Gewalt zurückzubringen. Gegen beide Familien hegte er persönliche Feindschaft, und Frankreich zeigte sich hier geneigter, tätige Hilfe zu gewähren, denn es fürchtete eine Verbindung Giulios mit Venedig.
Begleitet von den Kardinälen, zog der Papst mit der Armee von Rom aus, gegen Perugia zuerst, das auf halbem Wege nach Bologna liegt. Er hatte nicht mehr als fünfhundert Lanzen bei sich, das heißt fünfhundert schwerbewaffnete Ritter, welche mit ihrem Gefolge eine ziemliche Armee repräsentierten. Der Zuzug der Verbündeten sollte sich unterwegs anschließen. Gianpagolo Baglioni dagegen, ein alter Kriegsunternehmer, stand so wohlversorgt mit Soldaten da, daß er seine Stadt getrost hätte verteidigen können. Dennoch kam er Giulio schon in Orvieto entgegen, unterwarf sich und wurde mit seinen Leuten in Sold genommen. Inmitten des Hofstaates und der Kardinäle zog der Papst feierlich in Perugia ein, als einzige Bedeckung seine Leibgarde um sich. Baglioni hätte ihn jetzt mit seiner ganzen Umgebung fangen können. Es wäre vielleicht ein gutes Geschäft gewesen. Aber dieser Mann, der alle seine Verwandten meuchlings umgebracht hatte, fühlte sich gelähmt durch die Persönlichkeit Giulios und ließ, wie Machiavelli sagt, die schöne Gelegenheit, sich die Bewunderung der Zeitgenossen und ewigen Ruhm zu erwerben, ungenutzt vorübergehen, nur weil ihm der Mut fehlte, so verbrecherisch zu sein, als es der Moment erforderte. Und damit dieses Urteil nicht als eine absonderliche Ansicht Machiavellis erscheine, sei bemerkt, daß auch Guiccardini den Mangel an augenblicklicher Tatkraft bei Baglioni rügt. So war das Zeitalter. Es fiel keinem von beiden ein, auch nur daran zu erinnern, welch eine Schmach es gewesen sei, das Oberhaupt der Christenheit hinterlistig gefangenzunehmen.
In Perugia erschien der Kardinal von Narbonne im Namen des Königs von Frankreich. Giulio möge sein Unternehmen gegen Bologna wenigstens verschieben. Der Papst hatte Rom verlassen, noch ehe ihm Ludwig seine Hilfe fest zugesagt. Die Bentivogli standen gut mit Frankreich. Aber es hatte die einlaufende Mahnung keine andere Wirkung, als daß der Papst von allen Seiten Soldaten heranzog, um desto rascher vorzugehen. Der König gab nach. Giulio mußte versprechen, Venedig nicht anzugreifen, unter dieser Bedingung lieferte Ludwig sechshundert Ritter und dreitausend Mann Infanterie. Hundertundfünfzig Ritter führte Baglioni, hundert schickten die Florentiner unter Marcanton Colonna, hundert der Herzog von Ferrara, aus Neapel kamen Stradioten (eine Art berittener griechischer Mietstruppen, deren sich Venedig meistens bediente), zweihundert leichte Reiter endlich führte Francesco Gonzaga zu, der zum Oberbefehlshaber der Armee ernannt wurde.
Der alte Bentivoglio mit seinen Söhnen, die sich von allen Seiten angegriffen sahen, wartete den Sturm nicht ab. Als sie von dem feindlichen Anrücken der Franzosen hörten, flüchteten sie diesen entgegen und wurden gegen gute Bezahlung in Schutz genommen. Ihren Palast plündert und zerstört das Volk. Giulio wird in prachtvollem Geleite in die Stadt eingeholt. Die Bürger erhalten ihre Freiheiten zurück. Der Papst kam als »Befreier von Italien«. Das Wetter war so herrlich in jenen Tagen, daß alles in Blüte stand, und die begeisterten Bürger den Papst als den Herrn des Himmels und der Planeten begrüßten. Giulio aber traf trotzdem die nötigen Maßregeln, Bologna auch für die Folge, wenn diese Stimmung etwa umschlagen könnte, gut päpstlich zu erhalten. Er setzte sich einstweilen da fest und blickte um sich. Die Reihe kam nun doch an die Venezianer. Für den Augenblick aber ruhten die Dinge, und man fand Zeit, sich der Kunst und Michelangelos zu erinnern.
Während der Papst Krieg führte, hatte dieser in Florenz am Karton weitergezeichnet und ihn zu Ende gebracht. Die Kämpfe mit Pisa nahmen damals das öffentliche Interesse ganz in Anspruch. Michelangelo hatte seinen Stoff aus dem Kreise der Kriege gewählt, die seit Jahrhunderten zwischen beiden Städten walteten. Um die Zeit etwa, wo Salvestro bei Medici lebte, wandte sich ein englischer Kriegsunternehmer nach Italien, Hawkwood, von den Italienern Aguto genannt, ein berühmter tapferer Mann, dessen Grabdenkmal heute noch in Santa Maria del Fiore zu sehen ist. Dieser mischte sich in die Kämpfe seiner Zeit; es kam ihm auf Arbeit an und nicht auf die Sache, der er diente: ehe er zu den Florentinern übertrat, hatte er im Solde der Pisaner Krieg gegen sie geführt, und während dieser Periode seiner Tätigkeit ereignete sich der Vorfall, den Michelangelo dargestellt hat.
Die Truppen standen sich in der Nähe von Pisa gegenüber. Es war sehr heiß, die Florentiner legten die Rüstungen ab und badeten im Arno. Aguto benutzt diese Gelegenheit zu einem Überfall. Noch zur rechten Zeit aber eilt Manno Donati herbei und verkündet die drohende Gefahr. Die Badenden stürzten ans Ufer und in die Waffen – diesen Moment ergriff Michelangelo. Jung und Alt durcheinander – einige können mit den nassen Gliedern nicht in die anklebenden Kleider hinein, andere haben schon die Rüstung auf dem Leibe und schnallen das Riemenzeug fest; dort erklimmt einer eben das Ufer, stemmt sich mit beiden Armen auf und blickt in die Ferne – man sieht die ganze Gestalt, die uns den Rücken zudreht, und ihre wundervolle Bewegung; ein anderer, der schon mit den Kleidern beschäftigt ist, unterbricht einen Augenblick die Arbeit des Anziehens, dreht den Kopf um nach der Gegend, woher Gefahr droht, und deutet dahin; wieder einer, der noch ganz nackt ist, kniet auf der Höhe des Ufers und reckt den linken Arm tief hinab einem anderen Arme entgegen, der mit verlangenden Fingern tief aus dem Wasser emporkommt – mit dem rechten Arm und den Knien sucht er sich oben Widerstand zu schaffen. Es ist nicht möglich, die einzelnen Gestalten alle zu beschreiben, die Verkürzungen, die Kühnheit, mit der immer das Schwierigste gewollt, die Kunst, mit der es erreicht worden ist: dieser Karton war die Schule für eine ganze Künstlergeneration, die nach ihm ihre Anschauungen formte.
Ausgeführt wurde er niemals. Ein Teil des Kartons ist, wenn Borghini nicht falsch berichtet, gegen Ende des 16. Jahrhunderts noch auf einer Villa bei Florenz vorhanden gewesen. Heute existiert vom Gemälde nichts als eine Kopie geringen Umfanges, die nur im allgemeinen die Stellung der Figuren erkennen läßt. Einige Gestalten dagegen, die eine Gruppe bilden, hat Marcanton gestochen. Es ist eines seiner schönsten Blätter und läßt wohl ahnen, welch ein prachtvolles Werk der Karton gewesen sein muß. Ein zweiter Stich, der einen anderen, größeren Teil des Ganzen wiedergibt, ist von Agostino Veneziano, Marcantons Schüler. Aber während jenes Blatt im Jahre 1510 noch nach dem Original gezeichnet sein konnte, weiß man bei diesem nicht, woher die Zeichnung stammt. Als eine Eigentümlichkeit der Komposition tritt noch die alte florentinische Manier hervor, mehr ein breites Gedränge als eine sich der Mitte zu aufbauende symmetrisch gegliederte Anordnung zu geben. Die Schönheit der Arbeit lag, abgesehen vom geistigen Inhalte, im Reichtum unverhüllter Körperwendungen. Leonardo hatte darin längst Großes geleistet, die Anatomie und das Studium der Verkürzungen waren von ihm vor Michelangelos Auftreten mit Meisterschaft betrieben worden, dennoch mußte er sich von diesem nun übertroffen sehen.
Die Meinungen teilten sich in Florenz natürlicherweise. Es wurde mit Heftigkeit für und wider die beiden Meister gestritten. Erregt eine große Kraft nur erst das Vertrauen, daß man sich ohne Bedenken auf sie verlassen könne, dann ist auch die Partei um sie her gebildet. Der Karton muß den Freunden Michelangelos dies Gefühl der Sicherheit gegeben haben, auf das es ankam. Michelangelo stand fortan nicht mehr einsam der Schule Leonardos entgegen und hatte das Glück auf seiner Seite.
Es ging schlecht mit Leonardos Malerei im Saale des Palastes, bei der er, statt al fresco zu malen, Ölfarben anwandte. Die Komposition, mit der die Mauer zu diesem Zwecke von ihm behandelt worden war, hielt nicht; die Arbeit verdarb ihm unter den Händen. Dazu kam das Mißlingen des Projektes, dem Arno ein neues Bett zu graben und die Pisaner durch die Ableitung des ihre Stadt durchschneidenden Flusses zur Übergabe zu zwingen. Zweitausend Erdarbeiter waren aufgewandt worden; zuletzt stellte sich heraus, daß man bei der Nivellierung Rechenfehler begangen hatte. Leonardo war, scheint es, dabei beteiligt. Empfindlichkeiten zwischen ihm und Soderini machten das Leben in Florenz vollends unbehaglich. Er hatte seinen Gehalt abholen lassen und lauter Rollen von Kupferstücken empfangen. Mit einer stolzen Antwort sandte er das Geld zurück: er sei kein Maler, den man mit Dreiern bezahle. Es kam so weit, daß der Gonfalonier den Vorwurf aussprach, Leonardo habe Geld erhalten, ohne Arbeit zu liefern. Dieser brachte jetzt ein Summe zusammen, die allem entsprach, was er überhaupt je empfangen hatte, und stellte sie Soderini zur Verfügung, der sie anzunehmen verweigerte. Aus Mailand dagegen kamen dringende Einladungen. Leonardo ließ sich Urlaub geben und ging, ohne sein Gemälde beendet zu haben, von Florenz fort, um sich zu der alten Stätte seines Ruhmes zurückzuwenden, wo er vom Statthalter des Königs von Frankreich glänzend aufgenommen wurde. Den Aufforderungen Soderinis, wiederzukommen und den eingegangenen Verpflichtungen zu genügen, setzte jener hohe Herr selber die höflichsten Ablehnungen entgegen. Leonardo erhielt den Titel eines Malers seiner Allerchristlichsten Majestät, kam in dieser Eigenschaft noch einmal nach Florenz im Jahre 1507, ordnete seine Verhältnisse und begab sich nach Frankreich, wohin ihn sein neuer Gebieter berufen hatte. Solchen Wünschen gegenüber konnte sich der Gonfalonier nur nachgiebig verhalten. Leonardos Gemälde im Saale des Palastes ist nie vollendet worden, und was davon fertig war, allmählich zugrunde gegangen.
Michelangelo blieb Herr des Schlachtfeldes, aber auch ihn rief nun der Wille des Papstes aus Florenz fort. Kaum war Bologna eingenommen, im November 1506, so traf ein Schreiben des Kardinals von Pavia ein, die Signorie von Florenz würde Seiner Heiligkeit einen großen Gefallen erweisen, wenn sie Michelangelo auf der Stelle nach Bologna senden wolle, und dieser selbst dürfe sich über den ihm bevorstehenden Empfang nicht zu beklagen haben. Eine Woche später ging Michelangelo dahin ab, versehen mit einem außerordentlichen Empfehlungsschreiben des Gonfaloniers an seinen Bruder, den Bischof von Volterra. »Wir können versichern«, heißt es darin, »daß Michelangelo ein ausgezeichneter Mann ist, der erste seines Handwerks in Italien, ja vielleicht in der ganzen Welt. Wir können ihn nicht angelegentlich genug empfehlen. Bei freundlichen Worten und sanfter Begegnung kann man alles von ihm erreichen. Man muß ihn nur merken lassen, daß man ihn liebt und günstig gegen ihn gestimmt sei, und er wird staunenswerte Arbeit liefern. Hier hat er jetzt die Zeichnung zu einem Gemälde gemacht, das ein ganz ausgezeichnetes Werk sein wird, desgleichen ist er mit zwölf Aposteln beschäftigt, zu neun Fuß ein jeder, die vorzüglich ausfallen werden. Noch einmal empfehlen wir ihn euch.« Und im Nachsatz: »Michelangelo kommt im Vertrauen auf unser gegebenes Wort.« So wenig verließ man sich immer noch auf die sanfte Weise des Papstes.
Neben diesem Briefe erhielt Michelangelo einen zweiten, energischer lautenden an den Kardinal von Pavia. Er blieb unschlüssig bis zu den letzten Tagen. Noch kurze Zeit vor dem Datum jener Briefe hatte der Gonfalonier geschrieben, daß er Michelangelo »zu der Reise zu bringen hoffe«. »Ich ging«, sagte Michelangelo von sich selbst, »mit dem Riemen um den Hals.« Das heißt also, wie ein Hund, der gezogen wird. Zu Ende des Monats mag er in Bologna eingetroffen sein.
Sein erster Gang war nach San Petronio, um die Messe zu hören. Hier wurde er von einem der päpstlichen Diener erkannt und gleich zu Seiner Heiligkeit mitgenommen. Giulio saß im Palaste der Regierung bei Tische und ließ Michelangelo hereinführen. Um die nun folgende Szene ganz zu begreifen, muß man den Charakter des Papstes verstehen. »Er ist«, schreibt im Jahre 1506 einer der Gesandten an seinem Hofe, »terriblement colerique und schwer zu behandeln. Er hat nicht die Geduld, ruhig anzuhören, was man sagen will, und die Menschen zu nehmen, wie sie sind. Aber wer ihn zu behandeln weiß und wem er einmal Vertrauen geschenkt hat, der findet stets den besten Willen bei ihm.«
Bei Michelangelos Anblick konnte Giulio den aufsteigenden Zorn nicht bemeistern. »So lange also hast du gewartet«, fuhr er ihn an, »bis wir selber kämen, um dich aufzusuchen?« Bologna nämlich liegt näher bei Florenz als dieses bei Rom, und der Papst, wenn er so wollte, war Michelangelo entgegengekommen.
Michelangelo kniete nieder und erbat die Verzeihung Seiner Heiligkeit. Er sei nicht aus bösem Willen fortgegangen, sondern weil er sich beleidigt gefühlt. Es sei ihm unerträglich gewesen, sich fortjagen zu lassen, wie ihm geschehen sei. Giulio sah finster vor sich nieder und gab keine Antwort, als einer von den geistlichen Herren, der vom Kardinal Soderini gebeten war, sich nötigenfalls ins Mittel zu legen, das Wort ergriff. Seine Heiligkeit möge den Fehler Michelangelos nicht zu hoch aufnehmen; er sei ein Mensch ohne Erziehung; das Künstlervolk wisse wenig, wie man sich zu verhalten habe, wo es nicht die eigene Kunst beträfe; sie wären alle nicht anders. Wütend wandte sich der Papst jetzt gegen den unberufenen Fürbitter. »Du wagst es«, schrie er auf, »diesem Manne Dinge zu sagen, die ich ihm selbst nicht gesagt haben würde? Du selber bist ein Mensch ohne Erziehung, du ein elender Kerl; und er nicht! Mir aus den Augen mit deinem Ungeschick!« Und als der arme Herr wie angedonnert stehen bleibt, müssen ihn die Diener zum Saale herausschaffen. Er war noch gut genug davongekommen, wenn es wahr ist, was man in Rom erzählte, daß der Papst bei Tafel Kardinäle selber durchgeprügelt hatte. Dem Zorne Giulios war damit ein Genüge geschehen. Gnädig winkte er Michelangelo herbei und schenkte ihm seine Verzeihung. Er solle Bologna nicht wieder verlassen, als bis er seine Aufträge empfangen hätte.
Giuliano di Sangallo war mit dem Papste in Bologna. Vielleicht verdankte Michelangelo dem Einflusse dieses Mannes, daß ihm die Gunst des heiligen Vaters unvermindert von neuem zuteil ward. Sangallo brachte Giulio auf den Gedanken, sich eine kolossale Bronzestatue in Bologna errichten zu lassen. Michelangelo erhielt Befehl, sie auszuführen. Was es kosten würde, wollte der Papst wissen. Es sei nicht sein Handwerk, erwiderte Michelangelo, doch denke er sie für 3000 Dukaten zu schaffen; ob der Guß aber gelingen werde, dafür könne er nicht einstehen. »Du wirst sie so oft gießen, bis es gelingt«, antwortete der Papst, »und wirst soviel ausgezahlt erhalten, als du bedarfst.« Was das anlangte, so brauchte der Papst nicht zu knausern, da die Statue natürlich vom »Volke von Bologna« gesetzt ward. Die 3000 Dukaten wurden auf der Stelle angewiesen, und Michelangelo machte sich an die Arbeit.
Über keins seiner Werke haben wir so viel Berichte von seiner Hand. Der Verkehr zwischen ihm und den Seinigen in Florenz war lebhaft, und die gesamte Korrespondenz liegt endlich nun gedruckt vor.
Der erste Brief ist vom 19. Dezember 1506, wenige Wochen also nach seiner Ankunft geschrieben, und zwar an den um zwei Jahre jüngeren Lieblingsbruder, welcher nach einer in der Familie bestehenden Gewohnheit den Namen Buonarroto als Vornamen führte. Michelangelo bittet ihn, Piero Orlandini zu sagen, daß es ihm unmöglich sei, die bestellte Dolchklinge selber zu arbeiten. Orlandini wünsche etwas ganz Außerordentliches zu haben, allein erstens liege der Auftrag außerhalb seiner Kunst, und zweitens fehle ihm die Zeit, ihn auszuführen. Doch solle innerhalb eines Monats die Klinge geschafft werden, und zwar so gut als sie nur immer in Bologna zu haben sei. – Eingelegte Degen- und Dolchklingen gehörten jenerzeit wie kostbare Panzer zum notwendigen Besitz eines reichen Edelmanns, und es wurden große Summen darauf verwandt. Man arbeitete diese Klingen nach verschiedenen Mustern; in der Lombardei ahmten die Goldschmiede den Efeu und Wein in seinen Reben und Ranken nach, in Rom den Akanthus, und wieder andere Pflanzen fanden sich in den Arabesken der türkischen Dolche. Über Piero Orlandini ist mir nichts weiter bekannt, als daß er fünfzehn Jahre später in Florenz enthauptet wurde, weil er über die legitime Geburt Clemens des Siebenten Verdächte geäußert.
Michelangelo hoffte damals, schon zu Ostern 1507 in Bologna fertig zu sein und nach Florenz zurückzukommen.
Der Brief zeigt ihn als den eigentlichen Mittelpunkt der Familie. Buonarroto hat über Giovansimone, einen wieder um anderthalb Jahre jüngeren Bruder geschrieben, den ich später einmal als »gefälligen Dichter« genannt finde und der, wie es scheint, eben in den Anfangsgründen einer bestimmten Laufbahn stand. Michelangelo antwortet, er freue sich, daß Giovansimone bei Buonarroto im Geschäft guten Willen zeige. Er werde ihn, wie sie alle, stets unterstützen, wenn Gott Kraft dazu gebe, und ihnen halten, was er zugesagt habe. Wenn Giovansimone aber die Absicht hege, ihn in Bologna aufzusuchen, so müsse er ihm ernstlich abraten. Seine Wohnung sei erbärmlich, es befinde sich nur ein einziges Bett darin, in welchem sie zu vieren schliefen. Giovansimone solle sich gedulden, bis die Statue gegossen sei, dann wolle er ihm ein Pferd schicken und ihn abholen lassen. Bis dahin möchten sie Gott bitten, daß alles seinen guten Fortgang nehme. Dies der gewöhnliche Schluß seiner Briefe, darum aber keine bloße Redensart, wie aus anderen Stellen ersichtlich ist. Etwas wunderlich klingt das Abholenlassen bei dem Bruder, der damals etwa 28 Jahre zählte. Ich möchte vermuten, ohne darum dem Andenken Giovansimones zu nahezutreten, derselbe sei vom Schicksale dazu bestimmt gewesen, wie nicht selten in ähnlichen Fällen beobachtet wird, Michelangelos außerordentliche Gaben für das praktische Leben durch einen entsprechenden Mangel daran in der Familie gleichsam wieder auszugleichen.
Von den 3000 Dukaten war sogleich ein bedeutender Teil nach Florenz abgegangen. Es verblieb übrigens in der Folge bei dieser Zahlung, obgleich Michelangelo sich zu starken Nachforderungen an den Papst berechtigt glaubte. Am 22. Januar 1507 bereits beantwortet Michelangelo einen Brief Buonarrotos, worin dieser über den Ankauf eines Grundstücks durch den Vater berichtet hatte. Giovansimone besteht darauf, nach Bologna zu kommen, Michelangelo weist ihn abermals zurück: erst müsse er den Guß hinter sich haben. Zu Mittfasten hoffe er sicher, würde es soweit sein; Ostern käme er nach Florenz. Die Dolchklinge für Orlandini sei dem besten Meister zu Bologna in Auftrag gegeben, falle sie nicht gut aus, so werde er sie umarbeiten lassen. Was diese Klinge anlangt, welche in den Briefen noch oft erwähnt wird, so sei gleich gesagt, daß sie endlich fertig und abgesandt wurde, dem Besteller nun aber nicht gefiel, so daß Michelangelo sie zurücknahm.
Das waren die Dinge etwa, die Michelangelo nebenbei im Kopfe hatte, während er an dem Modell der Statue arbeitete. Der Papst muß ihm doch ab und zu gesessen haben. Wie anders die Gedanken, die Giulio während dieser Zeit durch die Seele gingen. Er betrieb von Bologna aus die Allianz mit Frankreich gegen die Venezianer. Er wollte die ganze Romagna zurückhaben. Der König zeigte sich jetzt geneigter. Philipp von Burgund war in Kastilien plötzlich gestorben. Maximilians Pläne, in Italien einzufallen und, von Kastilien unterstützt, als Herr und Kaiser aufzutreten, verloren ihre Furchtbarkeit. Ludwig durfte daran denken gegen Venedig vorzugehen und der Republik die Teile des mailändischen Gebietes wieder abzunehmen, welche sie in Besitz genommen. Eine Zusammenkunft zwischen ihm und dem Papste in Bologna wurde ausgemacht, bei der das Nähere mündlich verabredet werden sollte.
Nun aber kamen dem Papste ganz andere Dinge zu Ohren. Genua hatte sich gegen den König von Frankreich erhoben, das Volk den Adel, der sich an ihn anlehnte, samt der französischen Besatzung aus den Mauern getrieben, als altes Reichslehen den kaiserlichen Adler aufgepflanzt und sich unter Maximilians Schutz gestellt. Giulio, von Geburt ein Genuese, seiner Neigung nach Demokrat, wie er denn auch in Bologna als Beschützer des Volkes gegen die Übergewalt des Adels aufgetreten war, unterstützte heimlich die Aufständischen. Er drang beim König auf einen Vergleich statt gewaltsamer Schritte gegen die Stadt. Jetzt vernahm er, daß Ludwig, unter dem Scheine, Genua zum Gehorsam zurückzuführen, umfangreiche Rüstungen mache, deren eigentlicher Zweck ein durchgreifender Zug nach Italien sei. Toskana solle eingenommen werden, in Pisa dann ein Konzil zusammentreten und der Kardinal d'Amboise als Papst daraus hervorgehen. Diese Nachrichten und zugleich die, daß Maximilian mit Ludwig halb und halb im Einverständnisse sei, gelangten durch die Venezianer nach Bologna.
Giulio vereinigte sich sogleich mit ihnen. Gemeinsame Schritte beim Kaiser wurden verabredet, um Schutz gegen Frankreich zu erreichen. Des drohenden Konzils wegen erschien des Papstes Anwesenheit in Rom notwendig. Der Kardinal von San Vitale wurde in Bologna als Legat eingesetzt; Giulio legte noch den Grundstein der neuen Zitadelle, die er zu bauen beabsichtigte, und zog Ende Februar 1507 nach Rom ab. Als Vorwand mußte die Erklärung der Ärzte dienen, daß ihm die Luft in Bologna nicht zuträglich sei. Auch wolle er fort, behauptete man, weil die Einkünfte in Rom ausblieben, wenn er nicht in Person dort zugegen sei.
Ehe er abreiste, sah er noch das Modell Michelangelos. »Am letzten Freitage war der Papst bei mir im Atelier«, heißt es in einem vom 1. Februar datierten Briefe. »Er gab mir zu verstehen, daß die Arbeit seinen Beifall habe. Bittet Gott, daß sie gut gerate, denn wenn dies geschieht, hoffe ich beim Papste große Gnade zu gewinnen. Er wird in diesem Karneval noch Bologna verlassen, so wenigstens geht bei den Leuten hier die Rede. Die Klinge schicke ich, sobald sie fertig ist, durch sichere Gelegenheit.«
Michelangelo hatte den Papst in mehr als dreifacher Lebensgröße dargestellt. Die Rechte war erhoben, in betreff der Linken hegte er Bedenken, was man am besten hineingebe. »Ob Sr. Heiligkeit vielleicht ein Buch genehm sei?« »Gib mir ein Schwert hinein«, rief der Papst aus, »ich bin kein Gelehrter!« Auch wollte er wissen, was die erhobene Rechte bedeute, ob er Fluch oder Segen austeile. Es war hergebracht nämlich, daß bei den Darstellungen des Jüngsten Gerichtes Christus als Richter mit erhobener Rechten die Mitte des Gemäldes bildete. Daran mochte der Papst sich erinnern. »Du rätst dem Volke von Bologna weise zu sein«, antwortete Michelangelo und nahm Abschied von seinem Herrn, der am Palmsonntage in Rom wieder eintraf, wo er festlich empfangen ward. Vor dem Vatikan stand ein Triumphbogen, eine Nachahmung des Konstantinbogens am Kolosseum, dessen Inschrift ihn als Sieger und Befreier begrüßte.
Genua, wo die unterste Klasse des Volkes den Herrn spielte, wurde jetzt angefeuert, standzuhalten. Ferdinand von Aragon hoffte der Papst auf seine Seite zu ziehen. Dieser war damals nach Neapel gegangen, weil Philipp von Kastilien Gonsalvo, den Vizekönig, aufgefordert hatte, dem Könige von Aragon den Gehorsam zu verweigern und ihm selbst vielmehr das Königreich auszuliefern. Gonsalvo dachte nach Philipps Tode daran, Neapel für sich zu behalten, huldigte aber Ferdinand, als dieser in Person erschien, und folgte ihm nach Spanien. Giulio dachte den König in Ostia zu sehen, wo die spanischen Galeeren vorüberkommen mußten. Zwar hatte er als derjenige, der die Investitur von Neapel erteilte, Gonsalvo angetrieben, sich zu erheben und mit ihm gemeine Sache zu machen, trotzdem wollte er nun mit Ferdinand unterhandeln. Dieser aber segelte, ohne anzulegen, vorbei nach San Savona, wo er mit Ludwig zusammentraf, der siegreich von Genua kam. Der Papst schickte den Kardinal von Pavia nach Savona, der aber bei den dortigen geheimen Verhandlungen gar nicht zugelassen ward. Nur das brachte er mit nach Rom zurück, daß die beiden Herrscher sich im innigsten Einverständnisse befänden, und der gefürchtete Kardinal d'Amboise der einzige Dritte bei ihren Unterhandlungen gewesen sei.
Zu bemerken ist hier, daß es in betreff Neapels schon längere Zeit zu einer Verständigung zwischen Aragon und Frankreich gekommen war. Die französisch gesinnten Barone kehrten zurück und erhielten ihre Güter wieder; Neapel verblieb Ferdinand, der dagegen eine französische Prinzeß heiratete, so alt er war, und eine Entschädigung in barem Gelde leistete.
Den Papst retteten die kollidierenden Interessen Frankreichs und Maximilians. Gegen Venedig waren beide einer Gesinnung, hatten sich auch wohl über Burgund und über Kastilien geeinigt, wo Max im Namen seines Enkels die Regierung verlangte, während Ferdinand sie zugleich in Anspruch nahm; aber daß Ludwig das Kaisertum für sich und die päpstliche Würde für Amboise als letztes Ziel vor Augen hatte, während Max sogar die seltsame Idee faßte, sich in Rom nicht nur zum Kaiser krönen zu lassen, sondern dort zu gleicher Zeit selber Papst zu werden, machte das Einverständnis unmöglich. Giulio unterhandelte stets mit beiden, er haßte sie gleichmäßig und hätte am liebsten gesehen, wenn sie sich einander zum Vorteile Italiens aufgerieben hätten. Immer verlangte er Hilfe von einem, wenn der andere drohte, immer stemmte er sich dennoch dagegen, wenn einer von beiden bewaffnet zu seinem Schutz erscheinen wollte. Während er durch den Kardinal von Pavia in Savona zu unterhandeln suchte, sandte er einen anderen Kardinal zum Reichstage nach Kostnitz, den Maximilian zusammenberufen hatte, weil er Geld und Soldaten für den italienischen Feldzug brauchte.
Diese Ereignisse füllten für Giulio den Sommer 1507. Bei Michelangelos Werke war unterdessen eingetreten, was er als Möglichkeit vorausgesagt hatte: der Guß verunglückte. Von Anfang an hatte er Widerwärtigkeiten bei der Arbeit. In jenem Briefe, der den Besuch des Papstes meldet, ist am Schluß von Verdrießlichkeiten die Rede, die ihm durch seine Leute verursacht wurden. »Wenn Lapo«, schreibt er, »und Ludovico, die hier in meinen Diensten standen, etwa mit dem Vater reden sollten, so sage ihm, er möge sich nicht um das kümmern, was sie aufstellten, besonders was Lapo vorbrächte, und sich durch nichts aufregen lassen. Sobald ich Zeit zum Schreiben hätte, würde ich ihm alles auseinandersetzen.«
Trotzdem traf ein, was er hatte verhüten wollen, denn ein an den Vater gerichteter Brief vom 8. Februar zeigt, daß dieser nicht nur den Klagen der beiden fortgeschickten Leute williges Gehör geliehen, sondern auch den Sohn darüber zur Rede gestellt hatte. Michelangelo gibt nun Auskunft. Zuerst verweist er den Vater auf einen an Granacci gerichteten Brief, welchen er sich zeigen lassen solle, in einem Postskriptum jedoch kommt er, wie dies öfter bei ihm der Fall ist, auf die Sache zurück und erzählt, wie ihn Lapo beim Ankaufe von 120 Pfund Wachs hätte betrügen wollen.
Diese Angabe gewährt Einblick in den Stand der Arbeit. Sie zeigt, daß der Guß der Statue damals vorbereitet wurde. Zuerst bedurfte es hierzu eines Tonmodells. War es getrocknet, so ersetzte man, was auf diese Weise geschwunden war, durch aufgetragenes Wachs, bis das Modell wieder seine volle Gestalt besaß, und umgab es mit einem dicken Überzuge von Lehm. Saß dieser wohlgetrocknet und fest darüber, so wurde das Ganze erhitzt, Ton und Lehm sogen das flüssig gewordene Wachs auf, und der frei gewordene, die ganze Figur umgebende hohle Raum nahm das Metall auf. Dies ist die einfachere Art zu gießen, die Benvenuto Cellini angibt. Die kompliziertere kann bei ihm, wie bei Vasari, gleichfalls nachgelesen werden.
Den Guß getraute sich Michelangelo indessen nicht auf eigene Faust auszuführen. Es gehörten dazu Erfahrungen, die nur langjährige Arbeit geben konnte, und die Sache war diesmal zu wichtig, um es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Michelangelo wandte sich an die Regierung von Florenz und erbat Meister Bernardino, der dem Geschützwesen der Republik vorstand, zur Hilfe. Da die Ehre der Stadt, sowohl dem Papste als den bologneser Künstlern gegenüber, mit auf dem Spiele stand, konnte ein solches Verlangen wohl gestellt werden. Am 20. April schreibt er jedoch seinem Bruder, er möge die Regierung wissen lassen, daß er, da auf sein Gesuch keine Antwort eingelaufen sei, und er daraus entnehme, daß Meister Bernardino wahrscheinlich aus Furcht vor der Pest nicht kommen wolle, einen Franzosen in Dienst genommen habe. Es sei ihm unmöglich gewesen, länger zu warten und untätig dazustehen.
In der Tat hatte im März das Sterben in Bologna begonnen. Es starben nicht viele – nur von vierzig Fällen hatte Michelangelo gehört, als er den 26. März schrieb – aber, wen die Pest einmal gefaßt hat, setzt er hinzu, den läßt sie nicht wieder los.
Fünf Wochen später kommt der Geschützmeister dann doch, der Mitte Mai erst Urlaub erhalten hatte, und Anfang Juli wird unter seiner Leitung der Guß vorgenommen.
Der Erfolg war kein erfreulicher. »Buonarroto«, beginnt der Brief, der dies meldet, »wisse, daß wir meine Figur gegossen und dabei Unglück gehabt haben, da Meister Bernardino, sei es aus Mangel an Sachkenntnis oder weil es ein ungünstiges Geschick so wollte, das Metall nicht gehörig geschmolzen hatte. Es ließe sich ein langes und breites darüber schreiben: genug, die Figur ist nur bis zum Gürtel gekommen, und das übrige Metall, d. h. die andere Hälfte, blieb im Ofen stecken, weil es nicht flüssig war, so daß ich, um es herauszubekommen, den Ofen einschlagen muß. Dies sowie die Herstellung der Form wird in dieser Woche noch vorgenommen, und bringen wir hoffentlich alles wieder in Ordnung, freilich nicht ohne große Arbeit, Anstrengung und Ausgaben. Ich war meiner Sache so gewiß, daß ich Meister Bernardino zugetraut hätte, er könne das Metall ohne Feuer schmelzen; auch will ich nicht sagen, daß er ein schlechter Meister sei und nicht das rechte Interesse daran gehabt habe, aber Irren ist menschlich, das ist diesmal bei ihm zur Wahrheit geworden, zu meinem und seinem eigenen großen Nachteil. Denn man hat hier in einer Weise über ihn gesprochen, daß er sich vor den Leuten kaum sehen lassen darf«
»Lies diesen Brief Baccio d'Agnolo vor, wenn du ihn siehst, und ersuche ihn, dem Sangallo in Rom darüber Nachricht zu geben. Empfiehl mich ihm, Giovanni da Ricasoli und Granaccio. Wenn jetzt alles gut abläuft, hoffe ich in vierzehn Tagen bis drei Wochen fertig zu sein und nach Florenz zu kommen, geht es nicht gut, so muß ich noch einmal ganz von vorn anfangen. Ich gebe dir Nachricht. Schreibe mir, wie sich Giovansimone befindet. Der Einschluß ist ein Brief an Giuliano di Sangallo nach Rom. Sende ihn so gut und so schnell als möglich ab oder, wenn er in Florenz ist, gib ihn ihm.«
Sehr bald war das Versehen nun wieder gutgemacht. Der obere Teil der Statue wurde zum zweiten Male gegossen. Am 6. Juli hatte Michelangelo das Mißlingen gemeldet: schon am 30. konnte er vom neuen Gusse berichten. Noch sei die Form freilich so heiß, daß man nicht daran rühren dürfe, und sogar abermals eine Woche später war die nun wohlgelungene Statue nur zur Hälfte aufgedeckt. Es hätte der Guß viel besser, aber auch viel schlechter ausfallen können, schreibt Michelangelo, indem er zugleich seinen Bruder dringend bittet, ihm die Florentiner Erzgießer vom Halse zu halten, welche sich sofort zu ihm auf den Weg hatten machen wollen. Den 2. August endlich teilt er mit, die Statue sei frei und besser ausgefallen, als er erwartet habe.
Michelangelos hauptsächlichster Korrespondent war damals freilich Sangallo, an welchen die Briefe durch Buonarroto nach Rom gingen. Diese besitzen wir nicht mehr. Ohne Zweifel verfolgten Michelangelos Freunde in Rom den Gang der Dinge mit Spannung. Er selbst fühlte sich unbehaglich und sehnte sich nach dem Abschlusse der Arbeit. Tausend Jahre deuchte es ihn noch, daß er dies elende Leben weiter zu ertragen habe. Ein einziges Mal, seit er überhaupt in Bologna sei, habe es geregnet, und eine Hitze herrsche, wie er sie nie für möglich gehalten. Dabei sie der Wein teurer wie in Florenz und ein jämmerliches Getränk.
Im Oktober schreibt er sehr zufrieden über den Stand der Dinge, er hoffe jetzt rasch zu Ende zu kommen und große Ehre einzulegen. Im November aber gewinnt die trübe Stimmung wieder die Oberhand. Buonarroto hatte wegen Familienangelegenheiten Michelangelos baldige Rückkehr verlangt. Er selber, antwortete dieser, wünsche wohl noch mehr als sie, daß er kommen könne. »Ich befinde mich«, lauteten seine Worte, »hier in der unangenehmsten Lage. Wenn ich diese angestrengte Arbeit, die mir Tag und Nacht keine Ruhe läßt, zum zweiten Male tun sollte, ich glaube kaum, daß ich es durchzusetzen imstande wäre. Ich bin überzeugt, kein anderer, dem diese ungeheure Last aufgelegt worden wäre, hätte sie ertragen. Mein Glaube ist, daß eure Gebete mich aufrecht und gesund erhalten haben. Denn niemand in Bologna, selbst nach dem glücklichen Verlauf des Gusses nicht, glaubte, daß ich mit der Statue gut zu Ende käme; vorher glaubte kein Mensch, daß der Guß gelingen würde. Bis zu einem gewissen Punkte habe ich sie nun gebracht, vollenden werde ich sie jedoch in diesem Monat nicht, im nächsten aber jedenfalls, und dann komme ich. Bis dahin seid gutes Mutes, ich werde halten, was ich versprochen habe. Versichere dies dem Vater und Giovansimone in meinem Namen, und schreibe mir, wie es mit Giovansimone geht; lernt ordentlich und gebt euch Mühe im Geschäft, damit ihr, wenn es darauf ankommt, und das wird bald der Fall sein, die nötige Erfahrung habt.«
Der folgende Brief vom 20. Dezember enthält die Bitte, ein beigelegtes Schreiben rasch und sicher an den Kardinal von Pavia nach Rom gelangen zu lassen; er könne nicht fort von Bologna, ohne Antwort darauf zu haben. Am 5. Januar 1508 dankt er für die pünktliche Besorgung. Er hofft in vierzehn Tagen abzureisen; tausend Jahre schienen ihm zu sein bis dahin, denn seine Lage sei derart, daß, wenn Buonarroto sie sähe, er ihn bedauern würde. Dies sei der letzte Brief aus Bologna.
Es wäre interessant zu wissen, was er dem Kardinal Alidosi mitzuteilen gehabt, denn gerade dieser traf bald darauf in Bologna ein, und zwar infolge von Ereignissen, durch die der Winter dort zu einer bewegten Zeit gemacht wurde. Die Bentivogli, die in Mailand saßen, und ihre Anhänger in Bologna hatten das Mögliche versucht, die verlorene Herrschaft zurückzugewinnen. Da Frankreich, das mit Giulio noch keineswegs öffentlich gebrochen hatte, nicht zugab, daß sie ihre Pläne unverdeckt betrieben, so nahm man zu heimlichen Mitteln seine Zuflucht. Sie versuchten den Papst zu vergiften. Sie warben in der Stille Truppen und verabredeten mit ihren Anhängern in der Stadt einen Überfall. Vor allem wollten sie sich an den Marescottis, ihren bittersten Feinden, rächen, die das Signal zum Anzünden des Palastes gegeben hatten. Auf das Volk hofften sie, weil der Legat sich durch Habsucht unerträglich machte. Dieser Kardinal von San Vitale war vom gemeinsten Stande so hoch erhoben worden, nur weil er ein Landsmann des Papstes und dessen williger Diener war.
Anfang 1508 sollte die Verschwörung zum Ausbruche kommen. Die Umtriebe der Bentivogli aber blieben nicht unbemerkt. Die Marescotti, die am meisten zu fürchten hatten, waren am scharfsichtigsten gewesen. Sie sahen die Dinge kommen, Ercole Marescotti ging nach Rom, um besondere Maßregeln des Papstes zum Schutze der Seinigen zu erbitten. Jetzt war Eile nötig. Nachts wird der Palast der Marescotti umzingelt. Was man darin fände, wolle man umbringen und dann die Bentivogli in die Stadt lassen. Aber die im Schlafe Überraschten, Männer, Frauen und Kinder, flüchten halbnackt über die Dächer anstoßender Häuser, nur zwei Diener werden ergriffen und niedergemacht. Dann mit zwei Kanonen, die sie im Palaste vorgefunden, ziehen sich die Aufrührer in eins der befestigten Tore der Stadt zurück – Stadttore waren in jenen Zeiten immer kleine Zitadellen – und setzten sich in Verteidigungszustand.
Päpstliche Truppen lagen nicht in der Stadt. Nur in den seltensten Fällen gestatteten damals die Bürger einer Stadt geworbenen Soldaten den Eintritt in ihre Mauern, nicht einmal denen, die sie selbst bezahlten. Die Zitadelle des Papstes stand noch unfertig da. Der Kardinal wußte nicht mehr, was zu tun sein. Dagegen unterhandelte nun der Senat mit den Anführern, die vergebens auf die Bentivogli gewartet hatten und sich endlich aus ihrer Position am Tore in ihre Häuser zurückzogen.
Der Papst verzieh alles von Rom aus, berief San Vitale zurück, nahm ihm die erpreßten Summen ab und steckte ihn in die Engelsburg. Der Kardinal von Pavia, Francesco Alidosi, gefürchtet wie Giulio selber, mächtig wie er und habgieriger noch als sein Vorgänger, traf als neuernannter Legat in Bologna ein. Er legte achthundert Mann in die Stadt, beschleunigte den Bau der Zitadelle, ließ den Palast der Marescotti auf öffentliche Kosten wiederherstellen und einer Anzahl Bürgern nach kurzer Prozedur auf dem Markte die Köpfe herunterschlagen. So stand es in Bologna zu der Zeit, wo die Bildsäule des Papstes fertig über dem Hauptportal von San Petronio aufgestellt ward. Am 21. Februar 1508 geschah es, nachdem sie eine Woche vorher bereits an die Kirche geschafft worden war. Noch am 18. hatte Michelangelo seinem Bruder geklagt, nun, da alles fertig sei, ziehe man ihn mit den Arbeiten wieder hin, und er dürfe nicht abreisen, weil Giulio ihm befohlen habe, nicht eher von Bologna fortzugehen, als bis die Statue an Ort und Stelle sei. Diese Woche wollte er noch warten, dann aber abreisen, ohne sich an den Papst zu kehren.
Nur drei Tage brauchte er noch zu warten. Unter Glockengeläute, Getön von Trompeten, Pfeifen, Trommeln und Geschrei des Volkes ging die Enthüllung vor sich, genau in dem Augenblicke, welchen die Astrologen als den günstigsten bezeichnet hatten. Mit Erleuchtung der Stadt, Feuerwerk und Festlichkeiten wurde der Tag geschlossen. Der Papst hielt weder Schwert noch Buch in der Linken, sondern die Schlüssel des heiligen Petrus, während er mit der Rechten dein Volke den Segen gab.
Das Portal, auf dem die Statue stand, das mittelste der drei gotischen Kirchentore, welche die unvollendete Fassade der Kirche schmücken, ist ein Werk Jacopo della Quercias, eines von denen, die um die Türen San Giovanni mitkonkurrierten. Als Ghiberti den Preis erhielt, ging Jacopo nach Bologna, wo ihm durch Giovanni Bentivoglis Fürsprache das Tor von San Petronio übertragen ward. Dreitausend Goldgulden erhielt er dafür und freien Marmor. So traf überall wieder toskanische Arbeit mit ihresgleichen zusammen in Italien.
Michelangelo, dessen Werk nun also vollendet war, kehrte nach Florenz zurück. Wem er in Bologna etwa nahe gestanden während der Zeit, die er dort arbeitete, wissen wir nicht; über seinen ferneren Zusammenhang mit Messer Aldovrandi etwa wird nichts mitgeteilt. Doch finden wir diesen als Mitglied der von der Bürgerschaft dem siegreichen Papste entgegengesandten Deputation.
Das dagegen kann als ziemlich sicher angenommen werden, daß Michelangelo mit den Künstlern der Stadt, deren Neid ihn das erste Mal davontrieb, auch diesmal keine Freundschaften schloß.
Francesco Francia, der berühmte Goldschmied, Maler und Stempelschneider, war das Haupt der bolognesischen Schule. Er kam zu Michelangelo in die Werkstätte und besah sich die Statue. Ohne über anderes zu reden, äußerte er nur, das Metall sei gut. »Wenn es gut ist«, antwortete Michelangelo, »so kann ich mich beim Papste dafür bedanken, der es mir geliefert hat, gerade so wie ihr euch beim Kaufmann, bei dem ihr die Farben kauft, für eure Bilder bedanken könnt.«
Francia, ein heiterer, herzlicher Mann, der fremdes Verdienst gern anerkannte, mag dennoch von Anfang an Michelangelo nicht unbefangen gegenübergestanden haben. Die Eifersucht der Parteien spielte vielleicht nach Bologna hinüber. Als ein Freund Peruginos, dem er durch gemeinsame treffliche Schüler verbunden war, ist es nicht zweifelhaft, auf welcher Seite er stand. Und hierzu stimmt, daß er sich später als einen begeisterten Freund Raffaels zu erkennen gab.
Wie scharf es aber zwischen Michelangelo und Perugino herging, zeigt ein Vorfall, den ich hier erwähne, weil die Zeit, in der er sich ereignete, von Vasari nicht näher angegeben wird. Perugino hatte sich mit beleidigendem Spotte über Michelangelos Arbeiten ausgesprochen, und dieser darauf gesagt, daß er ihn in seiner Kunst für einen rohen, unwissenden Menschen halte. Perugino geht vor Gericht und verklagt ihn, wird aber mit seiner Klage auf eine Weise abgewiesen, die noch empfindlicher für ihn als Michelangelos Worte waren. Dieser hatte recht; er sagte nur, was sich nicht leugnen ließ. Perugino war seit 1500 etwa, nachdem er bis dahin ausgezeichnete Werke vollendet hatte, in eine schwunghafte Bilderfabrikation hineingeraten, die ihm jenen Vorwurf um so eher eintragen konnte, als er, in einer stämmigen, handwerksmäßigen Art und Weise auftretend, diejenigen obendrein verhöhnte, die, mühsamer und gewissenhafter arbeitend, ihn zu übertreffen suchten, wie er selbst jedoch die Sache auffaßte: seinen wohlerworbenen Ruf zu untergraben trachteten.
Michelangelo, dem die Kunst das Höchste auf Erden war, dem ihre Erniedrigung um des Geldgewinns willen verächtlich schien, mußte sich um so tiefer beleidigt fühlen durch den Anblick eines Meisters, der so Vortreffliches früher zustande gebracht und nun, statt weiterzuschreiten, rückwärts ging. Und dies nicht etwa, weil die Not ihn trieb, sondern weil er das, was er sich bereits erworben, bequem und rasch zu vermehren wünschte. Aus Ärger über den beschämenden Erfolg seines Vorgehens bei Gericht soll Perugino die Stadt damals verlassen haben. Es kann übrigens, wenn es überhaupt geschah, doch nur für kurze Zeit gewesen sein, denn er taucht bis in die spätesten Zeiten seines Alters in Florenz immer wieder auf.
Mochte nun Francias Zusammenhang mit Perugino schuld sein an seiner Verstimmung gegen Michelangelo, keinenfalls scheint dieser selbst etwas dazu getan zu haben, Francia sich geneigter zu machen. Wenn wir Vasari glauben wollen, der obiges Zusammentreffen auch erzählt, so ist es dabei noch viel schlimmer zugegangen. Nach ihm hätte Michelangelo dem guten Francia die derbe Antwort erstens im Beisein anderer Leute gegeben, zweitens aber noch ein allgemeines Urteil über ihn und seinen Schüler Costa hinzugefügt, das nicht wegwerfender gedacht werden kann. Vasari mildert die Ausdrücke etwas in der zweiten Auflage seines Buches, wonach Michelangelo nur das eine Wort gebraucht haben soll, mit dem er auch Perugino taxierte, daß Francia ein goffo, ein roher Handwerker sei. Wollen wir aber auch alles für eine von jenen Klatschgeschichten halten, die niemals in Wirklichkeit so vorgefallen sind, wie man sie wiedererzählen hört, so bleibt doch immer der letzte Eindruck, Michelangelo habe rücksichtslos seine Meinung ausgesprochen und sich nicht viel darum gekümmert, ob es in derben Worten geschah. Francia gegenüber scheint er sich aber ganz besondere Gewissenhaftigkeit zur Pflicht gemacht zu haben. Durch den eigenen Sohn, einen schönen Knaben, ließ er Francia sagen, seine lebendigen Gestalten gerieten ihm besser als die, welche auf seinen Bildern zu sehen seien. Auch das erzählt Condivi. Wohl möglich, daß die Stimmung, die sich unter diesen Umständen erzeugte, an dem traurigen Schicksale Anteil hatte, dem die Statue, die Michelangelo eben mit so großen Mühen vollendete, einige Jahre später anheimfiel.
Denn es will mir scheinen, als sei Francias Abneigung gegen Michelangelo und die zweideutige Art, dessen Werk anzuerkennen, auch die Folge politischer Gereiztheit gewesen. War die Familie Bentivogli den Bürgern verhaßt gewesen: den Künstlern hat sie stets reichlich zu tun gegeben. Francia besonders war von ihnen geliebt und geehrt worden. Jetzt lag ihr Palast in Trümmern, in dem er selbst gemalt, und die große Glocke seines Turmes war in die Form der Statue des Papstes miteingeflossen. Jetzt mußte Francia, der früher die Stempel der bentivoglischen Münzen geschnitten, als besoldeter Vorsteher der Münze zur Arbeit verpflichtet, die Münzen schneiden, auf denen Giulios Kopf zu sehen war und deren Inschrift ihn als den Befreier der Stadt von den Tyrannen pries. Übermäßig betrübt war Francia durch diese Erlebnisse, wußte sich aber, wie Vasari gleichfalls erzählt, als verständiger Mann still in sein Schicksal zu finden. Einem allein gegenüber jedoch konnte ihm das nicht gelingen, dem, der jetzt als fremder Künstler in Bologna erschien, um das Bild dessen zu gießen, der dieses Unglück über die Stadt gebracht. Und obendrein diese Statue ein außerordentliches Werk! Francia, das Haupt der bolognesischen Künstlerschaft, durfte sich kaum anders als feindlich Michelangelo gegenüberstellen.
Möglich, daß noch etwas anderes durch diese Lage der Dinge herbeigeführt ward: in demselben Winter 1506 auf 7, in welchem Michelangelo seine Arbeit in Bologna begann, erscheint dort zum Besuch von Venedig aus Albrecht Dürer und wird von den Künstlern mit großer Auszeichnung aufgenommen. Ehe er von seiner zweiten italienischen Reise zurückkehrte, unternahm er diesen Abstecher; nirgends aber eine Spur, daß er mit Michelangelo zusammengetroffen sei. Als Anknüpfungspunkt hätte Martin Schongauer dienen können, nach dessen Stich Michelangelo seine erste Malerei zustande gebracht, während Dürer, der Schongauer hoch verehrte, nichts mehr bedauerte, als des Glückes nicht teilhaftig geworden zu sein, bei ihm als Schüler gelernt zu haben. Eine unbefangene Begegnung beider aber wäre vielleicht kaum möglich gewesen. Hätten es die einheimischen Künstler nicht getan, die in Bologna studierenden Deutschen würden Dürer zurückgehalten haben. Denn diese empfanden die Mißachtung schmerzlich, in der der deutsche Kaiser damals in Italien stand, und sahen den Papst, in dessen Diensten Michelangelo stand, für den Teufel an, der auch für sie an allem Unheil schuld war.
So betrachtet erscheint Michelangelos Einsamkeit als ein natürliches Produkt der Verhältnisse. Aber auch ohne diese Einwirkung würde er sich still und zu Hause gehalten haben, wie er am liebsten tat. Wir sehen, daß die Sorge um seine Familie auf ihm lastete. Die Traurigkeit, die den Grundzug seines Wesens bildet, fand nur Trost in der Hingebung an seine Arbeit. Wüßte man ein einziges Beispiel anzuführen, daß er der großartigen Idee treulos geworden sei, die er von der Mission eines Künstlers hegte, so müßte sein Benehmen seinem Standesgenossen gegenüber hochmütig und roh genannt werden, und gerade daß er ihn an Talent so weit überragte, spräche am stärksten gegen ihn. Aber dem Gefühl, das ihn so streng urteilen ließ, genügte er selbst in vollem Maße. Er wies jede Bestellung zurück, die er nicht würdig erfüllen zu können glaubte. Er kam auf das freundlichste denen zu Hilfe, die seine Hilfe in Anspruch nahmen. Die Kindlichkeit seines Charakters bricht überall durch, wo wir ihn näher kennenlernen, und Soderinis Brief enthielt kein Lob, das mit der Wahrheit im Widerspruch stand. Tief versunken jederzeit in seine Pläne und voll Liebe zu dem, was er zur Erscheinung bringen wollte, war es ihm unerträglich, anderen zu begegnen, die anders dachten. Ohne zu wollen und zu wissen vielleicht, wie sehr er sie verletzte, tat er dann Aussprüche, durch die er die Zahl seiner Feinde vermehrte, welche ihm sein überragendes Talent allein schon erzeugen mußte.
Siebentes Kapitel
1508-1509
I
Michelangelo fand, als er nach Florenz zurückkam, eine Reihe von Arbeiten vor, deren Fortführung notwendig war. Der Karton mußte gemalt, der Bronzedavid beendigt werden; die zwölf Apostel für den Dom waren kaum begonnen. Bei diesen hatten die Besteller einstweilen die Hoffnung aufgegeben und das dafür gebaute Haus vermietet. Michelangelo nahm es jetzt selber auf ein Jahr für zehn Goldgulden, doch wohl zu keinem anderen Zwecke, als um die Arbeit darin vorwärts zu bringen. Endlich, Soderini hatte einen großen Plan: es sollte eine kolossale Statue auf den Platz vor dem Regierungspalaste kommen und Michelangelo sie ausführen. Über den Block verhandelte man bereits mit dem Besitzer von Carrara, dem Marchese Malaspina.
Alles dies mußte jedoch zurückstehen gegen das Grabdenkmal Giulios. Michelangelo blieb nur den März 1508 in seiner Vaterstadt und ging dann wieder nach Rom. Er dachte nicht anders, als seine Kräfte ganz dem großen Werke zu widmen, das er vor zwei Jahren verlassen hatte, allein davon war keine Rede jetzt im Vatikan. Dem Papste war nicht wieder auszureden, die Aufstellung eines Grabdenkmales bei seinen Lebzeiten sei ein böses Omen. Michelangelo sollte die Wölbung der Sixtinischen Kapelle malen. Es war der alte Wunsch Giulios, auf den er wieder zurückkam.
Der Auftrag war Michelangelo durchaus nicht zu Sinne. Er erwiderte, daß er in Farbe nie etwas getan habe und um andere Arbeit bitten müsse. Sein Widerspruch jedoch machte den Papst nur um so hartnäckiger, und Giuliano di Sangallos vermittelnder Einfluß brachte es diesmal dahin, daß Michelangelo auf die Sache einging.
Die Sixtinische Kapelle, heute durch verschiedene Bauten späteren Datums so mit dem vatikanischen Palaste verbunden, daß ihre äußere Architektur in dem großen Ganzen völlig drinsteckt, ist ein viereckiger Raum, über das Doppelte so lang als breit und von bedeutender Erhebung, so daß er hoch und schmal erscheint. Die Wände sind glatt, die Fenster, je sechs an der Zahl, verhältnismäßig schmal und niedrig und dicht unter der gewölbten Decke an den beiden längeren Seiten angebracht. Nahe unter ihnen bildet ein schmaler, krönungsartig vorspringender Mauerabsatz, der heute mit einer niedrigen metallnen Balustrade geschützt ist, eine Galerie, auf der sich entlang zu drängen viele schwindlig machen würde. Die Fenster sind oben gerundet. Über ihnen setzt das glatte Gewölbe der Decke an die Seitenwände an, und zwar so, daß die Zwickel immer zwischen den Fenstern spitz in die Wand herab verlaufen.
Zuerst ging die Absicht des Papstes nur dahin, den mittleren Teil der Deckenwölbung mit Gemälden von geringer Figurenzahl ausfüllen zu lassen. Es kam ein Kontrakt zustande, nach welchem der Preis für alles in allem auf 3000 Scudi festgestellt wurde. »Heute, am 30. Mai 1508«, lautet eine auf uns gekommene Notiz, »habe ich, Michelangelo, der Bildhauer, von Seiner Heiligkeit Papst Giulio dem Zweiten fünfhundert Dukaten erhalten, welche mir Messer Carlino, der Kämmerer, und Messer Carlo Albizzi auf Rechnung der Malerei ausgezahlt haben, mit der ich heutigentages in der Kapelle des Papstes Sixtus beginne, und zwar unter den kontraktlichen Bedingungen, welche Monsignor von Pavia aufgesetzt und ich mit eigener Hand unterschrieben habe.«
Michelangelo begann darauf, seine Entwürfe zu machen. Bald überzeugte er sich, daß die Malerei in dieser Weise ausgeführt, zu einfach und erbärmlich erscheinen müsse, und der Papst stimmte ihm bei. Es wurde nun beschlossen, den ganzen Raum bis zu den Fenstern mit Gemälden zu bedecken, und Michelangelo freigestellt, die Kompositionen nach eigenem Gutdünken zu schaffen. Ein neuer Kontrakt erhöhte den Preis dafür auf das Doppelte, und die Arbeit in der Kapelle wurde in Angriff genommen.
Ehe es jedoch hier zum Malen kam, waren eine Anzahl Schwierigkeiten zu überwinden, deren erste in der Errichtung eines brauchbaren Gerüstes bestand. Bramante hatte Löcher durch die Wölbung der Decke geschlagen, Stricke hindurchgelassen und auf diese Weise ein schwebendes Gerüst hergestellt. Michelangelo fragte, wie er es denn bei der Malerei mit den Löchern halten solle? Bramante gab den Übelstand zu, ohne jedoch zu wissen, wie ihm abzuhelfen sei. Es scheint nicht, daß es Übelwollen von seiten Bramantes war, wenn er kein besseres Gerüst bauen zu können erklärte. Das einfachste wäre gewesen, es vom Boden aus auf Balken in die Höhe zu bringen. Daraus aber, daß dies nicht geschah und daß man nicht einmal daran dachte, ergibt sich vielleicht, daß es bei seiner Errichtung zugleich darauf ankam, die Kapelle unten frei zu lassen, damit durch die Arbeit ihre Benutzung für gottesdienstliche Zwecke nicht verhindert würde.
Michelangelo erklärte dem Papste, so ginge die Sache nicht. Giulio erwiderte, er möge selber etwas Besseres erfinden, wenn er könne. Bramante stand dabei. Michelangelo ließ hierauf alles wieder fortnehmen, was dieser eingerichtet hatte, und stellte ohne Stricke und Löcher ein Gerüst her, das seinem Zwecke aufs Angemessenste entsprach und damals als eine ganz neue Erfindung galt. Aus der einen Bemerkung Condivis, daß das Gerüst, je mehr man es belastet habe, um so besser gehalten hätte, läßt sich erkennen, daß es ein sogenanntes Sprengewerk war; wahrscheinlich gab der Mauervorsprung unter den Fenstern die Stützpunkte für die Balken ab, die, je zwei schräg gegeneinander laufend und durch einen dritten keilartig zwischeneingelegten Balken auseinandergestemmt, feste Spannungen bildeten, auf denen sich vermittelst quergelegter Bretter der Boden des Gerüstes herstellen ließ. Vasari aber, der auch hier Condivi ausschreibt, von dem Seinigen jedoch dazu tut, sagt, die Balken hätten auf Stützen geruht, um die Mauer nicht berühren zu müssen. Vielleicht hatte er den Mauervorsprung nur vergessen, denn hätte dieser gefehlt, so wäre allerdings die Aufrichtung von Balken an den Wänden nötig gewesen, auf deren Köpfen die das Sprengewerk bildenden Hölzer ihre Stütze gefunden hätten.
Von dieser Gerüstkonstruktion sagt Condivi, sie habe Bramante die Augen geöffnet und ihm später beim Bau des Sankt Peter wesentliche Dienste geleistet. Michelangelo aber hätte dabei so viel Stricke erübrigt, daß ein armer Zimmermann, dessen Hilfe er sich bei der Arbeit bediente und dem er das Tauwerk zum Geschenk gemacht, seinen zwei Töchtern mit dem daraus gezogenen Gelde eine Aussteuer schaffen konnte.
Die zweite Not bestand in der Wahl tüchtiger Gehilfen. Michelangelo ließ eine Anzahl Maler aus Florenz kommen, deren Namen deshalb von Interesse sind, weil sie uns einen Teil der buonarrotischen Partei unter den dortigen Künstlern zeigen. Zuerst sein ältester Freund Granaccio, über dessen Werke und Lebenslauf im übrigen wenig zu sagen bleibt. Er fuhr fort, wie er angefangen hatte; wo es sich um feierliche Einholungen, Aufführung von Komödien, Errichtung von Triumphbögen oder um Maskeraden handelte, zeichnete er sich aus, als Künstler hat er weniger geleistet. Sodann Bugiardini, der gleichfalls im Garten von San Marco und bei Grillandaio mit in der Lehre gewesen war und dessen Fleiß, Herzensgüte und einfaches Wesen, dem sich keine Spur von Neid oder Mißgunst beimischte, die Grundlage lebenslänglicher Freundschaft mit Michelangelo bildeten. Ein großer Genius war Bugiardini nicht. Michelangelo sagte im Scherz von ihm, er sei ein glücklicher Mensch, weil er immer so zufrieden sei mit dem, was er zustande gebracht habe, während er selbst niemals ein Werk zu völliger, eigener Befriedigung vollendet hätte.
Indaco ferner, auch dieser aus der Schule des Grillandaio her Michelangelos genauer Freund. Einen anderen Anspruch auf Berühmtheit hat er heute nicht mehr. Von Jacopo del Tedesco ist weiter nichts bekannt, als daß er möglicherweise ein Schüler Grillandaios war, und bei Agnolo di Donnino versagen Quellen und Vermutungen jede Auskunft. Der bedeutendste von denen aber, die damals nach Rom kamen, war Bastiano di Sangallo, ein Schwestersohn jener berühmten Brüder und Gönner Michelangelos, zugleich ein Künstler, der als erklärter Renegat die Schule Peruginos verlassen hatte, in dessen Atelier er 1500 arbeitete, und zu Michelangelo übergegangen war. Der Karton der badenden Soldaten hatte ihm höhere Ansichten eingeflößt. Er gehörte zu Michelangelos eifrigsten Anhängern. Keiner zeichnete mit solchem Eifer nach dem Karton. Er ist der einzige gewesen, der ihn seinem ganzen Umfange nach kopierte, während andere nur einzelne Gruppen zeichneten. Die in England befindliche kleine, grau in grau gemalte Kopie des Werkes wird für seine Arbeit ausgegeben. So gescheit und eingehend soll er über die anatomische Richtigkeit und die Verkürzungen der Figuren darauf gesprochen haben, daß man ihm in Florenz den Obernamen Aristotile gab, unter dem er gewöhnlich angeführt wird. Als Architekt und Maler spielte er in späteren Jahren eine Rolle in Rom und Florenz, und sein von Vasari beschriebenes Leben nimmt viele Seiten ein.
Mit diesem halben Dutzend versuchte es Michelangelo. Bald bemerkte er, daß die Arbeit nichts wert sei. Die Art, wie er sie nun wieder los zu werden suchte, ist charakteristisch. Er war fest und unbeugsam in seinen Überzeugungen Feinden gegenüber, aber schüchtern von Natur bei gewöhnlichen Gelegenheiten. Wo es sich darum handelte, andere zu verteidigen oder für die eigene Ehre schroff einzutreten, fehlten ihm Entschlossenheit und Stärke nicht, wo aber diese Erregung des Geistes nicht zum Ausbruch kommen konnte und das Gefühl eine gewisse mittlere Temperatur behielt, ertrug er die Dinge und war leicht in Verlegenheit zu setzen.
So hatte er diesmal nicht das Herz, seinen Freunden einzugestehen, daß er sie nicht brauchen könne. Gleich bei ihrer Berufung war der Fall ins Auge gefaßt worden, daß man, wie die eigenen Worte Michelangelos lauten: sich veruneinigte und die Abfindung festgesetzt, mit der sie sich zu begnügen hätten: Michelangelo aber, statt sich auszusprechen, ging ihnen plötzlich aus dem Wege und war nirgends aufzufinden. Die Kapelle, als sie zur Arbeit wie gewöhnlich kamen, fand sich verschlossen. Endlich merkten sie die Sache, und sie machten sich still wieder auf den Weg nach Florenz. Es wird nicht erzählt, ob sie es ihm später nachgetragen haben. Von Granaccio wissen wir, daß es nicht der Fall war. Er blieb der Freund der Familie. Von einem andern freilich zeigen die Londoner Briefe, daß er die Sache krumm nahm, und zwar von demselben Jacopo, der, weil er vielleicht der unbedeutendste war, sich am meisten beleidigt fühlte. Der Brief, datiert vom Januar ohne weitere Zahl, aber ohne Zweifel ins Jahr 1509 zu setzen, ist an den alten Lodovico gerichtet: »Schon ein Jahr ist es«, schreibt Michelangelo, »daß ich keinen Groschen vom Papste erhalten habe. Ich bitte nicht darum, weil es mit dem Werke nicht vorwärts will und ich mir keinen Anspruch auf Lohn zu haben scheine. Schuld daran hat die Schwierigkeit der Arbeit und daß sie nicht mein Handwerk ist. So verliere ich umsonst meine Zeit, Gott helfe mir. Wenn ihr Geld braucht, so geht zum Spitalmeister und laßt euch fünfzehn Dukaten auszahlen und schreibt mir, wie viel übrigbleibt.« Dieser Spitalmeister von Santa Maria Nuova war der Vertrauensmann, dem Michelangelo seine Gelder zur Aufbewahrung und ohne Zinsen dafür zu empfangen überlieferte, und von dem er den Seinigen, was sie bedurften, in die Hände geben ließ.
»Dieser Tage«, heißt es im Briefe weiter, »ist von hier der Maler Jacopo abgereist, den ich herzukommen veranlaßte, und der sich sehr über mich beklagt hat. Er wird sich auch wohl bei euch beschweren. Macht nichts daraus. Er ist, um es kurz zu sagen, tausendfach im Unrecht gegen mich, und ich könnte im höchsten Grade Klage über ihn führen. Tut, als sähet ihr ihn nicht.«
Das Auskunftsmittel, das er gegen Jacopos Klagen vorschlägt, entspricht ganz der Art und Weise, wie er ihn und die anderen fortgeschickt hatte. Die traurige Stimmung, in der er sich befand, und das Verzweifeln am Fortschritte der Malerei aber hatte in einem Umstande seinen Grund, der ihn damals gerade beinahe dahin gebracht hätte, das Ganze aufzugeben.
Er hatte heruntergeschlagen, was die Florentiner Künstler gemalt. Von jetzt an sollte ihm außer seinem Farbenreiber, den er nicht entbehren konnte, und außer dem Papste, der sich nicht abweisen ließ, kein Mensch auf die Gerüste kommen. Kaum aber hatte er einen Teil des ersten Gemäldes zustande gebracht, als beim Eintreten eines heftigen Nordwindes die Mauer innen auszuschlagen begann und die Farben unter dem Schimmel verschwanden. Längst war ihm die ganze Sache zur Last geworden, jetzt erschien ihm das neueste Unheil als entscheidender Grund, sich dem Auftrage dennoch zu entziehen. Er ging zum Papste und meldete, was geschehen sei. »Ich hatte es Eurer Heiligkeit gleich gesagt, daß Malerei nicht mein Handwerk sei; alles, was ich gemalt habe, ist verdorben. Wenn Ihr es nicht glauben wollt, so sendet hin und laßt nachsehen.«
Der Papst schickte Giuliano di Sangallo in die Kapelle, der die Ursache des Übels erkannte. Michelangelo hatte den Kalk zu naß aufgetragen, die Feuchtigkeit sich gesenkt und auf der äußeren Fläche Schimmel angesetzt, der weiter keinen Schaden tat. Michelangelo konnte sich nicht mehr entschuldigen und mußte wieder hinauf an seine Arbeit.
Aus dem Jahre 1508, in dem es, wie wir sahen, noch kaum zum Malen gekommen war, und aus den folgenden Jahren bieten die Londoner Manuskripte viele Briefe, welche über die Verhältnisse, unter denen Michelangelo arbeitete, Aufschluß geben.
Zuerst ein Schreiben vom 2. Juli 1508 an Buonarroti. Es soll einem jungen spanischen Künstler zur Empfehlung dienen, der von Rom nach Florenz ging, um dort seine Studien fortzusetzen. »Er hat mich gebeten«, schreibt Michelangelo, »ihm doch die Ansicht des Kartons zu verschaffen, den ich im Saal begonnen habe. Suche ihm deshalb unter allen Umständen die Schlüssel zu verschaffen, und kannst du ihm sonst guten Rat geben, so tue es mir zuliebe, denn es ist ein vortrefflicher Mann.«
»Giovansimone«, fährt er fort, »ist hier. Vergangene Woche war er krank und hat mir zu allem, was ich ohnedies schon zu tragen habe, keinen geringen Zuwachs an Sorge gemacht. Jetzt geht es besser mit ihm. Hört er auf meinen Rat, so kehrt er bald nach Florenz zurück, denn die Luft hier bekommt ihm nicht.« Zum Schlusse nennt er noch einige Namen von Freunden, denen ihn Buonarroto empfehlen solle.
Der Sommer 1508 muß besonders verderblich gewesen sein (der erste vielleicht, den Raffael in Rom zubrachte), denn ein anderer Brief handelt von einem neuen Krankheitsfalle. Sein Diener Pierbasso ist der bösen Luft unterlegen und hat sich, krank wie er war, nach Florenz aufgemacht, war aber so elend bei der Abreise, daß Michelangelo fürchtet, der Mensch möchte unterwegs liegengeblieben sein. Er verlangt einen andern Diener, und zwar rasch, da er so allein nicht mehr fortwirtschaften könne. Er gibt Anweisungen wegen der Erbschaft Francesco Buonarrotis, ältesten Bruders seines Vaters, der, kinderlos wie es scheint, in seinem 75. Jahre gestorben war. Er bittet, blaue Farbe für ihn zu kaufen, Mitte August werde er das Geld dafür schicken. Schließlich, er habe gehört, daß man dem Spanier den Eintritt in den Saal, wo der Karton stand, verweigere; es sei ihm das sehr lieb, und er bitte Buonarroti, den Herren, welche darüber zu bestimmen hätten, gelegentlich zu sagen, sie möchten es jedermann gegenüber so halten. Als Nachschrift, den einliegenden Brief möge er Granaccio zukommen lassen, er sei von Wichtigkeit.
Datiert ist der Brief vom letzten Juli. Aus dem Auftrage, Farbe zu kaufen, könnte man schließen, Michelangelo habe mit der Malerei bereits den Anfang gemacht. Allein es handelte sich wohl nur um die Vorbereitungen, und der Brief an Granaccio enthielt wahrscheinlich die Einladung, zu kommen und zu helfen. Auffallend ist, daß der Karton so streng verschlossen wurde, daß die Empfehlung des Meisters selber keinen Nachlaß bewirkte. Zu jener Zeit also können die jungen Florentiner Künstler noch nicht davor gesessen und gezeichnet haben.
Ein anderer Brief ist vom August. Wieder Geschäftsangelegenheiten. Man sieht, wie Michelangelo von seiner Familie um das Geringste befragt wird, und wie er den Florentiner Haushalt von Rom aus dirigiert. Ein Feldarbeiter hatte diesmal seine Pflicht nicht getan, Michelangelo droht, selbst zu kommen und nachzusehen. Er fragt, ob Pierbasso endlich angelangt sei. Diese Briefe gewähren immer nur plötzliche Einblicke in eine Wirtschaft, die man doch nicht verstehen lernt, ihr Wert liegt am meisten darin, daß sie die Stellung zeigen, die Michelangelo zum Vater und zu den Brüdern einnimmt, und das Gefühl, aus dem er handelt. Die Datierung und Zusammengehörigkeit dieser Briefe ergibt sich aus der Stimmung, von der sie erfüllt sind. Die tief in Michelangelos Seele liegende Trauer, die er meistens versteckte oder milderte, bricht hier einmal durch und zeigt den Mann in der Zeit, wo er am Größten arbeitete was die moderne Malerei geschaffen hat, in einem Zustande, der unser Mitleid fordert.
In einem dieser Briefe, der kein anderes Datum als die aufgeschriebene Bemerkung trägt, daß er am 17. Oktober in Florenz angekommen sei, wird der jüngere Bruder Gismondo erwähnt, mit dem Michelangelo von Anfang an in keinem guten Verhältnisse gestanden zu haben scheint. Er vernehme, schreibt er, daß Gismondo nach Rom kommen wolle. Buonarroto möge ihm in seinem Namen sagen, daß er sich bei dieser Reise in keiner Art auf ihn verlassen dürfe. Nicht daß er ihn nicht als seinen Bruder liebe, sondern weil er ihn in der Tat mit nichts unterstützen könne. Er sei gezwungen, jetzt einzig und allein auf seine eigene Person Rücksicht zu nehmen, kaum daß er für sich selbst seine Bedürfnisse zu schaffen imstande sei. Mit Sorgen und körperlicher Arbeit überlastet, habe er keinen Freund in Rom, brauche auch keinen, finde kaum Zeit, sein bißchen Essen zu sich zu nehmen, und deshalb solle man ihm nicht noch mehr aufbürden. Kein Lot schwerer vermöge er zu tragen, als ihm jetzt schon auf dem Rücken liege. Er muß, nur um für die Seinigen zu sparen, das erbärmlichste Leben geführt haben.
In dieselbe Zeit scheint der Brief zu gehören, worin Michelangelo auch seinem Bruder Giovansimone den Kopf zurechtsetzt. »Giovansimone«, schreibt er, »man pflegt zu sagen, ein guter Mensch werde besser, wenn man ihn gut behandle, ein schlechter aber noch viel schlechter dadurch. Wieviel Jahre nun schon habe ich in allem Gutem vergebens versucht, dich mit deinem Vater und uns andern im Guten zu halten. Für dich aber ist das nur ein Anlaß gewesen, es immer ärger zu treiben. Ich will nicht geradezu behaupten, daß du schlecht seiest, aber du lebst so, daß du mir und den andern ein fortwährender Anstoß bist. Ich will dir keine lange Rede darüber halten: es würden doch immer nur Worte sein, deren ich schon genug verschwendet habe: Folgendes aber will ich dir als die dürre Wahrheit hiermit aussprechen. Auch nicht das Geringste hast du in Händen, was dir gehörte! Alles, was du gekostet hast und daß du wieder nach Hause kommen konntest, verdankst du mir allein! Ich schenke es dir, und du hast überhaupt bis heute von dem gelebt, was ich dir geschenkt habe, um Gottes willen und weil ich dich als meinen Bruder liebte wie die andern. Jetzt aber sehe ich dich nicht mehr als meinen Bruder an. Denn wenn du wirklich mein Bruder wärest, würdest du meinem Vater nicht gedroht haben, wie du getan hast. Du bist ein Tier, – anzi sei una bestia – und als ein Tier sollst du von mir behandelt werden. Du weißt wohl, daß, wenn man die Hand gegen seinen Vater erhebt, es auf Leben und Tod geht. Damit laß dir genug sein.« (Ein Tier hat keine Seele nämlich und verfällt deshalb, italienischer Anschauung zufolge, ewiger Vernichtung.)
»Das also weißt du, daß du nicht einen Pfennig hast, der dir selber gehörte. Kommt mir noch ein Wort zu Ohren über dich, so setze ich mich auf und erscheine selbst in Florenz und will dir die Sache noch klarer machen. Ich will dich dann lehren, dein Hab und Gut verschleudern und Feuer im Hause anlegen und in den Gütern, von denen du auch nicht eine Scholle selber erworben hast. Meinst du, auf deinem Grund und Boden zu stehen? Laß mich nur kommen, du sollst mitten aus deinem Übermute heraus wie ein Kind wieder heulen lernen.«
»Zugleich aber wiederhole ich dir: wenn du mir versprechen willst, ein anderes Leben zu beginnen und deinen Vater ehrfurchtsvoll zu behandeln, so werde ich dir ferner beistehen wie den andern und werde dir sobald als möglich ein Geschäft zu gründen suchen. Willst du das aber nicht, so komme ich und bringe die Sachen selber in Ordnung, und du wirst dann merken, was du hast und was du bist, anders als du es bisher gewußt hast, und meine Sorge soll dann auch sein, für die Zukunft dir aufzupassen. Genug. Wozu so viel Worte, die Erfahrung wird dir gründlicher zeigen, was ich im Sinne habe.
Michelangelo in Rom.«
»Nur das noch sollst du jetzt hören. Zwölf Jahre sind es nun, daß ich im Elend durch ganz Italien von einem Orte zum andern gehe, jede Mißhandlung erduldet, jeder Entbehrung mich unterzogen habe, mit abgemarterten Gliedern und tausendmal in Lebensgefahr: und alles nur für die Meinigen. Und nun endlich, wo es mir gelingt, euch ein wenig in die Höhe zu bringen, möchtest du allein in einer Stunde wieder zunichte machen, was mich aufzurichten so viele Jahre und soviel Anstrengungen gekostet hat. Aber beim Leichnam Christi, das soll nicht sein! Es sollten zehntausend kommen, wie du bist, ich wollte mit ihnen schon fertig werden, wenn es sein müßte. Und nun sei vernünftig und rühre mich nicht an, der ich stärkere Arme und Schultern für die Lasten des Daseins habe.«
Wem das zu hart erscheinen möchte, der lese in andern Briefen, auf welche Weise Michelangelo den Seinigen in der Tat zu Hilfe kam, die all ihre Bedrängnis ihm zutrugen als demjenigen, der gleichsam verpflichtet sei, ihnen beizuspringen. Giovansimone hatte in leichtsinniger Weise gewirtschaftet, und es galt, ihn und die andern Brüder und den Vater aus ihrer traurigen Lage zu ziehen. Wir haben auch den Brief, worin Michelangelo seinen Vater über Giovansimone zu trösten sucht, wie wir denn überhaupt jetzt, wo so umfangreiche Korrespondenzen vorliegen, in all diese Verhältnisse tief hineingehen. Ich teile diesen Brief nicht mit, da er nichts enthält, was Michelangelo in neuem Lichte zeigte. Dagegen möge das Folgende hier noch Platz finden.
»Ich habe«, schreibt Michelangelo, »Giovanni Balducci 350 schwere Dukaten in Gold gegeben, damit sie euch ausgezahlt werden. Geht mit diesem meinem Briefe zu Bonifacio, und wenn ihr von ihm die Summe empfangen habt, bringt sie zum Spitalmeister und laßt sie eintragen wie mein anderes Geld. Es bleiben dabei noch einige überzählige Dukaten für euch übrig, von denen ich schrieb, ihr solltet sie nehmen, habt ihr es unterlassen, so tut es nun, und braucht ihr mehr, so nehmt was ihr nötig habt, denn was ihr braucht, das schenke ich euch, und wenn es soviel wäre, als ich überhaupt habe. Und ist es nötig, daß ich dem Spitalmeister darüber schreibe, so laßt es mich wissen.«
»Aus eurem letzten Briefe ersehe ich, wie die Dinge stehen. Es tut mir leid genug, aber ich kann euch in andrer Weise nicht zu Hilfe kommen. Doch verliert den Mut nicht, und es darf auch nicht eine Spur innerlicher Betrübnis deshalb in euch aufkommen, denn wenn man auch Hab und Gut verloren hat, so ist darum noch nicht das Leben verloren, und ich werde mehr für euch schaffen, als alles das wert ist, was ihr verlieren sollt. Aber verlaßt euch nicht darauf. es ist immer doch eine unbestimmte Sache. Wendet vielmehr alle mögliche Vorsicht an, und dankt Gott, daß, da einmal diese Strafe des Himmels kommen sollte, sie jetzt zu einer Zeit kommt, wo ihr euch besser herausreißen könnt, als ihr vielleicht früher imstande gewesen wäret. Sorgt für eure Gesundheit, und laßt lieber allen Besitz fahren, ehe ihr euch Entbehrungen auferlegt. Denn mir ist mehr daran gelegen, daß ihr, wenn auch als arme Leute, am Leben bleibt, als daß ihr um alles Geld in der Welt zugrunde ginget. Und wenn die Leute schwatzen und zischeln, so laßt sie reden, es sind Leute ohne Gewissen und ohne Liebe im Herzen.
Euer Michelangelo.
Was dies Geschwätz anlangt, so hatte es damit in Florenz etwas auf sich. Nirgends waren soviel böse Zungen in Bewegung. Es wird erzählt, wie auf den Bänken an den Häusern die alten Männer saßen, die sich von den Geschäften zurückgezogen hatten, und über die Vorkommnisse des Tages ihre scharfen Bemerkungen machten. Denn was heute durch jedem die Zeitungen still ins Haus getragen wird, das mußte man sich damals aus mündlichem Verkehr zusammensuchen, und es konnte vieles nicht verheimlicht werden, was heute, weil es ungedruckt bleibt, nicht unter die Leute kommt.
So erklärt sich auch das Postskriptum des Briefes: »Wenn ihr das Geld zum Spitalmeister tragt, so nehmt Buonarroto mit, und keiner von euch beiden sage einer Menschenseele davon, aus guten Gründen. Das will sagen, weder ihr noch Buonarroto sollt irgend jemand wissen lassen, daß ich Geld geschickt habe, weder in bezug auf das jetzt gesandte noch auf das frühere.« Mit sehr unleserlicher Schrift, von der ich das letzte so gut wie erraten mußte, ist auf dem Briefe bemerkt: »Ich soll mir soviel Geld nehmen als ich brauche, und soviel als ich nähme, schenkte er mir.« Wohl die Handschrift des Vaters.
Unter solchen Gedanken bei der Arbeit kam Michelangelo vorwärts. Dazu die quälende Ungeduld des Papstes. Als wolle er durch die Hast, mit der er seine Unternehmungen betrieb, den geringen Jahren, die er noch zu leben hatte, doppelten Inhalt geben, verlangte er, daß die Körner, die eben erst gesäet waren, vor seinen Augen aus dem Boden wüchsen. Beim Bauen verwöhnte ihn Bramante, der das Unmögliche leistete. Nachts ließ dieser die Steine des Mauerwerks derart vorbereiten, daß, wenn sie tags zusammengesetzt wurden, die Wände zusehends sich erhoben, weil Fuge in Fuge paßte. Michelangelo verschmähte alle Kunststücke. Er malte rasch, aber ohne Beihilfe. Der Papst kam zu ihm aufs Gerüst, auf Leitern hinaufsteigend, daß Michelangelo ihm die Hand reichen mußte, damit er die letzte Höhe erkletterte, und reizte ihn durch Fragen, ob er bald fertig wäre. Vom Frühling 1509 bis zum Herbste desselben Jahres war die Hälfte der ganzen Arbeit vollendet worden. Die Ungeduld Giulios kannte keine Grenzen mehr. Die Gerüste sollten herunter, um wenigstens diesen Anfang den Römern zeigen zu können. Mitten in der Verwirrung und im Staube, der die Kapelle erfüllte, stand der Papst da und bewunderte die Malerei. Ganz Rom strömte herbei, um das Wunderwerk anzustaunen.
II
Will man einen Begriff von der Kunst Giottos und seiner Schüler haben, Architektur und Malerei in eins genommen, so muß man das Camposanto von Pisa betreten; verlangt man dagegen ein Meisterstück der darauf folgenden Kunstperiode, der weitgestreckten Entwickelung, die zwischen Masaccio und Michelangelo liegt, so gewährt das die Sixtinische Kapelle. Die besten Künstler haben in ihr gearbeitet, von den älteren nenne ich Botticelli, Signorelli, Ghirlandaio, Perugino: lauter große, umfangreiche Kompositionen, denen man aber doch den ersten Ursprung, das Kleine, Miniaturhafte in den Gedanken anmerkt. Erst Perugino lenkt zum Größeren hin. Seine Übermacht über die anderen wird hier, wo die Vergleichung sich so einfach und schlagend darbietet, denn die Gemälde bildeten, eins ans andere stoßend, einen unter den Fenstern herlaufenden breiten Gürtel an allen vier Wänden, in auffallender Weise erkennbar: seine Einfachheit, seine Symmetrie, seine in wohlbedachter Weise abgetrennten Figuren, während bei den anderen die einzelnen Gestalten innerhalb der Massen kaum zur Geltung kommen.
Michelangelos Deckengemälde bezeichnen den Anbruch neuer Anschauungen. Der Karton der badenden Soldaten mag das Beste sein, was er je geschaffen hat, wir wollen das Benvenuto Cellini glauben, der es so frank behauptet, seine Gemälde in der Sixtina jedoch haben am meisten gewirkt, sie sind der Beginn der späteren Malerei. Was er, was Raffael und Leonardo vorher taten, ist immer noch der florentinischen Manier entsprossen, erhaben darüber, aber dennoch den Grund und Boden nicht verleugnend, auf dem es gewachsen ist, hier aber geschah eine neue Tat, vielleicht die größte, die ein Künstler gewagt hat. Die Phantasie, die hier wartete, war ebenso ergiebig als die Kunst, die ihren Ideen nachkam. Michelangelo hatte kein Muster vor sich, an das er sich hätte anlehnen können, er erfand seine Methode und erschöpfte sie zugleich. Niemand von späteren Meistern kommt dagegen auf, keiner von den früheren versuchte Ähnliches. Dafür wurde sein Werk aber auch mit Aufbietung von Kräften geschaffen, die in dieser Vereinigung keinem Künstler zu Gebote standen, so lange wir von Kunst wissen, und die in erstaunlicher Weise angespannt worden sind.
Man hatte bisher gewölbte Decken, die ausgemalt werden sollten, in verschiedene Felder zerlegt und diese einzeln mit Darstellungen ausgefüllt. Michelangelo erfand ein neues Prinzip. Er ignorierte gleichsam die Wölbung, richtete die Malerei so ein, als wäre der Raum oben offen und ohne Dach, baute eine neue Architektur in die freie Luft hinein, alles durch perspektivische Täuschung, und verband die imaginären Marmormauern, die er ringsum mit einem prachtvollen Gesimse versehen hatte, durch luftiges, durchbrochenes Bogenwerk, das sich von einer Marmorbrüstung zur andern hinüberspannte.
Der freie Raum zwischen diesen Bögen war mit Gemälden ausgefüllt, auch diese teilweise perspektivisch gehalten, als geschähen die Dinge hoch im Himmel, zu dem man zwischenhindurch aufblickte, oder als wären sie auf ausgespannten Teppichen sichtbar, die da ihren Platz gefunden. Unmöglich wäre es, in einer Beschreibung die Figuren alle an der richtigen Stelle zu nennen, die allein zur Ausschmückung des architektonischen Teiles der Malerei dienten: die Bronzemedaillons, die in den Marmor eingelassen erscheinen, die gewaltigen Sklavengestalten, welche, die Blättergirlanden tragend, neben den Bogenspannungen auf dem Rande des Gesimses sitzen, die karyatidenartigen Figuren, die den Rand des Gesimses zu stützen scheinen, die bildlichen Darstellungen endlich, welche zwischen den Fenstern und um sie her die Wände bedecken. Denn kein Fleck auf der ganzen ungemeinen Fläche, der unbenutzt geblieben wäre. Ein Reichtum bietet sich, den nur oberflächlich zu bewältigen viele Tage des aufmerksamsten Studiums nötig sind. Heute ist die Decke der Sixtinischen Kapelle teils durch den aufsteigenden Rauch und Staub in der Klarheit ihrer Farben beeinträchtigt, teils durch die Länge der Zeit ausgeblaßt. In der Wölbung des Daches haben sich Risse gebildet, und es ist Wasser durchgesickert. Über drei und ein halbes Jahrhundert stehen die Malereien da, es ist nicht möglich, der langsamen Verderbnis, der sie anheimfallen müssen, etwas entgegenzusetzen. Dennoch ist ihnen noch ein glückliches Schicksal zuteil geworden, da sie Menschenhänden durchaus unzugänglich bleiben; man hätte nach ihnen schießen oder von oben her das Dach durchbrechen müssen, um sie absichtlich zu beschädigen. Wie jammervoll sind dagegen die Malereien Raffaels in den Zimmern des Vatikans zugerichtet, nicht nur durch die, welche sie zerstießen, zerkratzten und durch Betasten schmutzig machten, sondern auch durch die Mühe derjenigen, welche ihre Wiederherstellung unternahmen.
In dem ersten der großen Gemälde, welche die Mitte der Decke in der Sixtinischen Kapelle einnehmen, sehen wir Gott Vater, wie er über dem Wasser schwebend Licht und Finsternis auseinanderreißt. Im zweiten, wie er die beiden höchsten Lichter des Himmels, Mond und Sonne schafft. Es bleibt dieselbe Gestalt. Hier im zweiten Gemälde aber ist die still in sich schwebende Person des höchsten Wesens, wie wir sie im ersten erblicken, von einem ungeheuren Sturmwind ergriffen und so durch den unendlichen Raum getrieben dargestellt. Der weiße Bart wehend, die Arme befehlend ausgestreckt und ein Drang nach Vorwärts in dem Ganzen, als wenn ein furchtbares Gestirn, gegen das die Sonne nur ein Staubkorn wäre, donnernd dahinsauste, und alle die niederen Welten wie leichte Funken aus seinen uranfänglichen Flammen absprühten. Und zwar erblicken wir die Gestalt Gottes doppelt auf diesem zweiten Gemälde, indem wir ihr einmal entgegen, das andere Mal ihr in den Rücken sehen. Gleichsam als drückte die erste das Herannahen, die zweite das Davoneilen aus. Beide Figuren sind in der Verkürzung gezeichnet.
Im dritten Bilde schwebt Gott über den Wassern. Immer die eine Gestalt, immer ein anderer Ausdruck des verschiedenen Willens, der sie erfüllt. Hier, als müßte er inmitten der gärenden Kräfte, aus deren Ineinandergreifen sich die Welt zusammengefügt, ein wilderes Ansehen haben, als er mit dem Verkehr mit den Menschen annimmt, wenn er ihnen sichtbar wird. So erscheint er auf dem vierten Bilde in dem Momente, wo er dem ersten Menschen das Leben verleiht.
Adam liegt auf einem dunkeln Berggipfel. Seine Gestaltung ist vollendet. Nichts bleibt mehr übrig, als daß er sich erhebe und zum ersten Male empfinde, was Erwachen und Leben sei. Es ist, als durchzuckte ihn die erste Regung des neuen Zustandes, als ahnte er, fast noch in Träumen liegend, was mit ihm vorgeht. Gott schwebt aus der Höhe herab ihm entgegen in langsamer Bewegung, wie eine Abendwolke langsam sanft herankommt. Engelsgestalten umringen ihn von allen Seiten, dicht an ihn gedrängt, als trügen sie ihn, und sein Mantel, wie von einem vollen Windstoße aufgebauscht, bildet ein fliegendes Zelt um sie alle her. Diese Engel sind Kinder von Ansehen, mit lieblichen Gesichtern, die einen unterstützen ihn von unten, die andern blicken ihm über die Schultern. Wunderbarer noch als der Mantel aber, der sie alle umschließt, ist das Gewand, das Gottes eigene Gestalt bedeckt, ein violettgraues, durchsichtiges, wie aus Nebeln zusammengewebtes Kleid, das den gewaltig schönen Leib mit geringem Faltenwurfe dichtanliegend umgibt, ihn ganz verhüllt, bis über die Knie herab und dennoch jede Muskel durchscheinen läßt. Ich habe nie das Bildnis eines menschlichen Körpers gesehen, das diese Schönheit erreichte. Cornelius sagte mit Recht, daß seit Phidias dergleichen nicht gebildet worden sei, und von dessen Werken wissen wir doch nur vom Hörensagen. Der Kopf aber im weißen vollen Haare des Hauptes und Bartes drückt so völlig die Hoheit aus, deren Abbild er sein soll, daß es mich hier zum ersten Male nicht befremdet hat, den höchsten Geist, der, wie gesagt wird, die Menschen nach seinem Bilde schuf, in menschliche Form herabgezogen zu sehen. Allmächtige Kraft, vereint mit mildem Erbarmen, leuchtet aus seinem Wesen. So streckt er die rechte Hand weit aus, dem liegenden Menschen entgegen, der die Linke erhebt, willenlos und im Schlafe scheint es, und an der äußersten Spitze seines Zeigefingers vom Finger Gottes beinahe berührt wird.
Diese sich entgegenströmende Bewegung enthält eine Fülle von Gedanken, deren jeder im Moment erschöpfend scheint, bald aber von einem anderen verdrängt wird. Alles echt Symbolische hat etwas Unnahbares an sich, und diese Begegnung Gottes und des Menschen ist im reinsten Sinne symbolisch. Gott befiehlt und Adam gehorcht. Er winkt ihm aufzustehen, und Adam greift nach seiner Hand, um sich emporziehen zu lassen. Gott läßt wie durch eine elektrische Berührung einen Funken seines Geistes in den Körper Adams lebenverleihend einspringen. Adam hat willenlos dagelegen; der Geist regt sich in ihm, er wendet sein Haupt auf und zum Schöpfer hin, wie eine Blume sich der Sonne zuwendet, von jener wunderbaren Macht getrieben, die weder Wille noch Gehorsam ist. Er macht mit dem ganzen Oberkörper den Versuch, sich aufzurichten, er stützt sich, während er die Linke ausstreckt, auf den rechten Arm, auf dem er ruhend lag; das rechte Bein ist lang ausgestreckt, das linke hat er, um sich vom Boden loszulösen, dicht angezogen, so daß das Knie aufrecht emporsteht: Alles die natürliche erste Bewegung eines Menschen, der sich erheben will. Da gibt ihm Gott die Hand; man denkt, sie würde, ohne daß die Finger ihn erfaßten, ihn dennoch wie ein Magnet ergreifen, sanft wieder zurückschwebend würde er ihn nach sich ziehen, bis die Gestalt aufrecht auf ihren Füßen stände.
Condivi sagt sehr kindlich, die ausgestreckte Hand Gottes bedeute, daß Gott Adam gute Lehren darüber gebe, was er tun und lassen solle. Es ist nichts einzuwenden dagegen; die einfachsten Erklärungen haben großen Kunstwerken gegenüber dieselbe Berechtigung wie das Verständnis, das am tiefsten zu greifen glaubt und im Vergleich zu den Gedanken des Künstlers selber doch nicht tiefer dringt als die Bergwerke in das Herz der Erde, deren äußerste Schale sie kaum durchbohren.
Im nächsten Gemälde die Erschaffung Evas. Adam liegt in Schlaf versunken auf seiner rechten Seite und dem Betrachtenden völlig zugekehrt. Der eine Arm fällt ihm schlaff über die Brust herüber und knickt mit dem Rücken die Finger auf dem Boden auf. Der Oberkörper wird durch den Felsen, an dem schlafend er anlehnt, etwas emporgehoben, und der Kopf eben dadurch zur linken Schulter aufgedrängt.
Zu seinen Füßen steht Gott Vater. Je mehr er sich den Menschen nähert, um so menschlicher erscheint er. Er schwebt nicht mehr, er steht auf dem Boden der Erde und wandelt; sein langer, hellgrau violetter Mantel fällt in großen Falten auf seine Füße; wohlwollend ist das Haupt gelinde vorgesenkt und die Rechte erhoben, denn ihm entgegengewandt steht Eva, der er im Momente das Leben verliehen hat. Sie steht hinter Adam, ganz im Profil erblickt man sie; ihre Füße sind durch Adams liegende Gestalt verhüllt, man könnte denken, sie träte aus seiner Seite heraus, wie es ältere Meister geradezu dargestellt haben. Man fühlt sich versucht zu sagen, sie sei das schönste Bild einer Frau, das von der Kunst geschaffen wurde. Den Oberkörper leise vorgebeugt, die beiden Arme mit betend vereinten Händen aufgehoben, das linke Bein ein wenig vortretend, weil sie sich verneigt, das rechte rückwärts mit eingeknicktem Knie gegen den Felsen tretend, das lange blonde Haar über den wundervollen Rücken rollend und vorn über die Brust herab zwischen den beiden Armen hinunter – blickt sie geradeaus, und man fühlt, daß sie zum ersten Male atmet, aber als habe das Leben sie noch nicht ganz durchflossen, als sei die anbetende, Gott zugewandte Stellung nicht nur die erste träumerische Bewegung, sondern als hätte sie der Schöpfer selbst in dieser Stellung geformt und wachgerufen.
Noch einmal erscheint sie so groß und schön auf dem nächsten Bilde. Der Baum mit der Schlange teilt dasselbe in zwei Hälften. Links ist die Verführung, rechts die Vertreibung aus dem Paradiese gemalt. Ein doppelter Anblick derselben Gestalten. Ein feister, gelblich schimmernder Schlangenbalg wickelt sich um den Stamm des Baumes und wird oben zu einem Weibe, das sich aus den Ästen herniederbeugt. Mit der rechten Hand hält es sich rückwärtsgreifend fest, in der anderen tiefherabreichend den Apfel, den Eva, die Finger der geöffneten Hand verlangend emporgerichtet, auffangen will, fast als winkte sie damit der Begierde. Sie sitzt unter dem Baume, als hätte sie gekniet und wäre so auf die Seite gesunken. Die Richtung ihrer Knie aber ist dem Baume abgewandt, sie muß sich umdrehen zur Schlange, und so wendet sie den wundervollen Kopf mit aufgestecktem Haar auf dem prächtigen Halse zur Schlange hin und hebt die Arme zu ihr auf, der Frucht entgegen. Adam steht neben ihr. Auch er beugt sich zum Baume; dicht über sie hinüber hat er einen Ast gepackt und hält ihn herabgezogen fest; mit der anderen Hand greift er über dem Kopfe der sich zu Eva beugenden Schlange in das Laub des Baumes, den Zeigefinger vorwärtsgekrümmt, als wenn er etwas pflücken wollte. Der Sinn der Bewegung scheint der, daß während Adam noch im Zweifel dasteht, ob er zugreifen solle oder nicht, Eva die Tat bereits vollbracht hat. Evas ganzes Aussehen ist verschieden von dem, das sie auf dem früheren Bilde hatte. Festere Formen hier; schlanker, ausgewachsener, frauenhafter erscheint sie; nichts mehr von dem ehrfurchtsvollen zitternden Wesen, sondern sichere Gedanken und feste Sehnsucht.
Welche Vernichtung aber in der Szene dicht daneben! Der Engel hat den Arm mit dem Schwerte lang über ihnen ausgestreckt, daß Arm und Schwert eine horizontale Linie bilden. So treibt er sie beide vor sich her, die dort stolz blühend und königlich, hier mit eingezogenen Knien und gesenktem Haupte schleichenden Schrittes forteilen. Adam mit beiden Armen und Händen eine bittend abwehrende Bewegung gegen den Engel versuchend, Eva aber, noch tiefer als er das Haupt gebeugt und den schönen Rücken emporgekrümmt wie ein geschlagenes Tier; verzweiflungsvoll kreuzt sie die Arme vor dem Busen und greift mit der Faust in die goldenen Haare. Dennoch aber sieht sie sich nach dem Engel um. Adam wagt es nicht, er kann den Anblick der strafenden Gerechtigkeit und des verlorenen Paradieses nicht ertragen, er schreitet dumpf vorwärts, die Augen auf seinen Weg geheftet; sie aber blickt von der Seite zurück und zum Engel auf: durchblitzt ihre Verzweiflung auch hier noch ein Schimmer von Neugier? Mit starken Schritten schreiten sie so dahin, und der Jammer lastet auf ihren Schultern, aber es sind doch mehr vertriebene Titanen als unglückliche Menschen, und Evas von Trauer verhüllte Schönheit leuchtet um so gewaltiger.
Auf dem nächsten Gemälde Abels und Kains verschiedene Opfer, auf dem darauf folgenden die Sündflut. Jenes hat nichts besonders Hervorstechendes in sich, dieses verliert durch einen anderen Umstand von seiner Wirkung: es ist dasjenige, mit dem Michelangelo begann. Es fehlte ihm noch die Erfahrung für das Maß der Gestalten im Verhältnis zu der Tiefe, aus der sie später betrachtet wurden. Deshalb zeichnete er sie in weniger kolossalen Verhältnissen, wir finden eine Menge Figuren, welche neben denen der anderen Gemälde winzig erscheinen. In der Mitte des Gewässers sieht man die Arche ihrer Breite nach und Menschen, die sich an sie anklammern. Im Vordergrunde ein Schiff, das, mit Unglücklichen überladen, Wasser geschöpft hat und zugrunde geht. Ganz vorn den Gipfel eines Berges, wie eine Insel aus den Wellen aufragend. Flüchtlinge klettern an ihm empor; einige haben ein Tuch über einen Baum geworfen, um ein Zelt zu bilden, das ihnen Schutz gegen Sturm und Regen gewährt. Das letzte Bild stellt die Trunkenheit Noahs dar. Ich rede von allen dreien weniger ausführlich, weil sie im Vergleich zu den anderen zurücktreten. Mehr aber um ihres Inhaltes willen, als weil sich mindere Kraft in ihnen offenbarte. Neben jenen ersten hält nichts den Vergleich aus, und da es nicht darauf ankommt, ein Verzeichnis dessen zu geben, was Michelangelo gemalt hat, sondern nur das genau beschrieben werden soll, was als eine sichtbare Stufe zu erhöhter Vollkommenheit erkenntlich ist, so wird auch aus dem Reichtum des Übrigen nur das Größte hervorgehoben werden.
III
Es war gesagt, daß die Zwickel des Gewölbes immer zwischen den Fenstern hinab in die Seitenwände verliefen. An den breiten Wänden sind es deren je fünf, an den schmaleren ist es nur einer, der gerade in der Mitte liegt. Auf diese zwölf Gewölbespitzen hat Michelangelo zwölf ungeheure Gestalten gemalt, die, mit den Häuptern bis empor ans Gesims der von ihm erfundenen Architektur reichend, perspektivisch so gezeichnet sind, als säßen sie rings im Innern des großen Marmortempels droben und bedächten den Inhalt der Gemälde, die über ihnen in der Mitte der Decke liegen.
In den Märchen von den ältesten Zeiten der Erde erscheinen die Menschen schöner, riesenhafter und von einfacheren gewaltigeren Leidenschaften erfüllt als heute. Nur wenige waren es, die, über den unberührten Boden der Länder wandelnd, damals wie einsame Löwen dahingingen. Griechenland ist wie ein einziger Frühlingswald, aus dem der Olymp und die anderen Berge aufragen, von denen zu den Wellen eines sonnigen Meeres hinabrauschende Flüsse eilen; Asien ein ungeheurer Weidegrund für die Herden Abrahams oder der Schauplatz der Kämpfe vor Ilion, von deren Gedröhn die ganze Erde zitterte, daß Menschen und Götter ringsum heraneilen, um den Ausgang des Streites zu erwarten.
In den Sagen der Völker gibt es eine Epoche, wo das Menschliche und Göttliche sich vermählend eine solche riesenhafte Titanengeneration erschafft, die der unsrigen weit vorangehend, seit Jahrtausenden in tiefen Höhlen sitzt, um eines Tages neu heraufzusteigen.
Es ist, als hätte Michelangelo diese Schöpfung im Geiste gesehen, als er seine Sibyllen und Propheten malte. Lesend, sinnend oder zur Begeisterung entzückt, sitzen sie auf ihren Plätzen, als erfüllten sie Gedanken, über denen sich Jahrtausende brüten ließe. Man könnte denken, vor langen Zeiten seien diese Männer und Frauen hinabgestiegen in die verborgenen Klüfte der Erde, und in Nachdenken versinkend fänden sie, wenn sie einst erwachend neu emporsteigen werden, die Erde dann wieder rein und unberührt und ahnten gar nichts von dem, was innerhalb der zehn- oder zwanzigtausend Jahre, die sie verträumten, an menschlicher Geschichte da oben vorgegangen sei.
Ich beschreibe diese Gestalten nicht, deren ganze Reihe in Worten auszudrücken wohl möglich wäre, dennoch, wenn es richtig geschehen sollte, ein Stück Arbeit, dem ich mich kaum gewachsen fühle. Denn es erforderte nicht bloß eine deutliche Aufzählung dessen, was man von äußeren Attributen und von der Bewegung des Körpers an ihnen bemerkt, sondern eine Geschichte ihrer Darstellung in der italienischen Kunst und eine Vergleichung ihres Charakters, wie ihn die alten Schriften zeigen, mit Michelangelos Auffassung. Er kannte die Bibel und las sie immer wieder, er fand außerdem eine kirchliche Tradition vor über die Persönlichkeiten der Sibyllen und Propheten. Es bedürfte genauerer Studien, als ich sie gemacht habe, um hier zu erkennen, was ihm gegeben ward und was er aus sich selbst nahm.
Alle zwölf Gestalten zusammen scheinen die Vertiefung des menschlichen Geistes in die biblischen Geheimnisse auszudrücken, und zwar vom träumenden Ahnen der Dinge an, durch alle Stufen des bewußten Denkens hindurch bis zum Schauen der Wahrheit selber im Rausche der höchsten Entzückung. Die Idee, die Stufen irdischer Erkenntnis in verschiedenen Personen anwachsend gleichsam darzustellen, war keine ungewöhnliche. Reizend ist die Art, wie man die Tätigkeit der erhabensten Schriftstellerei in den vier Evangelisten darstellte. Das Kreuzgewölbe einer Kapelle teilt sich in vier zusammenstoßende Dreiecke. In der Mitte malte man das Symbol der Dreieinigkeit, in jedes der Dreiecke einen Evangelisten. Den einen, wie er einem Engel lauscht, dessen Worte ihm der Aufzeichnung wert erscheinen, den zweiten, wie er die Hand erhebt, um die Feder einzutauchen, den dritten, wie er sie eintaucht, den vierten endlich, wie er die Hand mit der Feder aufs Blatt gelegt und zu schreiben begonnen hat.
Hier aber, wo es sich um viel Höheres handelte, genügten zwölf Figuren kaum. Wir sehen den Propheten Jeremias, die Füße unter sich gekreuzt, vorgebeugt, den Ellenbogen des linken Armes auf den Schenkel aufsetzend und die Hand über dem Munde in den gewaltigen Bart des sich aufstützenden Hauptes vergraben, das Bild des tiefsten ruhigen Nachdenkens. Wir sehen im folgenden Zwickel des Gewölbes die persische Sibylle, eine alte, in Gewänder verhüllte Frau, die mit beiden Händen das Buch, in dem sie liest, dicht vor die Augen hinaufhält. Dann Ezechiel, mit heftig vorgeneigtem Oberkörper, die rechte Hand beweisend vorgestreckt, in der linken ein entrolltes Pergament haltend; es ist, als sähe man die Gedanken sich in seinem Geiste durcheinanderwälzen. Dann wieder ein Bild, wie die bloße Aufmerksamkeit unmerklich zur Begeisterung schwillt: die erythreische Sibylle, eine wundervolle jugendliche Frauengestalt.
Sie sitzt, im Profil gesehen, nach rechts gewandt; das eine Bein mit schwebendem, unbekleidetem Fuße ist über das andere gelegt, und in die schöngestreckten Falten des Gewandes, die durch diese Stellung um sie her gezogen werden, taucht die Hand des nackten, herabsinkenden rechten Armes ein, als ruhte sie darin. Vorgebeugt blättert sie mit der Rechten in einem Buche, das auf einem Pulte vor ihr liegt. Eine in Ketten darüber hängende Lampe zündet ein nackter Knabe mit einer Fackel an.
Dann der Prophet Joel, mit beiden Händen breit unter seinen Augen ein Pergament entrollend und um den unbärtigen Mund das Spiel der Muskeln, die das innerlich abwägende Zurechtlegen des Gelesenen andeuten. Dann Zacharias, in sein Buch ganz vertieft, als würde er nie wieder zu lesen aufhören. Dann die delphische Sibylle, jung, schön, ganz von vorn, den begeisterten Blick emporgerichtet, während ein sanfter Windstoß ihr Haar zur Seite wirft, über das ein meergrüner Schleier hängt, und den bläulichen Mantel gleichfalls wie ein Segel zu sanfter, voller Rundung aufbläst. Prachtvoll sind die Falten des dicht unter der Brust von einem Gürtel geschlossenen Gewandes. Dann Esaias, mit leicht gerunzelter Stirn, die linke Hand mit aufgestrecktem Zeigefinger, die rechte in die Blätter eines geschlossenen Buches greifend. Dann die cumäische Sibylle, mit halbgeöffnetem Munde unbewußt aussprechend, was sie liest. Dann Daniel.
Vor ihm ein Knabe, der auf dem Rücken ein aufgeschlagenes Buch ihm unter seine Augen hält; er aber, ein schöner Jüngling, seitwärts daran vorüber in die Tiefe starrend, scheint den Worten zu lauschen, die zu ihm auftönen, und vergessend, daß er gar keine Feder in den Händen halte, macht er mit der Rechten die Bewegung des Schreibens auf einem anderen Buche, das zu seiner Rechten auf einem Pulte liegt.
Dann die libysche Sibylle, die mit rascher Bewegung des ganzen Körpers nach einem hinter ihr liegenden Buche greift, als müsse sie auf der Stelle etwas nachlesen. Endlich Jonas, der rückwärts liegend, beinahe nackt, eben dem Rachen des Fisches entschleudert worden ist, der hinter ihm sichtbar wird. Das wiedergeschenkte Licht des Tages erfüllt ihn mit blendendem Entzücken; so sehen wir ihn im Sinne der Kirche als ein irdisches Symbol der Auferstehung und der Unsterblichkeit. Überaus kunstvoll ist die Verkürzung der Gestalt, die, auf der sich uns zuneigenden Wölbung gemalt, dennoch zurückzuweichen scheint.
Unter diesem Propheten, der die Mitte über einer der schmaleren Wände der Kapelle einnimmt, malte Michelangelo dreißig Jahre später das jüngste Gericht, das die ganze Wand von oben bis unten bedeckt, das Hauptwerk seines Alters, wie die Gemälde der Decke die Tat seiner Jugend sind. Würdige Symbole beides der Lebenszeit, in der er sie geschaffen hat. Denn wie es natürlich erscheinen muß, daß er in jüngeren Jahren den weit zurückliegenden göttlichen Anfang der Dinge ergriff und gestaltete, ebenso angemessen ist es, daß er als Greis den Schluß der unendlichen Zukunft darzustellen versuchte.
IV
Von all den übrigen Gemälden wähle ich nur noch zwei aus, um sie zu beschreiben. In den vier Ecken der Kapelle bildet die Wölbung vier Dreiecke, auf denen der Tod Hamans, die Schlange in der Wüste, der Tod Goliaths und Judith und Holofernes dargestellt sind. Mit welcher Kunst weiß Michelangelo auch das eigentlich Historische, hier möchte man es im Gegensatz zu jenen erhabenen Werken fast Genre nennen, aufzufassen.
Er packt immer den entscheidenden Moment, den, der so vollgesogen von der Handlung ist, daß das vorher Geschehene und nachher zu Erwartende gerade in ihm zusammengefaßt zugleich zur Erscheinung kommt. Wenig Stoffe aber sind wohl in dem Maße geeignet, diese Kraft, die wahre Mitte einer Tat zu erfassen, offenbar werden zu lassen, als die Sage von der Judith. Dies Drama enthält eine Fülle von Situationen, durch welche die Phantasie herausgefordert wird, und in der Wahl derjenigen, die hier am einfachsten den ganzen Inhalt gibt, zeigt sich das Genie Michelangelos.
Wir sehen Holofernes auf einem Bette liegen, über das ein weißes Laken gedeckt ist. Der eine Arm ist schlaff herabgesunken und stößt mit dem Handgelenk auf den Erdboden, der andere greift über sich in die Luft, als suchte er nach dem Haupte, das nicht mehr da ist. Das eine Bein fällt, im Knie geknickt, lang über das Fußende des Bettes hin, als wäre ihm das Bette zu kurz, das andere steht mit angezogenem Knie aufwärts und der Fuß tritt auf das Lager.
Dieses sehen wir links, etwas zurück im Innern eines Zeltes, zu dem einige Stufen aufführen. Judith steigt sie eben hinab, aus dem Zelte hervortretend. Sie dreht uns den Rücken zu, weil sie, sich umwendend, nach Holofernes hinsieht, während sie nach der anderen Seite hin mit aufgehobenen Händen ein Tuch ausgebreitet hält, um es über den abgeschnittenen Kopf zu legen, den die Magd in einer großen flachen Schüssel auf dem Kopfe trägt. Die Magd hat ein goldiggelbes Kleid an, das sich in starken schweren Falten bricht, denn sie steht mit etwas gebogenen Knien, damit ihre Herrin den Kopf in der Schüssel bequemer mit dem Tuche bedecken könne. Mit beiden Armen hält sie die Schüssel über sich fest. Ein lichtblaues Tuch ist ihr über das Kleid um den Leib gewunden.
Judith trägt einen graublauen Überwurf über Brust und Schultern, auf dem die Lichter mit Gold aufgesetzt sind. Die Stellung der Magd, wie sie sich niedriger zu machen sucht, zugleich aber sich steif im Rücken hält, um die Last auf dem Kopfe nicht aus dem Gleichgewicht kommen zu lassen, das doppelte Gefühl Judiths, die, im Begriff das Tuch rasch über das abgeschnittene Haupt zu werfen und dann fortzueilen, plötzlich von dem Gedanken erschreckt wird, er könne dennoch wieder erwachen, und mit erhobenen Händen den Blick noch einmal zu ihm wendet, ist im höchsten Grade sprechend und erregend. Die gewaltige nackte Gestalt, die wie ein gestürztes Vieh daliegt, läßt den plötzlichen Schauder der Frau begreifen und mitempfinden. Ein in Schlaf versunkener Krieger im Hintergrunde deutet die Nacht an, in deren Schutze die Tat vollbracht worden ist.
Enthält dieser Moment nicht alles? Vorwärts fühlt man, was geschehen wird: die von Zittern gedämpfte Eile, mit der die Frauen durchs dunkle Lager schleichen; rückwärts die Verstellung, die Angst, den Fanatismus, der ihren schwachen Arm stählte. Und dem gegenüber die gedankenlose Stärke des Mannes, der zum Opfer ersehen war. Das ist der Kern des Gedichtes. Als üppiges verführerisches Weib ist Judith unerträglich, als zitternde Frau mit einem Willen aber, der gewaltiger als ihre Furcht wirkt, eine ergreifende wahre Persönlichkeit. So erfaßte sie Michelangelo.
Mit derselben Wahrhaftigkeit stellt er Goliath dar, über den David die Oberhand gewinnt. Wie der Koloß daliegt, lang auf dem Bauche, während David ihm die Spitze seines Knies in den Rücken hineinbohrt, gewinnt man die Überzeugung, daß die Bewegungen der gewaltigen Arme und der Beine, die sich zum Widerstand wieder emporstemmen möchten, vergeblich sein müssen. Mit der Linken packt ihm David ins Haar, mit der Rechten schwingt er ein kurzes, breites, messerartiges Schwert; man glaubt es pfeifen zu hören, wie es die Luft durchschneidet, und weiß im voraus, daß es tödlich durch den Hals hindurchfahren wird. Goliath trägt ein grünes, anliegendes, panzerartiges Gewand, Beine und Füße in derselben Weise dunkelgrau bedeckt, den Arm weiß mit goldenen Riemen; David ein lichtblaues Unterkleid und einen gelblichgrünen, mantelartigen Überwurf, auf der Schulter in einem Knoten zusammengebunden. Dieses Gemälde und das der Judith ist bei jedem Lichte hell und erkennbar, wie auch die Darstellungen des mittleren Gewölbes sämtlich, und deshalb treten diese dem Auge als der eigentliche Inhalt der Sixtinischen Malereien entgegen. Die Propheten und Sibyllen sind der Mehrzahl nach schwieriger zu sehen; das aber, was noch tiefer als sie dicht um die Fenster gemalt worden ist, wird erst nach mühsamer Betrachtung dem suchenden Auge in seinen Umrissen erkenntlich. Man muß die schmale Galerie besteigen und von hier aus noch ein gutes Glas zu Hilfe nehmen, wenn sich die ganze Größe dieser Arbeiten enthüllen soll. Freilich sieht man so nahe herantretend all die kleinen Risse und Flecke, die sich wie ein Schleier über die Malereien zu ziehen scheinen, doppelt genau, zugleich aber den Schwung der Linien reiner und die einfachen Mittel, durch welche die leichte, luftige Färbung erreicht ward, die für Deckengemälde, wenn sie aus solcher Entfernung wirken sollen, unentbehrlich ist.
Im Herbste 1509, wie schon gesagt worden ist, war die erste Hälfte des gewaltigen Werkes vollendet. Einstweilen ruhte die Arbeit. Die Gerüste wurden abgebrochen und die Kapelle für den Gottesdienst wieder eingerichtet. Zu den Sibyllen und Propheten, sowie den Vorfahren der Maria waren damals noch nicht einmal die Kartons gezeichnet.
Kurz vor Aufdeckung der Gemälde schreibt Michelangelo an Buonarroto: »Meine Malerei wird die nächste Woche fertig sein, das heißt der Teil, soweit ich sie in Angriff nahm; sobald ich sie aufgedeckt habe, hoffe ich Geld zu erhalten und werde es so einzurichten suchen, daß ich auf einen Monat Urlaub nach Florenz bekomme. Ich weiß nicht, ob etwas daraus wird; brauchen könnte ich es, denn mit meiner Gesundheit steht es nicht zum besten.«
Michelangelo hatte sich rasend angestrengt. Eines seiner Sonette beschreibt in burlesker Weise seinen Zustand, wie er Tag für Tag auf dem Rücken lag und ihm die Farbe aufs Gesicht herabtropfte. Seine Augen hatten sich so sehr daran gewöhnt, über sich zu blicken, daß er geraume Zeit hinterher Geschriebenes in die Höhe halten mußte, um es mit zurückgezogenem Kopfe zu lesen, eine Folge derartiger Arbeit, die Vasari aus eigener Erfahrung bestätigt.
Man fände unter den Briefen so gern einen, der von der Befriedigung spräche, mit der die vollendete Arbeit ihn erfüllte. Wir müssen uns an der Tatsache genügen lassen, daß diese erste Hälfte des Werkes sofort zu den vornehmsten Dingen gerechnet wurde, welche in Rom gesehen werden mußten.
Es war ein großer Tag, als Michelangelo dem römischen Volke zum erstenmale zeigte, was er auch als Maler vermöge. Unter denen aber, die dastanden und zu seinen Figuren emporblickten, war einer, der uns heute wichtiger ist als alle übrigen. Raffael, der nun vorgeschoben werden sollte, um das zu vollenden, was an den Deckengemälden zu tun noch übrig war. Die große Konkurrenz zwischen Raffael und Michelangelo nahm ihren Anfang.
Achtes Kapitel
1510 -1512
I
Wer darauf besteht, die beiden großen Künstler als zänkische Widersacher zu denken, der könnte das wenige, was uns von ihrem persönlichen Verhalten gegeneinander aufbewahrt worden ist, in diesem Sinne allenfalls zurechtlegen. Solche Folgerungen aber bleiben unrichtig in sich. Wir sehen Raffael und Michelangelo freilich zu Parteihäuptern gemacht. Raffael erscheint von Anfang an als befangen: er hatte Leute um sich, die gegen Michelangelo hetzten; und bei diesem selbst entdecken wir nichts von entgegenkommendem Wesen: er stieß ab, was ihm nicht zusagte. Seine Anhänger und die Raffaels bekämpften sich. Keine Spur aber, daß die beiden Meister die Rollen wirklich angenommen hatten, die ihnen so von den Ihrigen aufgedrängt wurden. Was man in dieser Hinsicht anders zu deuten suchte, ist falsch gedeutet, weil es gegen ein Naturgesetz verstößt, das keinen Widerspruch duldet. Vortrefflichkeit bildet zwischen denen, die sie besitzen, eine unzerstörbare Gemeinschaft. Alles Große, die niedere Waffe der Sterblichen Überragende, fühlt sich unauflöslich vereinigt, es ist zu einsam, um einander nicht um jeden Preis aufzusuchen. In der Umgebung beider Männer mögen Neid und Eifersucht in Intrigen sich Luft gemacht haben, in den hohen Regionen ihrer wahrsten Natur aber fühlte jeder zu gut, was er selbst und was der andere wert sei, und so ferne sie sich blieben äußerlich betrachtet, so nah standen sie dennoch zusammen, weil in jene Höhe nichts mehr reichte, das sie auseinanderzuhalten genug gewesen wäre.
Raffael jagte dem Ruhme Michelangelos nach, wie dieser eben erst Leonardos Größe zu überbieten getrachtet. Raffael malte in den Zimmern des Vatikans, wenige Schritte entfernt von der Kapelle, in der Michelangelos Gerüste standen. Sie müssen sich oft begegnet sein im Palaste, durch den der Weg zur Kapelle führte; wie blickten sie einander in die Augen? In Michelangelos Äußerung, die er lange nach dem Tode Raffaels getan: was Raffael in Sachen der Architektur gewußt, habe er von ihm gelernt, liegt nichts Herabsetzendes. Corneille konnte dasselbe von Racine sagen, der so viel jünger war, ohne ihn in seiner Größe zu verringern, Goethe sich so über Schiller aussprechen. Wo Leute wie Michelangelo, Corneille und Goethe vorangegangen sind, da muß alles, was jünger ist, in ihre Fußtapfen treten, auch das ist ein Naturgesetz, so sicher wirkend, als wenn es sich um chemische Verwandtschaften handelte. Viel wichtiger ist Michelangelos Wort: Raffael sei nicht durch sein Genie, sondern durch seinen Fleiß so weit gekommen, als er kam. Es erscheint als die höchste Anerkennung aus seinem Munde.
Fleiß kann hier nichts anderes bedeuten als das Glück, das ein Künstler in unermüdlicher Vervollkommnung seines Werkes sucht. Fleiß ist nicht anhaltende Tätigkeit oder Arbeitsamkeit im allgemeinen, die sich keine Ruhe gönnt, sondern Versenkung in das Eine, das vollendet werden soll, schöpferische Sehnsucht, das geistige Bild in sichtbare Formen ganz hineinzuarbeiten, Genuß am Gleichgewichte des Inhaltes mit der äußeren Erscheinung und der Drang, Kraft zu gewinnen und ihn zu befriedigen. Was gemeinhin Fleiß genannt wird, ist die emsige Sorgfalt, das Material zu bewältigen, um in einem Tage sichtbar recht weit zu kommen; verglichen mit jenem geistigen Fleiße aber, den Michelangelo Raffael zuspricht, sinkt dieser materielle Fleiß nur zu einer Voraussetzung herab, die sich von selbst versteht. Ein Künstler, wie ihn Michelangelo denkt, gibt nach der höchsten Anstrengung sein Werk dennoch als unvollendet. Er sagt, ich mußte damals stillstehen, ich konnte nicht weiter. Am gewissenhaftesten war hier wohl Leonardo, der gern keines seiner Bilder aus den Händen gegeben hätte, solange er lebte. So arbeitete auch Goethe, der bis in sein Alter jung begonnene Werke zurückhielt, weil das Gefühl niemals nachließ, wie viel noch an ihnen zu bessern sei.
Michelangelo stand allein in Rom, als er die Sixtina malte. Er hatte nur den Papst als Partei hinter sich: um Raffael und Bramante scharten sich die Künstler. Michelangelo war nicht mehr ganz jung, finster, scharf, mit unerbittlicher Strenge das Echte vom Unechten sondernd; Raffael im Beginn der Zwanzig, liebenswürdig, heiter, hilfreich und mit dem Zauber siegreicher Überlegenheit umgeben, von der Liebe erweckt wird, und die neidlos selber den Neid der anderen in Zuneigung auflöst. Dabei am Hofe nicht bloß von Bramante protegiert, sondern vom Herzoge von Urbino und dessen Damen, die als nahe Verwandte des Papstes in Rom eine glänzende Rolle spielten, begünstigt und in die höchste Geselligkeit emporgezogen.
Raffael hatte einen Vorzug, den vielleicht so lange die Welt steht kein anderer Künstler in solchem Grade besessen hat: seine Werke entsprechen dem Durchschnittsmaße des menschlichen Geistes. Sie stehen keine Linie darüber noch darunter. Michelangelos Ideale gehören einer höheren stärkeren Generation an, als hätte er Halbgötter im Geiste beherbergt, wie auch Schillers poetische Gestalten in anderer Weise oft das Maß des Gemeinmenschlichen überschreiten; Raffael aber traf das Richtige wie Shakespeare. Er scheint zu schaffen, wie die Natur schafft. Keine Wolkenpaläste, in denen man sich zu klein dünkt, sondern menschliche Wohnungen errichtet er, durch deren Türen man eingeht und fühlt, daß man da zu Hause sei. Er ist verständlich in jeder Bewegung, er schmiegt sich dem Schönheitsgefühle der Menschen an mit seinen Linien, als sei es unmöglich, sie anders zu ziehen, und das Behagen, das er so auf die Beschauenden ausgießt, die sich entzückt als seinesgleichen fühlen, gibt den Werken die Allmacht und seiner Person den Schimmer glückseliger Vollkommenheit. Obgleich er unendlich viel getan hat, möchte man nicht glauben, daß er sich jemals groß angestrengt habe; man würde nicht zugeben, daß er je unglücklich gewesen sei, wie man es auch Goethe und Shakespeare nicht glauben würde. Es klebt ihm gar nichts Absonderliches an, man späht umsonst nach dunklen Ecken in seiner Seele, in denen die traurigen Gedanken sich festnisten könnten wie Spinnweben in verlassenen dumpfigen Gemächern. Zufrieden wie ein Baum, der, mit Früchten schwer behangen, trotz seiner seufzenden Äste glücklich scheint, steht er da, und die Bewunderung, die ihn umgibt, ist nichts, was sein Glück erhöhte oder es verminderte, wenn man sie ihm versagen wollte.
Solche Menschen gehen durchs Leben, wie ein Vogel durch die Luft fliegt. Es hindert sie nichts. Es ist dem Strome einerlei, ob er glatt in langer Linie durch die Ebene fließt oder in gekrümmtem Laufe sich um Felsen schlängeln muß. Es ist kein Umweg für ihn, so in weite Schleifen rechts und links gedrängt zu werden, kein Aufenthalt, wenn der Lauf sich ihm völlig staute: behaglich schwellend breitete er sich zum See aus, und endlich bräche er dennoch einen Weg für seine Wogen, und die Gewalt, mit der er nun dahinschießt, ist ebenso natürlich als die Ruhe, mit der er seine Bahn wandelte vorher. Raffael, Goethe und Shakespeare hatten kaum äußere Schicksale. Sie griffen mit sichtbarer Gewalt nicht ein in die Kämpfe ihres Volkes. Sie genossen das Leben, sie arbeiteten, sie gingen ihren Weg und zwangen niemand, ihnen zu folgen. Keinem drängten sie sich auf und forderten die Welt nicht auf, sie zu betrachten oder zu tun, wie sie getan. Aber die anderen alle kamen von selbst und schöpften aus ihren erfrischenden Fluten. Man nenne eine gewaltige Tat Raffaels, Goethes oder Shakespeares? Goethe, der so tief verflochten scheint in alles, was uns angeht, der der Schöpfer unserer geistigen Kultur ist, hat sich nirgends gegen die Ereignisse gestemmt; er wandte sich dahin, wo er am bequemsten vorwärtskam. Er war fleißig. Er hatte die Vollendung seiner Werke im Sinn; Schiller wollte wirken und eingreifen, Michelangelo wollte handeln und duldete nicht, daß Geringe vorn ständen, über denen er sich Meister fühlte. Der Gang der Ereignisse bewegte Michelangelo und beteuerte oder dämpfte seine Gedanken. Die Betrachtung seines Lebens ist nicht möglich herausgerissen aus dem Gange der Weltereignisse, während sich Raffaels Leben abgesondert wie ein Idyll erzählen ließe.
Wir wissen nicht viel von Raffaels Erlebnissen; es ist an tatsächlichen Nachrichten über ihn fast ebensowenig vorhanden als bei Leonardo. Die Phantasie des Volkes aber hat sich daran nicht gekehrt. Wir haben ein Haus, wo er wohnte in Rom, eine Kneipe, wo er verkehrte, ein Haus seiner Geliebten, deren Name und deren Verhältnisse berichtet werden, haben Erzählungen, deren Mittelpunkt er bildet, von seinem kindlichen Alter in Urbino an bis zu seinem Tode, der ihn in der Blüte des Lebens in Rom fortnahm. Wie dem Volke Friedrich der Große immer als der alte König mit dem Krückstocke erscheint, so steht Raffael als der schöne Jüngling da, wie eine irdische Ausgabe beinahe des Erzengels, dessen Namen er trägt; und so sehr hat jeder, der sich mit ihm beschäftigte, von der Freiheit Gebrauch gemacht, der Idee nach, die er von ihm hegte, die Tatsachen zu beurteilen und zurechtzulegen, daß am Ende Wahrheit und Dichtung nicht mehr zu unterscheiden sind.
Raffael kam wohl 1507 zuerst nach Rom. Er trat nicht so jung in die Stadt ein wie Michelangelo, als dieser sie zuerst erblickte. Welch eine Masse von Arbeiten aber hatte Raffael bereits hinter sich, gegen das Wenige, doch Gewaltigere, was Michelangelo in demselben Alter getan. Michelangelo arbeitete stoßweise: zu Zeiten mit ungemeiner Anstrengung, dann wieder lange brach liegend, in Bücher und philosophische Gedanken vertieft; Raffael kannte keine Jahreszeiten: immer Blüten und Früchte zu gleicher Zeit tragend, scheint er eine unerschöpfliche Fülle von Lebenskraft in sich gefühlt und auf alles um sich her ausgeströmt zu haben.
Das ist es, was schon aus seinen frühsten Bildern herausleuchtet. Eigentümlich in Form und Gedanken sind sie gar nicht. Leonardo suchte das Abenteuerliche, Michelangelo das Schwierige, Große auf, beide arbeiten mit durchdringender Genauigkeit, beide gehen ihre eigenen Wege und drücken ihren Werken den Stempel ihrer Natur auf: Raffael lehnt sich an, geht in der Vollendung oft nur bis zu einem gewissen Punkte, bei dem er sich beruhigt, und scheint nicht eifersüchtig darauf, mit anderen verwechselt zu werden. Er malt zuerst in den Formen Peruginos und Porträts in der feinen Manier Leonardos – ein gewisser Liebreiz ist beinahe das einzige Kennzeichen seiner Werke –, endlich findet er sich in Rom allein Michelangelo gegenüber: da erst bricht die wahre Quelle der Kraft hervor in seinem Geiste, und er schafft Werke, die so hoch über den früheren Arbeiten stehen, daß die Luft von Rom, die er einatmete, Wunder an ihm gewirkt zu haben scheint. Und so ging es von da in steigender Linie vorwärts.
Michelangelos Einfluß kann allerdings für den allerersten römischen Aufschwung noch nicht in Betracht kommen, dagegen aber auch nicht mehr von Perugino die Rede sein. Raffael kam schon als selbständiger Mann, der einen eigenen Weg gefunden hat. Wenn er einem älteren Künstler dabei zu danken hatte, so ist es dem Fra Bartolommeo, dessen Freund er in Florenz war, derselbe, der vor Zeiten Savonarola zuliebe seine Arbeiten ins Feuer trug, zugleich ein Anhänger da Vincis, dessen Manier er sich anzueignen strebte. Beim Sturm von San Marco gehörte er zu denen, die das Kloster verteidigen wollten, und als der Kampf begann, tat er das Gelübde, Mönch zu werden, wenn er glücklich davonkäme. Im Jahre 1500 trat er dann ein und entsagte auf einige Zeit der Malerei gänzlich, wandte sich ihr in der Folge jedoch wieder zu und brachte eine große Anzahl ausgezeichneter Werke hervor, welche in Komposition und Kolorit hoch über denen Peruginos stehen. Dürfen wir aus seinem Charakter auf den Raffaels zurückschließen, da zwischen beiden ein dauerndes, vielleicht inniges Verhältnis bestand, so mag Raffael sich in Florenz, ehe er nach Rom ging, als zart, schüchtern und von sanft anschmiegsamem Wesen gezeigt haben, Seeleneigenschaften, die sich aus Fra Bartolommeos Werken ebenso deutlich als schön herauslesen lassen und die den Florentiner Gemälden Raffaels nicht minder eigentümlich sind; in Rom aber kam das Leben anders an die heran, die in seinem Strome schwammen, und es ist nirgends gesagt, daß Raffael furchtsam abseits am Ufer gesessen habe.
Raffael also, auf Bramantes Empfehlung berufen, begann für die Camera della Segnatura im Vatikan zu arbeiten, wo Schule von Athen und Disputa einander gegenüber die Hauptwände einnehmen, während an der dritten Wand, zwischen beiden, der Parnaß thront. Dies die Anfänge seiner römischen Tätigkeit. Im Vatikan läßt sich am schönsten verfolgen, wie Raffael von Jahr zu Jahr in immer großartigerem Wachstum sich entfaltete. Denn bald breitete er sich aus im Palaste, und Schüler und Gehilfen umgaben ihn. Die vorhandenen Deckengemälde Peruginos rettete er, als sie ihm im Wege zu stehen begannen, von den übrigen ließ er Kopien anfertigen, ehe sie der Zerstörung anheimgegeben wurden. An den Zimmern des vatikanischen Palastes hat Raffael so lange gearbeitet und arbeiten lassen, als er lebte.
Diese Räume, viereckig, aber von unregelmäßiger Grundfläche, stoßen in einer Reihe aneinander, durch ziemlich unscheinbare Türen verbunden, während die Fenster, ehemals mit gemalten Scheiben ausgefüllt, breit und hoch in die Mauern einschneiden. Marmorbänke sind vor ihnen angebracht, mit kostbaren geschnitzten Läden lassen sie sich schließen. Der Fußboden ist Mosaik, die Wölbung der Decke die schönste Kreuzung zweier Bogen, so daß sich die vier Wände des Gemaches nach oben hin in vollem Halbkreise abschneiden, während in den Ecken die Zwickel des Gewölbes sich tief hinunterstrecken. Obgleich alles verkratzt, beschmutzt und verwittert erscheint, so haust hier doch noch ein Hauch der alten Zeit in den Winkeln des Palastes. Man könnte im Traume die Farben wieder frisch, das Gold der Verzierungen neu und glänzend und die Sonne in den glühend bunten Glasscheiben der Fenster spielen sehen. Und durch die Türe träte Giulio ein, gebeugt ein wenig, aber mit kräftigen Schritten, und sein glatter, feiner, schneeweißer Bart fiele auf den purpursamtenen Kragen, den er über dem langen, weißgefälteten Unterkleide trägt, an seiner Hand aber glänzte der große Rubin, und sein blitzendes Auge überflöge die Gemälde, die sein Befehl hervorrief. Giulio liebte Raffael. Er gab ihm in jeder Weise die Gunst zu erkennen, deren er ihn würdig hielt.
Raffael widersprach ihm gewiß nicht, wie Michelangelo tat. Er war kein Schmeichler, aber seine Natur drängte ihn dazu, das Wohlwollen der Menschen zu gewinnen. Wie kindlich, ja schmeichlerisch schreibt er in jenen ernsten Tagen aus Rom an Francesco Francia nach Bologna, den er doch längst überholt hatte und dessen Werke und Tätigkeit er trotzdem über die seinigen erhebt, als wenn es sich wie die natürlichste Sache von selbst verstände. Francia aber sendet ihm ein Sonett, worin er seine Größe so schön und in so einfach starken Worten anerkennt, daß man aus diesem Zeugnis eines gleichzeitigen Künstlers den strahlenden Ruhm ermessen kann, den das Genie dieses glücklichen Jünglings, fortunato garzon, wie er von Francia genannt wird, plötzlich um sich verbreitete.
Dies Sonett, das mit den Worten beginnt: »Weder Zeuxis noch Apelles bin ich, noch einer von jenen großen Meistern, daß ich mit solchem Namen genannt zu werden verdiente, noch ist mein Talent und meine Kraft des unsterblichen Lobes würdig, das ein Raffael ihr zuerteilt« – scheint anzudeuten, daß es die Antwort auf ein von Raffael gesandtes Sonett war, in welchem Francia mit so überschwenglichen Vergleichen angeredet wurde. Doch ist keine Spur mehr davon vorhanden. Nur vier Sonette im ganzen haben wir von Raffael, Liebesgedichte, auf Studienblätter hingekritzelt, welche zur Disputa dienten, also im ersten Frühling oder Sommer gedichtet, den er in Rom zubrachte. Es steckt ein ganzer Roman in diesen Gedichten. Alle vier haben denselben Inhalt: leidenschaftliche Erinnerung an das Glück, das in den Armen einer Frau gefunden ward, zu der die Rückkehr unmöglich ist. Die Resignation, die Sehnsucht, die ihn erfüllt, die Wonne dann wieder, mit der er die Stunden sich zurückruft, als sie kam, tief in der Nacht, und sein war, sind in seine Verse hineingeflossen. Man fühlt, daß er viermal dasselbe sagen mußte, weil es unmöglich war, in Worten die Empfindung zu erschöpfen, und in den oftmals ausgestrichenen Reihen selber, aus denen er die Sonette aufzubauen sucht, liegt die Glut der großen Flamme, von der er sagt, daß sie an seinem Leben zehre. Kein einziges der Gedichte Michelangelos enthält so glühende Leidenschaft.
War es eine vornehme Frau, die Raffael liebte, die ein einziges Mal zu ihm kam: »um Mitternacht, als die Sonne längst hinabsank, kam sie, wie eine andere Sonne aufgeht, mehr zu Taten geschaffen als zu Worten«? Plötzlich war sie verschwunden, und nun sucht er den dilettoso affanno, die entzückende Qual, in Worte zu fassen, derer Opfer er geworden. Schweigen wolle er, verspricht er, wie Paulus von den Geheimnissen des Himmels, als er aus ihnen hinabstieg; reden müsse er dennoch, sagt er im anderen Gedichte, aber je mehr ihn verlange zu reden, um so unmöglicher sei es, und als einzigen Trost findet er am Ende das Bedenken, daß es zu großes, tödliches Glück vielleicht wäre, das noch einmal zu genießen; schweigen wolle er, ablassen aber könne er nicht von ihr mit den Gedanken. Und wie war das auch möglich, wo er das sanfte Joch ihrer Arme noch zu tragen glaubt, die seinen Hals umschlangen, und die Verzweiflung ihn noch durchzuckt, als sie sich losmachte und er im Dunkel einsam zurückblieb wie ein Schiffer auf dem Meere, der seinen Stern verloren hat.
Wir wissen nicht, ob er ihr jemals wieder begegnete. Keine Andeutung findet sich in seinen Briefen oder bei Vasari, kein Bildnis einer Frau, in der wir diese Gestalt vermuten dürften. Es ist von vielen Frauen die Rede, die Raffael liebte, aber von allen wird nichts weiter gesagt als nur, daß sie lebten und daß sie seine Geliebten waren.
Eine von ihnen befand sich in seinem Hause, als er starb; er setzte ihr reichlich zu leben aus, wie ein guter Christ, sagt Vasari. Eine andere liebte er, als er in dem Gartenhause Chigis malte. Von dieser soll er so völlig befangen gewesen sein, daß sie ihn von der Arbeit abzog und seine Freunde zuletzt keinen besseren Rat wußten, als sie zu ihm aufs Gerüst zu bringen. Da hatte er sie den Tag über immer um sich und hielt aus bei der Arbeit.
Raffael malte in Rom die Frauen anders als in Florenz. In den Porträts, die er dort hinterließ, liegt die heitere Ruhe, die Leonardo so schön auszudrücken wußte. Dagegen das Frauenbildnis im Palaste Barberini! – das er vielleicht in seinen ersten römischen Tagen malte und das wohl seine Geliebte darstellt, wenn auch nicht die Fornarina, wie Spätere sie getauft haben. Fornarina ist kein Frauenname; das Wort bedeutet die Bäckerin oder die Bäckerstochter und hat seinen Ursprung aus der Geschichte, daß Raffael die Tochter Bäckers in Trastevere geliebt habe.
Das Bildnis des jungen Mädchens oder Frau im Palaste Barberini ist ein wunderbares Gemälde. Ich nenne es so, weil es in hohem Grade die Eigenschaften rätselhafter Unergründlichkeit in sich trägt. Man möchte es immer von neuem betrachten. Sie sitzt uns zugewandt, beinahe nackt, aber doch nicht unbekleidet da; bis unter die Knie ist sie sichtbar. Ein rotes Kleid mit finsteren Schattenfalten ist über ihren Schoß gelegt: mit der rechten Hand hält sie ein dünnes, durchsichtiges, weißes Gewebe, das über den Leib in die Höhe gezogen ist, sanft an die Brust, aber man fühlt: eine Bewegung – und alles ist abgeworfen. Diese rechte Hand scheint mit dem Finger gleichsam einen anderen Ton anzuschlagen. Sie liegt unter dem Busen, mit dem Daumen allein drückt sie das spinnwebleichte Zeug an sich fest; der Zeigefinger berührt etwas aufgehoben die linke Brust und drückt eine leichte Telle hinein; die anderen drei Finger, lose gespreizt, liegen darunter und scheinen sie leise emporzudrängen. Die linke Hand dagegen ist in den Schoß herabgesunken, aber nicht etwa so, daß sie, auf dem Rücken liegend, nach oben geöffnet wäre, sondern mit der Fläche nach unten hin, als habe sie über das Gewand zu den Knien fortstreichen wollen und sei mitten in der Bewegung ins Stocken geraten. Matt auseinandergerissen liegen die Finger auf dem dunklen Purpur, die Wurzel der Hand auf der Höhe des einen Schenkels, die Spitzen der Finger auf dem anderen drüben, als bildeten sie lauter Brücken hinüber.
Den Arm dieser Hand umgibt nicht weit von der Schulter ein schmales Band, grün mit goldenen Rändern und in goldener Schrift steht RAPHAEL. VRBINAS. darauf Das Band scheint ein wenig zu eng, denn es drückt die Muskeln des Armes etwas, über denen es herläuft, daß er sich gelinde aufgebauscht zeigt, als wäre es, um nicht herabzurutschen, knapp darum gelegt.
Wollte Raffael seinen Besitz damit andeuten wie bei einem schönen Tiere, dem er ein Band anlegte, damit er mit Augen sähe, daß es sein sei? Denn höher steht dies Mädchen nicht. Nur Leidenschaften und keine Gedanken scheint seine Stirn zu beherbergen. Und der üppiggespannte Mund, dessen Winkel sich in die Wangen graben, die rabenschwarzen großen Augen, herüberblickend von der Seite zugleich und etwas von unten empor aufschauend, die ausgeprägten Nasenflügel und vollen Nüstern – es leuchtet eine göttlich unschuldige Sinnlichkeit daraus, wie die Göttinnen und Nymphen der Griechen sinnlich waren und ohne zweifelnde Gedanken rein dahingingen, weil sie niemals einen Gegensatz ahnten zu den einfachen glühenden Gefühlen, deren Stimme sie wie Befehlen des Schicksals gehorchten.
Die Wangen sind leise angebräunt wie auch Arme und Hände, also war sie gewohnt, sie in der freien Luft zu gebrauchen; die Augenbrauen dunkel wie die Nacht, als wäre jedes mit einem einzigen kühnen Federzuge gezogen. Das Haar ist glänzend schwarz, geteilt über der Stirn und glatt an den Schläfen her hinter das Ohr gestrichen; der Kopf mit einem bunten Tuche turbanartig umwunden, dessen Knoten an der einen Seite über dem Ohre liegt, das er ein wenig durch seine Schwere drückt.
Sanft vorgebeugt ist ihre Haltung. So sitzt sie da, mit ihren zarten Schultern ein wenig nach links gewendet; sie scheint verstohlen nach dem Geliebten zu blicken, um ihn anzusehen, wenn er malt, und sich doch ja nicht von der Stelle zu rühren, weil er es verboten hat. Ihm aber scheint es ein Quell des innigsten Vergnügens gewesen zu sein, sie aufs genaueste nachzubilden und in keinem Pünktchen anders darzustellen, als er sie vor sich sieht. Man glaubt ihr die Eifersucht, die Heftigkeit, das Lachen, die unverwüstliche gute Laune und den Stolz anzufühlen auf das Glück, von ihm geliebt zu werden. Er aber malte alles hinein, weil er dieser Gefühle selber so bis in ihre Tiefen hinab fähig war. Wenn es seine Bilder nicht verrieten, die Gedichte verrieten es. –
Fehlte Michelangelo diese Seite des Charakters völlig? Man ist gewöhnt, den Namen Vittoria Colonna auszusprechen, wenn eine Frau neben ihm genannt wird. Aber als er sie kennenlernte, war er fast ein alter Mann und sie nicht weniger in den Jahren. Es verband sie gleiche Gesinnung in schwierigen Zeiten. Sie aber blieb immer die Fürstin, und niemals war die Rede von Liebe zwischen ihnen. Vittoria lebte als Witwe halb wie eine Nonne schon und stand im Begriff ins Kloster zu gehen.
Nur die Gedichte Michelangelos gewähren eine Antwort. Es sind leidenschaftliche darunter, aber es fehlt fast überall das Datum ihrer Entstehung; die meisten, wo es sich bestimmen läßt, fallen in seine späten Jahre. Condivi erzählt jedoch, daß er schon früh zu dichten begonnen habe.
Aber in den Versen, die er als alter Mann schrieb, spricht er von seiner Jugend und den Leidenschaften, die sein Herz damals zerrissen. »Das war das schlimmste Teil meiner jungen Jahre«, sagt er, »daß ich blindlings und ohne Warnung anzunehmen in Glut geriet.« »Wenn du mich zu besiegen gedenkst«, redet er in einem anderen die Liebe selbst an, »so bringe mich zurück in die Zeiten, in denen die blinde Leidenschaft kein Zügel aufhielt, gib mir mein himmlisch heiteres Antlitz wieder, dem die Natur jetzt alle Kraft genommen hat. Und die Schritte, die mich meine Angst unnütz vergeuden ließ, und das Feuer gib mir zurück in meinen Busen und die Tränen, wenn du begehrst, daß ich noch einmal glühen und weinen soll.«
»Das waren Zeiten«, beginnt ein anderes, »als ich zu tausend Malen tödlich verwundet, dennoch unbesiegt und unermüdet blieb, und nun, da meine Haare weiß geworden, kommst du noch einmal? Wie oft zwangst du meinen Willen und gabst ihm wieder seine Freiheit, sporntest mich wie ein Pferd zur Wildheit, ließest mich erblassen und meine Brust mit Tränen baden; und nun, da ich alt bin, kommst du wieder?« So wären noch viele Stellen anzuführen. Immer redet Michelangelo jedoch von seinen Qualen, seiner verzehrenden Glut und von den Tränen: von der Erfüllung seiner Wünsche niemals. Kein Gedicht, aus dem, wie aus Raffaels sehnsuchtsvollen Zeilen, der süße Saft berauschenden Glückes wie aus einer reifen Frucht hervorquillt.
Es ist eins von Michelangelo vorhanden, worin er die Schönheit einer Frau beschreibt, aber man weiß nicht, ob er nicht etwa ein Bild anredet und ob die letzten Reihen mehr als dichterische Reflexion sind:
|
Der goldne Kranz, sieh, wie er voll Entzücken Das blonde Haar mit Blüten rings umfängt; Es darf die Blume, die am tiefsten hängt, Den ersten Kuß auf deine Stirne drücken. Wie freudig das Gewand den langen Tag Sich um die Schultern schließt und wieder weitet Am Hals, zu dem das Haar herniedergleitet, Das dir die Wangen gern berühren mag. Sieh aber hier, wie mit verschränkten Schnüren Nachgiebig und doch eng das seidne Band Beglückt ist, deinen Busen zu berühren. Der Gürtel spricht: laß mich die Lust genießen, Daß ewig meine Haft dich so umspannt – Wie würden da erst Arme dich umschließen! |
Wer ist diese Frau gewesen? Der goldene Kranz war bei den Florentiner Damen sehr gebräuchlich. Domenico Grillandaios Vater, ein Goldschmied, soll diesen Schmuck, die ghirlanda aurea, in Florenz erfunden und daher seinen Namen erhalten haben. Das Gedicht findet sich auf der Rückseite eines Briefes an den Bruder Buonarroto vom 24. Dezember 1507. Nichts aber verrät, ob Michelangelo glücklich oder unglücklich war in den Wünschen, die er aussprach.
Nach einer andern Richtung suchen die Gedanken eine Deutung seiner Leidenschaft, die so einsam immer in sich selbst zurückkehrt. Er sagt in dem Gedichte, dessen Worte ich vorhin zuerst anführte: »gib mir das himmlisch reine Antlitz wieder, aus dem die Natur alle Schönheit fortgenommen hat«, onde a natura ogni virtude è tolta. Ich übersetze virtude mit Schönheit, das Wort bedeutet Trefflichkeit, Tüchtigkeit, Kunst, Kraft, wir haben keinen gleichbedeutenden Ausdruck. Bezieht sich das auf den Schlag, den er als Knabe in Florenz erhielt und der ihn entstellte? War er so überzeugt von seiner Häßlichkeit, daß er um ihretwillen nicht wagte, was er sonst vielleicht gewagt hätte? Saß er einsam und über sein Geschick nachdenkend? Zwang er die Tränen heimlich zur Quelle zurück? Wir wissen es nicht. Es braucht auch nicht gewußt zu werden. Aber es widerspricht dem Bilde seines Charakters nicht, ihn so mit sich allein zu denken, daß die Abgeschlossenheit früh ein Bedürfnis für ihn ward, und er die Menschen, die er aus voller Seele liebte, dennoch von sich entfernt hielt, weil er sich für ihr Glück und ihren leichten Verkehr nicht geschaffen fühlte. Deshalb ist es wohl möglich, daß er auch Raffael immer nur eine ernste Stirn zeigte und ihm gegenüber nie daran dachte, ein Zeichen zu geben, daß er ihn verstände und sich selbst von ihm verstanden fühle.
II
Condivi ist es, der berichtet, daß Raffael durch Bramante die Fortsetzung der Sixtinischen Deckenmalerei für sich zu erlangen gesucht habe. Daß Bramante diesen Auftrag für Raffael zu erwirken strebte, bezweifle ich nicht, ob er es jedoch auf dessen Antrieb getan, konnte Condivi nicht wissen und selbst Michelangelo kaum. Bei solchen Fragen muß man lebhaft vor Augen haben, daß es sich um Dinge handelt, die beinahe fünfzig Jahre, nachdem sie vorgefallen sind, aufgeschrieben werden, und daß dies durch einen blindlings für Michelangelo eingenommenen, jungen Menschen geschieht, der hier, unschuldigerweise vielleicht, mehr hörte, als ihm erzählt ward. Denn das Abwägen beider Männer, Raffaels und Michelangelos, war mit der Zeit in Italien eine Frage geworden, wie bei uns die, ob Goethe oder Schiller größer sei, und wenn wir Condivi für noch so gewissenhaft halten, in diesem Punkte kann er parteiisch gewesen sein. Allein Condivi auch wieder hatte berichtet, Michelangelo habe, als er den Auftrag nicht annehmen wollte, Raffael vorgeschlagen. Nur das Gefühl vom Können Raffaels hätte einzig doch Michelangelo vermocht, Raffaels Namen zu nennen.
Nehmen wir also die Tatsachen, wie sie aus den Charakteren der Männer herfließen. Sicher war keine Seele in Rom, die so tief als Raffael empfand, was in der Sixtina von Michelangelo getan worden sei. Anzunehmen, daß Raffael sich der Erkenntnis verschlossen habe, es sei in der Sixtina etwas geleistet worden, was weder er selbst noch irgend jemand anders hätte leisten können, und zugleich, daß er den Trieb nicht in sich gefühlt habe, von dieser Gewalt sich anzueignen, was erreichbar sei, hieße die Größe Raffaels verkennen; es wäre Beschränktheit gewesen, sich ablehnend zu verhalten; ein Zeichen natürlicher Kühnheit war es, sich hinzugeben. Auch urteilte man in Rom, Raffael, nachdem er die Werke Michelangelos gesehen, habe einen anderen Stil angenommen.
Es könnte diese Änderung des Stils bei Raffael in Äußerlichem gesucht werden: im energischen Studium des Nackten und der Verkürzungen, denn beides war Raffaels Stärke nicht. Die Schule des Perugino wußte wenig von den Schwierigkeiten, die Michelangelo in die Kunst hineinbrachte; willige Gewänder deckten in hergebrachter Faltenlage die Gestalten zu und erleichterten die Arbeit. Deshalb waren Michelangelos badende Soldaten eine so große Neuerung und Peruginos Opposition gegen ihn eine so hartnäckige gewesen. Aber der Umschwung hatte tiefere Gründe; die alte Schule merkte, daß es ihr ans Leben ging.
In Raffaels Grablegung Christi, vollendet im Jahre 1507, gewahren wir die ersten Spuren des Einflusses, der von Michelangelo ausging. Die anfänglichen Entwürfe fallen in frühere Zeit und zeigen in den nackten Teilen die alte, hier im Gegensatz fast hölzern erscheinende Auffassung des Perugino, spätere Zeichnungen aber bewunderungswürdig realistische Freiheit. Michelangelos Karton stand in überraschender Größe und Freiheit Raffael vor Augen und ergriff ihn. Dann aber sank er wieder zurück in die alte Weise, vielleicht weil Aufträge fehlten, die ihn sich völlig freizumachen zwangen, und die Disputa im Vatikan, besonders die ersten Skizzen dazu, lassen ihn als den Schüler Fra Bartolommeos erscheinen – klassisch große Gewandung und ruhig zusammengestellte Gruppen sind dessen, ihn von anderen Meistern unterscheidendes Verdienst. Da deckt Michelangelo die Wölbung der Sixtinischen Kapelle auf, und in einer letzten Umgestaltung der Kompositionen für die Camera della Segnatura tut jetzt Raffael einen neuen Schritt vorwärts. Seine Studienblätter beweisen, in wie völlig veränderter Auffassung er nun arbeitet.
Doch nicht das läßt diese Gemälde in meinen Augen als ein Denkmal der einwirkenden Kraft Michelangelos erscheinen. Der Fortschritt Raffaels liegt nicht in dem sich äußerlich zeigenden Unterschiede von früheren Werken, sondern eine andere Eigenschaft, die von jetzt an seinen Kompositionen innewohnt, ist der wirkliche und im höchsten Grade wertvolle Gewinn, den das Zusammentreffen mit Michelangelo für ihn abwirft: er verläßt nun auch im Geiste die kleinlichere Auffassung seiner früheren Lehrer und Vorbilder und beginnt die Gestalten, die er malt, gleich so groß zu denken, wie er sie zur Ausführung bringt.
Wie ich dies verstehe, ist bereits bei Leonardo da Vinci gesagt worden, dessen Abendmahl in Mailand das erste wirklich groß gedachte italienische Bild ist. Michelangelo kam nach ihm. Man sieht Werken der Kunst an, in welchem Maßstab sie erdacht sind, unabhängig von dem, in welchem sie ausgeführt werden. Verhältnismäßig kleine Gebäude vermögen geistig den Eindruck fast kolossaler Größe hervorzubringen: die Tempel von Pästum zeigen das am deutlichsten. Sie schwellen an in der Erinnerung, die sie aufnimmt, man hält sie für größer, als ihre Maße sie erscheinen lassen. Andere Werke dagegen schwinden unwillkürlich zusammen, weil sie klein gedacht, nur durch mehrfache Verdoppelung ihrer Verhältnisse äußerlich umfangreicher gemacht worden sind, ohne größer an sich zu werden.
Die florentinische Malerschule neigte zum Kleinen. Perugino erhob sich über seine Vorgänger, aber auch seine größten Werke machen keinen großartigen Eindruck. Fra Bartolommeo, dem vorgeworfen wurde, daß sein Stil kleinlich sei, versuchte es anders und malte einen kolossalen heiligen Markus, heute im Palaste Pitti zu Florenz, doch man sieht der Gestalt sogleich an, daß sie nichts als eine Multiplikation geringerer Maße ist. Seine und Peruginos Auffassung hatte die Raffaels bisher bestimmt; in der Camera della Segnatura aber zeigt sich die großartigere Anschauung Michelangelos, die von da an die herrschende bleibt. Raffael steigerte sich nicht zum Kolossalen; er ahmte Michelangelo nicht äußerlich nach, aber es ist, als hätte er, von der Freiheit dieses Mannes berührt, sich selbst der Freiheit endlich hingegeben, von der ihn das Beispiel anderer bisher zurückgehalten. Nur ein einziges Mal ließ er sich bis zur äußerlichen Nachahmung hinreißen: er malte in San Agostino den kolossalen Propheten Esaias, heute verdorben und übermalt, aber auch den Linien nach von geringer Anziehungskraft. Dagegen zeigt sich in den Sibyllen der Kirche Maria della Pace und in den Gemälden der folgenden vatikanischen Gemächer die volle Kraft und Schönheit, die aus der Vermählung Michelangeloschen Geistes und Raffaelscher Phantasie entsprungen ist. –
Raffaels Phantasie bedurfte lebendigen Zusammenhangs mit dem, was gerade seine Umgebung bildete. Aus den Männern und Frauen, die er vor sich hatte, entstanden seine frischesten Kompositionen. Er stellte sie im höchsten Glanze ihres Daseins dar, aber er ging nicht in jene andere Welt über, in der Michelangelo zu Hause war. Am besten und liebsten malte er das Kostüm, in dem er die römischen Männer und Frauen sich in den Straßen der Stadt und den Palästen bewegen sah. »Ich muß viele Frauen gesehen haben, die schön sind, daraus bildet sich dann in mir das Bild einer einzigen«, schreibt er dem Grafen Castiglione und nennt dies so entstandene Bild una certe idea, korrekt im Sinne Platos, der unter Idee das den einzelnen Dingen innewohnende Bild versteht, welches sie, sie in ihrer Vollkommenheit darstellend, wie ein leuchtender Schatten gleichsam begleitet. Michelangelo, wenn er sich einmal an die Natur anlehnen will, kopiert sie wissenschaftlich genau, ohne sie zu erhöhen, und geht da mit derselben Ungeschminktheit zu Werke, die man Donatello zum Vorwurf machte. Wenn er sich aber schöpferisch in den eigenen Geist versenkt, entstehen seine Bilder von Anfang an, wie am reinen Himmel sich Wolkengebilde plötzlich aus unsichtbaren Dünsten zusammenballen. Raffaels Gestalten wohnt jeder ein bestimmter irdischer Kern inne, dessen Hülle sie verherrlichen. In ähnlicher Art, wie Raffael gemalt hat, dichtete Goethe, während Schiller, mehr im Geiste Michelangelos arbeitend, sich ihm auch darin nicht ungleich zeigt, daß er, wenn einmal die Natur treu nachgezeichnet werden sollte, bei weitem handgreiflicher als Goethe wird. Michelangelo wäre nicht imstande gewesen, ein Gemälde zu schaffen wie die Messe von Bolsena im zweiten Gemache des vatikanischen Palastes. Wir sehen den Papst, die Kardinäle, die Schweizer und das Volk von Rom leibhaftig; als dürfte man die Gestalten bei ihren Namen nennen, so irdisch deutlich erscheint das Leben, das jeden einzelnen erfüllt; Shakespeare läßt seine Figuren nicht natürlicher auftreten. Und selbst da, wo Raffael in der Farnesina nackte Götter und Göttinnen vorbringt, sind es nur die gewandlosen römischen Männer und Weiber; darum aber nicht weniger würdig, in den goldenen Palästen des Olymp zu wohnen.
Beide, Raffael wie Michelangelo, standen mitten in einer Bewegung des Lebens, durch die ununterbrochen die tiefsten Gefühle der Menschen herausgefordert und fast mit Gewalt auf die Oberfläche getrieben wurden. Die Welt zwängte sich nicht in die lügnerischen Formen späterer Jahrhunderte; Männer, Frauen traten auf, wie sie waren, und was sie begehrten, darnach streckten sie offen die Arme aus; frei noch von dem drückenden Gefühl, das von da an Jahrhunderte hindurch die Völker belastet hat: dem Kummer um die verlorene Freiheit, sah man Vergangenheit und Zukunft in gleichgültiger Dämmerung, und die Gegenwart strahlte im Sonnenlicht.
Bramante kümmerte es wenig, ob die richtende Nachwelt ihre Unzufriedenheit zu erkennen geben werde: er wollte Michelangelo fort haben, er selbst und Raffael sollten die Ersten in Rom sein. Soweit die Kunstgeschichte bekannt ist, soweit finden wir solche geheime Triebfedern, alle Zeiten gleichen sich darin, und die Erlebnisse der letzten Tage werden einst nicht anders erscheinen. Michelangelo aber war nicht der Mann, gutwillig zurückzuweichen. In Gegenwart des Papstes kam es zu einer heftigen Szene. Michelangelo nahm kein Blatt vor den Mund und warf Bramante alles ins Gesicht vor, was er von ihm auszustehen gehabt, dann aber, von den Klagen über seine Intrigen zu heftigeren Vorwürfen vorschreitend, forderte er ihn auf, sich zu verantworten, warum er beim Abbruch der alten Basilika von Sankt Peter die prachtvollen antiken Säulen habe umstürzen lassen, welche die Decke der Kirche trugen, ohne sich um ihren Wert zu kümmern, die nun zerbrochen auf dem Boden herumlägen und zugrunde gingen. Millionen Backsteine einen auf den anderen zu setzen, sei keine Kunst, eine einzige solche Säule aber zu arbeiten eine große Kunst, und in diesem Tone fortfahrend schüttete er sein Herz aus.
Die Mißachtung, mit der Bramante die Werke des Altertums behandelte, ist notorisch. Zu dem Palaste des Kardinals di San Giorgio hatte er antike Bauwerke der Stadt zerstört, um Steine zu gewinnen. Im Sankt Peter aber warf er alles durcheinander, Malereien, Mosaiken, Denkmäler; ja sogar Grabmäler der Päpste verschonte er nicht, so daß Michelangelos Vorwürfe nur das bedeutendste berührten.
Der Papst schützte Raffael, der in nicht minderem Grade als Michelangelo die Bewunderung Roms geworden war, aber er empfand den Unterschied der Naturen beider Künstler und wußte jedem seine Stelle zu geben. Michelangelo durfte reden wie ihm seine Leidenschaft die Worte eingab. Giulio duldete das, er kannte sein Naturell und war zu eifersüchtig auf seinen Besitz, um ihn nicht unter allen Umständen in Rom festzuhalten. Er ließ ihn anprallen und wußte, daß er sich beruhigen werde. Der Papst selber war einer von denen, die sich austoben mußten zu Zeiten. Man betrachte das Bildnis, das Raffael von ihm gemacht hat. Dieser weiße Löwe, der, unter Stürmen alt geworden, seine Haupttaten dennoch erst zu vollbringen hoffte, ließ sich nicht beirren durch die Heftigkeit eines Geistes, der äußerlich betrachtet, ihm untergeordnet war, aber dem er deshalb gerade zuerst nachgab wie Michelangelo selbst der nachgiebige Teil gewesen wäre, wenn das Schicksal ihn zum Papst und Giulio nur zum Bildhauer Seiner Heiligkeit geschaffen hätte.
III
Giulio war der letzte Papst im alten Sinne des guelfischen streitbaren Papsttums. Nach seinen Tagen verschwindet überhaupt das Heldenmäßige aus der europäischen Geschichte. Wo die Herrscher von nun an selbst in den Krieg ziehen und die Schlachten leiten, spielt ihre persönliche Laune doch keine Rolle mehr, das Schwert in den Händen adliger, schwer bewaffneter Reiter unterliegt der entscheidenden Macht der Artillerie, die Männer geben sich nicht mehr ganz und gar den Ereignissen hin, und die Furcht, im Kriege besiegt zu werden, war die größte nicht mehr für das Oberhaupt eines Staates. Es herrschte in den folgenden Zeiten eine Furcht, die größer war als jede andere: die vor der Gewalt des Geistes in den Köpfen der eigenen Untertanen. Durch dies Gefühl werden alle Fürsten, auch wenn sie gegeneinander im Kriege liegen, zu stillen Verbündeten gemacht: mit dieser gemeinsamen Unterdrückung des Geistes plagten sich die Könige damals noch nicht, und die Verhältnisse waren reiner und natürlicher.
Giulio wußte, daß es auf seine päpstliche Krone abgesehen sei. Doch das kümmerte ihn wenig. Die Gefahr war sein liebstes Element geworden. Sein hohes Alter entledigte ihn der Sorgen für eine lange Zukunft. Es lag in der Luft zu jenen Zeiten, die eigene Existenz aufs Spiel zu setzen. Leute von ruhiger Mäßigung stehen als besondere Erscheinungen da; Kraft, wenn auch mit Hinterlist und Grausamkeit gepaart, flößt Respekt ein, Habsucht wird niemanden verdacht, Milde und Versöhnlichkeit aber verspottet. Machiavelli, der in jenen Tagen seiner praktischen Tätigkeit die Erfahrungen sammelt, deren Resultat das Bild eines Fürsten ist, wie er sein müßte wenn er sich in einem Staate wie Florenz behaupten wollte, gibt als obersten Grundzug fürstlichen Charakters die Fähigkeit an, die Dinge vorauszusehen und ihnen durch rücksichtsloses Handeln zuvorzukommen. Diese Politik des Drauflosgehens wurde befolgt bis in die kleinsten Verhältnisse herab. Die Degen saßen lose in der Scheide; niemand hoffte durch Nachgiebigkeit zu seinem Rechte zu kommen.
Im Jahre 1508 war der Papst dem Bündnisse von Cambrai beigetreten, dessen Inhalt die Vereinigung Maximilians und des Königs von Frankreich zur Vernichtung der venezianischen Macht war. Im nächsten Jahre schon stand er, verbündet mit Venedig und Spanien, Frankreich und Maximilian gegenüber. Der Herzog von Urbino ging mit den päpstlichen Truppen gegen Ferrara vor, das unter französischer Protektion stand. Die venezianische und spanische Flotte sollte Genua angreifen und revoltieren, endlich, die von Ludwig vernachlässigten Schweizer würden sechstausend Mann stark in die Lombardei einbrechen, hoffte man. Alles mißglückte. Gegen Ferrara wurde nichts getan, die Schweizer, von Ludwig und Maximilian bewogen, machten kehrt; der Angriff auf Genua mißlang. Dennoch drang Giulio, der sich bald auch von Spanien so gut wie verlassen sah, auf Fortsetzung des Krieges. Im September 1510 ist er selbst wieder in Bologna und greift, unterstützt von der venezianischen Land- und Seemacht, Ferrara an; die Franzosen und ihre Verbündeten werden mit dem Kirchenbann belegt.
Die französische Geistlichkeit lehnte sich auf dagegen: unter den Kardinälen trat eine Spaltung ein. Eine Anzahl von ihnen wußte vom Papste Urlaub auf unbestimmte Zeit zu erwirken und kehrte nicht zu ihm zurück. Der Kardinal von Pavia, Giulios Schatzmeister und innigster Vertrauter – der einst eine hohe Summe ausgeschlagen, mit der ihn Cesare Borgia bestechen wollte, Giulio Gift zu geben – geriet jetzt in den Verdacht der Verräterei. Der Herzog von Urbino warf ihm seine Umtriebe mit den Franzosen ins Gesicht vor und führte ihn mit Gewalt von der Armee fort nach Bologna; dort jedoch wußte der Kardinal sich vor dem Papste zu reinigen.
Die Päpstlichen standen in Modena, nordöstlich von Bologna an der großen Straße nach Parma hin; Chaumont, der Vizekönig der Lombardei, der Freund Leonardo da Vincis, rückte ihnen von Parma her entgegen. Der Herzog von Urbino wollte sich nicht schlagen, ohne die spanischen und venezianischen Hilfstruppen abgewartet zu haben; in Chaumonts Interesse lag es, vorher ein Zusammentreffen herbeizuführen. Er kam näher und näher, die Päpstlichen rührten sich nicht, als er auf Betreiben der Bentivogli, die sich bei ihm befanden, den Entschluß faßte, den Herzog von Urbino ruhig sitzen zu lassen und mit Umgehung Modenas auf Bologna loszumarschieren, wo sich der Papst mit den Prälaten befand und im Kastell nur eine geringe Besatzung lag, während die Freunde der Bentivogli in der Stadt wohlgerüstet die Ankunft der alten Herren erwarteten.
Die Hauptstraße wurde demnach von den Franzosen verlassen, die kleineren Örter mit päpstlichen Besatzungen überrumpelt: plötzlich stand die Armee vor Bologna, wo der Papst, krank, inmitten der erschreckten Kardinäle der einzige Mann war, der seine Energie behielt. Er hoffte stündlich auf die Ankunft der Venezianer; was an Truppen in der Umgegend aufzutreiben war, zog er an sich und forderte die versammelten Behörden der Stadt auf, mit ihm gegen die heranrückenden Tyrannen ihre Mauern zu verteidigen.
Aber das bolognesische Volk wollte die Waffen nicht ergreifen; die Gesandten des Kaisers, des Königs von Spanien, Venedigs und Englands redeten zu, mit den Franzosen einen Vergleich einzugehen, die Kardinäle flehten ihn an; endlich verstand er sich dazu, mit Chaumont in Unterhandlungen zu treten. Lorenzo Pucci, seinem Datario, übergab er die päpstliche Krone, die von Edelsteinen starrte, um sie nach Florenz zu retten und dort in einem Kloster aufzubewahren; er sandte zu Chaumont; er konnte sich nicht entschließen, dessen Bedingungen anzunehmen; da, im letzten Momente, kommen die Venezianer heran, das Volk von Bologna regt sich zu seinen Gunsten, die Hilfstruppen der Spanier treffen ein, Mut und Kraft kehren in Giulios Herz zurück, und eine hochmütige Antwort erfolgt auf Chaumonts Vorschläge. Diesem fangen an die Lebensmittel knapp zu werden, und unter dem Vorwande, daß er den Papst um so freier über die Proposition des Königs entscheiden lassen wolle, zieht er sich mit der Armee von Bologna zurück.
Was Ludwig vom Papste verlangte, war so ziemlich ein Sündenbekenntnis und Zurückgabe alles Genommenen. Giulio dachte aber nicht mehr an dergleichen. Laut beschuldigte er den König von Frankreich des Wortbruchs und der Verräterei und schritt zur Weiterführung des Krieges. Die Päpstlichen rückten wieder vor. Mit Entzücken lauschte der Papst am Fenster seines Zimmers in Bologna dem fernen Donner der Kanonen, mit denen seine Leute Sassuolo beschossen und die Franzosen daraus vertrieben. Ferrara sollte nun erobert werden, aber es wurde davon abgestanden, um erst Mirandula zu nehmen. Dies geschah im Dezember 1510. Und während man so gegen den Herzog von Ferrara in seinem eigenen Lande mit den Waffen stritt, kamen nach anderen Seiten hin andere Mittel zur Anwendung. Florenz hatte auf Anstiften der beiden gründlich französisch gesinnten Soderini, des Gonfaloniers und des Kardinals, den Franzosen Truppen geliefert. Der Kardinal dei Medici brachte aus der Ferne ein Komplott in der Stadt zustande, den Gonfalonier zu vergiften. Der Papst wußte darum, aber der Anschlag gelang nicht.
Mirandula leistete Widerstand. Im Januar 1511 ging der Papst selber ins Lager. Er wohnte in der Hütte eines Bauern, die im Bereiche der feindlichen Kugeln lag. Den ganzen Tag war er zu Pferde; mitten im stürmischen Wetter erschien er bald hier, bald dort und hielt die Leute hinter den Kanonen in Atem. Schnee und Kälte wurden immer gewaltiger, die Soldaten hätten sie nicht ertragen, der unverwüstliche Greis aber feuerte sie an und versprach ihnen die Stadt zur Plünderung. Eine Stückkugel schlug in eine kleine Kirche ein, in der er sich dicht bei seinen Batterien einquartiert hatte, und tötete nicht weit von ihm zwei seiner Leute. Er suchte nun ein anderes Unterkommen, kehrte aber schon am folgenden Tage zurück, während die in der Festung, die ihn erkannten, eine große Kanone auf die Stelle richteten und ihn abermals zwangen, mit der Stellung zu wechseln. Aber Giulio gab nicht nach. Je mehr die Hindernisse wuchsen, um so fester war sein Wille und um so unerschütterlicher seine Zuversicht.
IV
Auf Michelangelos Malerei in der Kapelle war unterdessen der Krieg nicht ohne Einfluß gewesen. Im September 1510 hatte der Papst Rom verlassen. Alsbald stockten die Zahlungen. »Lieber Vater«, schreibt Michelangelo, »heute morgen, am 5. September, habe ich Euren Brief empfangen und mit großer Betrübnis gelesen. Buonarroto ist krank, bitte schreibt mir auf der Stelle, wie es mit ihm steht. Hat er sich nicht gebessert, so komme ich nächste Woche nach Florenz. Freilich könnte mir die Reise zum größten Nachteil ausschlagen, denn ich habe kontraktmäßig noch 500 Dukaten zu erhalten, und ebensoviel war mir der Papst für die zweite Hälfte des Werkes schuldig, nun aber ist er abgereist, ohne irgendwelche Verfügungen zu hinterlassen, so daß ich ohne Geld dastehe und nicht weiß, was ich tun soll. Gehe ich fort, so könnte er das übel aufnehmen und ich dabei um das Meinige kommen oder sonst Verdruß haben. Ich habe an den Papst geschrieben und warte auf Antwort. Ist Buonarroto aber noch in Gefahr, so schreibt, und ich lasse alles stehen und liegen. Sorgt für alles, sollte Geld fehlen, so geht zum Spitalmeister von Santa Maria Nuova, zeigt ihm diesen Brief, wenn er Euch ohne das nicht glauben will, und laßt Euch 150 Dukaten auszahlen, soviel Ihr braucht, scheut keine Ausgabe. Und somit hofft das Beste: Gott hat uns nicht geschaffen, um uns in der Not zu verlassen. Antwortet umgehend, und schreibt deutlich, ob ich kommen soll oder nicht.«
Zwei Tage darauf ein neuer Brief an seinen Vater, fast wörtlich desselben Inhalts und nur mit der genaueren Angabe, daß ihm die 500 Dukaten sowohl für die Malereien als für das Gerüst vom Papste geschuldet wurden. Michelangelo scheint gefürchtet zu haben, daß der erste Brief verloren gegangen sei.
Am 10. Oktober meldet er Buonarroto, dessen Krankheit mithin keinen bösen Verlauf genommen hatte, daß er durch den Datario des Papstes 500 Dukaten empfangen habe. Den größten Teil des Geldes sendet er zugleich nach Hause. Wie wenig trotz dieser günstigen Wendung Michelangelo dennoch zu jener Zeit auf Rosen gebettet gewesen sei, zeigt das Ende des darauf folgenden Briefes. »Wenn du Michelangelo Tanagli siehst, so sag ihm von mir, ich hätte während der beiden letzten Monate so viel Verdruß gehabt, daß es mir unmöglich gewesen, ihm zu schreiben. Ich würde jedoch alles aufbieten, um einen Karneol oder eine gute Medaille für ihn aufzutreiben, und ließe mich für den Käse bedanken. Nächsten Posttag würde ich schreiben. Den 26. Oktober 1510.«
Der Posttag war immer der Sonnabend. Die Briefe wurden mit einer Oblate gesiegelt, zugleich aber noch ein Bindfaden umgeschlagen und dessen Enden in das Siegel mit eingedrückt.
Im Januar 1511 brachte Michelangelo endlich die Sache zum Abschluß. Er machte sich in Person auf. Bramante war als Ingenieur beim Papste damals, vielleicht daß Michelangelo gerade deshalb persönlich gehen zu müssen glaubte, um die Auszahlung der Gelder zu bewirken. Da die Belagerung von Mirandula bis zum 20. Januar dauerte, Michelangelo aber den 10. bereits wieder in Rom war, kann er den Papst nur im Lager vor Mirandula gesehen haben. Es ist seltsam, daß ihm, Condivi gegenüber, diese Reise ganz aus der Erinnerung geschwunden war.
»Vorigen Dienstag«, schreibt er am 11. Januar von Rom an seinen Bruder, »bin ich glücklich wieder angekommen, und das Geld ist mir ausgezahlt worden.« Anliegend sende er einen Wechsel über 228 Dukaten. Dem Araldo solle Buonarroto sagen, er möge ihn dem Gonfalonier empfehlen, ihm danken und mitteilen, daß er nächsten Sonnabend schreiben würde. Zum Schluß: »Halte die Kiste in gutem Verschluß und meine Kleider, damit sie mir nicht wie Gismondo gestohlen werden.« Michelangelo war, scheint es, über Florenz gegangen und hatte mit Soderini verhandelt. Die Jahreszahl 1510, welche der Brief trägt, ließ Zweifel aufsteigen, ob der Brief nicht ein Jahr früher zu setzen sei, aber der Umstand, daß dieselbe Zahl bei der Empfangsangabe des Briefes von Buonarroto außen auf das Kuvert gesetzt worden ist, zeigt, daß Michelangelo diesmal die florentinische Rechnung beibehalten hatte und daß mithin nach römischer 1511 zu verstehen sei.
Am 20. Januar also hatte Mirandula kapituliert. Mit sechzig Pfund Goldes wurde den Päpstlichen die Plünderung abgekauft. Jetzt kam Ferrara an die Reihe. Der Papst aber mußte nach Bologna zurück, weil er den Strapazen unterlag.
Ein Brief Michelangelos vom 23. Februar läßt es ungewiß, ob er jetzt den Papst zum zweitenmale aufsuchte. »Ich glaube«, schreibt er an Buonarroto, »daß ich binnen kurzem noch einmal nach Bologna werde zurück müssen, denn der Datario des Papstes, mit dem ich von dort kam, versprach mir, als er von hier zurückging, er werde dafür Sorge tragen, daß ich fortarbeiten könnte. Nun aber ist er schon einen Monat fort, und ich höre kein Wort von ihm. Ich will es diese Woche noch abwarten, dann aber, wenn nichts dazwischenkommt, gehe ich nach Bologna ab und komme bei euch durch. Teile es dem Vater mit!« Jetzt endlich erlangte Michelangelo in Bologna, was er wollte. Er fand Leute in der Umgebung des Papstes, denen er seine Lage überzeugend darstellte. Von den paar tausend Scudi, welche er durch sie erlangte, gab er dem einen hundert, dem anderen fünfzig ab und machte sich nach Rom zurück, wo er im Februar 1511 die Malerei wieder aufnahm, die er nun in 20 Monaten zu Ende führte. Wir haben viele Briefe aus diesem Zeitraume. Einigemale schreibt er ganz verzweifelt. Er nennt sich krank, er sagt von sich, daß er mehr trage, als je ein Mensch getragen habe, aber er brachte es zum erwünschten Ziele.
Man begreift allerdings, warum es Michelangelo so schwer gefallen war, den Papst in Bologna für seine römischen Malereien wieder zu erwärmen. Giulio hatte den Kopf voll andrer Dinge. Im Februar 1511 trat in Mantua der Kongreß zusammen, der den Frieden feststellen sollte, der Krieg aber nahm trotzdem seinen Fortgang und der Papst tätigen Anteil. Der Kaiser und der König von Frankreich hatten für das Frühjahr einen Feldzug gegen Venedig vor und wollten den Papst zwingen, sich ihnen anzuschließen. Wenn nicht, war man entschlossen, ein Konzil zu berufen, das heißt, Giulio abzusetzen. Dieser dagegen hoffte Venedig und den Kaiser auszusöhnen und mit dem Hinzutritt Spaniens eine allgemeine Koalition gegen die Franzosen ins Werk zu setzen.
Der Erzbischof von Gurk wurde als Abgesandter des Kaisers mit ausgezeichneten Ehren in Bologna vom Papste empfangen; kaum aber begann er von Ferrara zu reden, als Giulio ihn wütend unterbrach. Ehe er hier seine Ansprüche aufgebe, wolle er lieber das Leben und die Krone verlieren. Man vereinigte sich nicht. Trivulzio, der nach Chaumonts Tode die Truppen des Königs von Frankreich in der Lombardei befehligte, rückte wieder los auf Bologna und trieb die kampflos zurückweichende Armee des Papstes vor sich her auf die Stadt zu. Der Papst suchte sie zum Stehen zu bringen, er wollte selbst in ihre Mitte eilen, aber die Gefahr war zu dringend, denn seine spanischen Hilfstruppen erklärten plötzlich, daß sie abziehen würden. Der Erzbischof von Gurk hatte das in Bologna beim spanischen Gesandten erwirkt. Giulio, schon auf dem Wege zu seinen Leuten, mußte umkehren auf diese Nachricht. Wiederum ließ er die Behörden der Stadt zusammentreten, hielt ihnen die Lage der Dinge vor und wich dann aus Bologna nach Ravenna. Den Kardinal von Pavia ließ er in Bologna zurück. Die päpstliche Armee lag außerhalb der Stadt. Die Bürger erklärten, keinen Soldaten Einlaß in die Stadt gewähren zu wollen, sie würden sich allein verteidigen.
Der Kardinal hatte ein paar hundert leichte Reiter und gegen tausend Mann Infanterie, ungenügend, einen so umfangreichen Platz zu besetzen. Mit Urbino, der draußen lagerte, stand er im schlechtesten Verhältnisse. Jeder hätte mit Freuden den Ruin des andern gesehen. Der Kardinal nahm jetzt einen Teil des bewaffneten Volkes in seine Dienste und gab einige Punkte der Stadt in die Hände dieser Leute. Eines der Tore kam so in den Besitz der Anhänger der Bentivogli, denen man sogleich ins französische Lager Botschaft sandte, der Eintritt in die Stadt stehe frei, sie sollten kommen. Der Kardinal erkannte seinen Fehler und hoffte ihn dadurch wieder gutzumachen, daß er dem neugeworbenen Volke den Befehl gab, sich auf der Stelle zum Herzog ins Lager zu begeben, dieser habe es verlangt. Man antwortete, daß man die Stadt zu behüten habe und seinen Posten nicht aufgeben werde. Nun versuchte er tausend Mann erprobter Truppen von draußen hereinzubringen, denen aber öffnete man die Tore nicht. Mit dem Gefühle, die Gewalt verloren zu haben und im Bewußtsein, durch Grausamkeit und Habsucht verhaßt zu sein, warf sich der Kardinal jetzt in das Kastell, so rasch, daß er seine Kassen und Edelsteine mitzunehmen vergaß, erinnerte sich jedoch noch beizeiten daran, ließ sie nachholen, packte zusammen und flüchtete von wenigen Reitern begleitet in südwestlicher Richtung nach Imola.
Sogleich verbreitete sich die Nachricht, daß er fort sei. Das Volk erhob sich. Die Bentivogli draußen erfuhren, wie es stände und machten sich auf. Um Mitternacht trafen sie in Bologna ein. Mit Fackeln ging der Zug durch die Straßen nach dem Palaste der Regierung. Eine Statue des Papstes, die aus vergoldetem Holze gefertigt über der Türe des Palastes aufgestellt war, wurde heruntergerissen, auf dem Platze umhergeschleift und verbrannt, während man nach dem Werke Michelangelos die Musketen abschoß.
Kaum hatte Urbino im Lager die Flucht des Kardinals vernommen, als er selber unverzüglich aufbrach. Alles ließ er im Stich; fünfzehn Stück schweres Geschütz, die Fahnen, Wagen, Gepäck und selbst die Habseligkeiten der letzten Abzügler, die von den Franzosen aufgegriffen wurden, fielen in die Hände des Feindes. Die Zitadelle von Bologna kapitulierte, nachdem sie sich noch vierzehn Tage gehalten, und wurde vom Volke niedergerissen.
In Ravenna, wo der Papst sich befand, trafen Urbino und der Kardinal von Pavia zusammen. Auf offener Straße, wo sie sich begegneten, erstach der Herzog den Kardinal mitten unter seinen Begleitern. Der Papst schrie auf zum Himmel und heulte, daß ihm sein bester Freund geraubt worden sei, der Herzog dagegen schwor heilige Eide, Pavia sei ein Verräter gewesen und trage Schuld an allem Unheil. Zu gleicher Zeit kam die Nachricht, auch der Herzog von Ferrara habe sein Herzogtum wieder in Besitz genommen, und Trivulzio stehe mit der Armee an der Grenze des Gebietes zwischen Ravenna und Bologna. Er erwarte nichts als die Anweisung seines Königs, um in die offen daliegenden päpstlichen Staaten einzurücken.
Ludwig aber war sehr darum zu tun, den Schein des gehorsamen Sohnes der Kirche zu bewahren. Statt gewaltsam vorzugehen, begann er zu unterhandeln. Auch die Bentivogli mußten dem Papst erklären, daß sie Bologna nur als gehorsame Söhne der Kirche in Besitz hielten. Der Papst machte sich auf nach Rom. In Rimini hörte er zuerst, daß in Bologna, Modena und anderweitig schon die Plakate öffentlich angeschlagen wären, auf denen er vor das Konzil nach Pisa gefordert würde, wo sich die Kardinäle zu versammeln begannen. So traf er in Rom wieder ein, ohne Heer, ohne Bologna, ohne den Kardinal von Pavia, alt, krank, angeklagt und vor Gericht gefordert, aber in der Seele die alte Hartnäckigkeit und die Begierde, an seinen Feinden Rache zu nehmen.
V
Es liegt ein Element der Unverwüstlichkeit im Papsttum, das vorhalten wird, solange es katholische Fürsten mit widerstreitenden Interessen gibt. Der Papst steht zwischen ihnen als die einzige ideale Macht, die zäh an ihrem Willen haftet, während ihn die unsichere, von Anfang an durch niederen Ehrgeiz zerrissene Masse umflutet, die vielleicht seine Person, aber nicht sein Amt vernichten kann. Das Papsttum der alten Zeit wird untergehen, wenn alle Romanen sich zu einem einzigen Reiche verbinden und dieses Volk sich dann auf eine Höhe geistiger Kultur erhebt, daß weltliche Herrschaft in geistlichen Händen als eine Absurdität erscheint.
Am Vorabend des Fronleichnamsfestes 1511 war der Papst in Rom wieder angekommen. Er wollte bei den Feierlichkeiten selbst fungieren. In voller Pracht setzte er seine ruhige gekrönte Stirn der beweglichen Ungeduld entgegen, mit der das Volk die Ereignisse erwartete. Damals malte Raffael die Messe von Bolsena, die Bekehrung eines Priesters darstellend, der an die Wandlung der Hostie nicht glauben will. Das Wunder ereignete sich vor Jahrhunderten, nichtsdestoweniger ist Giulio als gegenwärtig gemalt: wir sehen ihn knien am Altare, an dessen anderer Seite der beschämte Priester steht; symbolisch sollte gezeigt werden, wie er festhalte am Vertrauen auf die wunderbare Hilfe des Himmels und daß die Zweifelnden, gleich dem Priester mit der Hostie, reumütig einst die Wahrheit erkennen würden.
Er sammelte ein neues Heer; unterhandelte mit Frankreich, das zum Krieg wenig Lust hatte; mit dem Kaiser, dessen Schwanken in politischen Dingen weltkundig war; mit Venedig, das mit Ludwig und Max noch immer im Kriege lag; mit Ferdinand und mit dem Könige von England, Frankreichs natürlichen Gegnern. Während er im Gegensatze zu dem in Pisa angesagten Konzil selbst ein Laterankonzil in Rom ausschrieb und über die abtrünnigen Kardinäle den Fluch der Kirche aussprach, unterhandelte er dennoch wieder mit jedem einzeln und stellte lockende Propositionen, wenn sie nach Rom kommen und sich ihm anschließen wollten. Endlich knüpfte er in Bologna geheime Verbindungen an, um die Bentivogli durch einen Aufstand wieder hinauszutreiben.
Da plötzlich ein neuer Schlag. Mitte August eines Tages durchfliegt die Neuigkeit Rom, der Papst sei tot. Giulio lag krank und ohne Bewußtsein; man erwartete sein Ende. Die Kardinäle, statt nach Pisa zu ziehen, machten sich nach Rom auf. Dort aber versammelte sich das Volk auf dem Kapitol; Reden werden gehalten, endlich das verhaßte Priesterregiment ganz abzuschütteln und sich des alten Namens würdig als freie Nation zu konstituieren.
Es schien zu Ende mit der ewigen Herrschaft der Geistlichkeit. Man meint, damals hätte es nur eines kräftigen Fußes bedurft, um die alten, unauslöschlich glimmenden Kohlen des Vatikans nun für immer auszutreten. Der aber war ein Vulkan. Der Papst stand wieder frisch auf von seinem Krankenlager. Er schloß ein Bündnis mit Aragon und Venedig, das im Oktober 1511 publiziert wurde und dessen ausgesprochener Zweck der Schutz der eigenen Kirche war. Die durch das Pisaner Konzil drohende Trennung sollte verhindert, Bologna und Ferrara wieder erobert und diejenigen, die sich dem widersetzten, aus Italien vertrieben werden. Das waren die Franzosen, unter deren Schurze die Bentivogli und die Este standen! Die Losung der päpstlichen Partei war: Die Barbaren müssen aus Italien verjagt werden! eine Idee, die begeisternd auf das Volk wirkte und den Namen des Papstes mit erneutem populärem Glanze umgab. Das ist der Inhalt der berühmten Vertreibung des Heliodor aus dem Tempel, des Wandgemäldes im Vatikan, das Raffael in dem Jahre begann. Heliodor ist der König der Franzosen, der als Tempelschänder bestraft und davongetrieben wird, während gegenüber Giulio siegreich heranzieht. Wenn wir die Werke Raffaels so entstehen sehen, verlieren sie den Anschein von Allegorien, zu deren Verständnisse es Erklärungen bedarf. Raffael stand mit dem Papste mitten in den Ereignissen; ihre Darstellung durch seine Hand war kein gleichgültiger Schmuck eines gleichgültigen Palastes, sondern ein symbolisches Zusammenfassen dessen, was die Zeit im Moment am tiefsten bewegte und dem Volke verständlich war.
In demselben Oktober 1511 wurde in Rom das Konzil eröffnet. Giulio erwartete nur die spanischen Truppen um loszubrechen. Diesmal aber sollten nicht nur Bologna und Ferrara daran, sondern auch Florenz. Soderini hatte Pisa zum Versammlungsorte des ketzerischen Konzils hergegeben, Giulio die Stadt mit dem Interdikt belegt, der Gonfalonier aber an das ketzerische Pisaner Konzil selber appelliert und daraufhin die Florentiner Geistlichkeit gezwungen, ihre Funktionen weiter zu versehen. Nicht nur die beiden Soderini sollten den Verrat büßen, sondern auch die Bürgerschaft. Und dazu wählte der Papst ein empfindliches Mittel: er setzte ihnen die Medici, ihre alten Herren, wieder auf die Schultern. Giovanni, der Kardinal, wurde zum Legaten in Bologna ernannt und ihm die Befugnis erteilt, nach Wiedereroberung der Stadt gegen die Florentiner vorzugehen.
Soderini war im Jahre 1502 zum Gonfalonier auf Lebenszeit erwählt worden. Die aristokratische Partei, die früheren Arrabiaten, vereint mit den Pallesken, setzten ihn gegen die Popolaren, die früheren Piagnonen durch. Soderini war ein Verwandter der Medici, milde, aber gewiegt in den Geschäften, reich, alt und kinderlos. Sobald er im Amte saß, schlug er um. Man hatte auf seine mediceischen und aristokratischen Neigungen beiderseits gerechnet: mit einem Male stand er über den Parteien, und diejenigen, die ihn erhoben hatten, erfuhren bei ihm keine größere Berücksichtigung als die Popolaren, die sich der Wahl widersetzten. Mit Mäßigung und Versöhnlichkeit in der äußeren und inneren Politik ließ er den Zwiespalt der Bürgerschaft niemals zum Bruche kommen und verhinderte die Versuche der Medici, sich in die Stadt wieder einzuschleichen. Er war freundlich und sanft in seinem Wesen. Eine wohlerhaltene, nach dem Leben mit Farben bemalte Tonbüste auf dem Berliner Museum läßt ihn fast wie einen Lebenden erscheinen, so genau gibt sie seine Züge wieder. Es ist das edle Antlitz eines Mannes, dem allerdings mehr Güte und Geist innewohnen als heftige Energie, ein Mangel im Charakter Soderinis, den Machiavelli mit schonungslosem Spotte unsterblich gemacht hat. Als der Beschützer Leonardos und Michelangelos scheint er von beiden dennoch nicht besonders respektiert worden zu sein. Denn über Leonardo beklagt er sich heftig und zeiht ihn der Undankbareit, Michelangelo aber macht sich einmal sogar öffentlich über ihn lustig. Soderini sah sich den David an und meinte, an der Nase sei wohl noch etwas vom Steine fortzunehmen. Michelangelo sagt, »jawohl«, nimmt die Feile und zugleich etwas Marmorstaub in die Hand und, indem er an der Nase herumzuarbeiten schien, läßt er das weiße Pulver herabfallen, worauf sich der Gonfalonier sehr zufriedengestellt über den günstigen Effekt der von ihm angegebenen Verbesserung äußert.
Die Vornehmen sahen sich durch Soderinis unerwartetes Auftreten empfindlich getäuscht. Sie hatten mit seiner Wahl das Consiglio grande zu beseitigen gehofft, diese demokratische eine Kammer, wo die Stimmenmehrheit siegte und in der sie, obgleich nach Savonarolas Abgang ein strengerer Wahlmodus eingeführt wurde, sich ohne Mühe nicht behaupten konnten. Wiederum war ihre Hoffnung zunichte geworden, eine Aristokratie der reichsten Familie an die Spitze des Staates zu stellen. Deshalb, sobald Soderinis Abfall offenbar geworden war, begann er denen verhaßt zu werden, die ihn befördert hatten, und der ehrgeizige jüngere Adel der Stadt (die alten Compagnacci) nahmen eine feindselige Haltung ein und sannen auf Umsturz der Verfassung.
Diese Stimmung machten sich die Medici zunutze. Nach Pieros Tode war der Kardinal das Haupt der Familie, ein echter Medici seinem Charakter nach. Der Geist des alten Cosmo und Lorenzos lebte wieder auf in dem seinigen, und ganz in ihrem Sinne wurde von jetzt an gegen die Florentiner verfahren.
An gewaltsame Wiederherstellung der Dinge schienen die Medici gar nicht mehr zu denken. In Rom am Hofe Giulios residierte der Kardinal; freigebig und prachtvoll hielt er offenes Haus; wer aus Florenz kam und sich meldete, war wohl aufgenommen, und es bedurfte keines politischen Glaubensbekenntnisses, um sich als Freund der Familie zu legitimieren. Alle waren sie seine lieben Landsleute, vergessen die Streitigkeiten der Parteien und die Pläne Pieros. Der Kardinal wußte zu reden und zu schenken. Es kümmerte ihn kaum. daß das Vermögen der Familie stark auf die Neige ging.
Zu gleicher Zeit aber arbeiteten in Florenz seine Verwandten, vor allen seine Schwester Lucrezia, die, mit Jocopo Salviati vermählt, sich zum Mittelpunkte des gegen Soderini grollenden Adels machte. Denn schließlich müssen diese reichen Familien Adlige genannt werden, wenn auch Soderini mit Recht geantwortet hatte, als man gesagt, der Adel befinde sich schlecht in Florenz: »Wir haben keinen Adel hier, sondern nur Bürger; in Venedig gibt es Edelleute.« Auch steckte in der Tat hinter dem Namen des Adels nichts als Geld bei den Florentinern, denn keiner dieser großen Herren hatte Schlösser und Untertanen, über die ihm die Jurisdiktion zustand.
Der Name der Medici verlor den gehässigen Klang in Florenz. Sie waren nicht mehr die rachgierigen Feinde, die in Frankreich und Italien gegen die Stadt hetzten und wie Füchse um den Taubenschlag schlichen: mit dem Andenken Pieros verschwand die Furcht, eine neue Generation wuchs heran, die sich mehr an die glänzenden Tugenden Lorenzos als an die Fehler seines unglücklichen Sohnes erinnerte. Man sehnte sich nach den guten alten Zeiten, wo der Adel Teil hatte an der Macht eines für ihn rücksichtsvollen, aus seiner Mitte hervorgegangenen Oberhauptes, während man sich jetzt einem mit dem Volke kokettierenden Abtrünnigen unterordnen mußte –: man hätte die Medici zurückrufen mögen, nur um Soderini zu stürzen.
Die Ernennung des Kardinals zum Legaten in Bologna traf zur rechten Zeit ein. Sein Vermögen ging eben zu Ende, er hätte ohne diesen Posten das glänzende Leben nicht fortführen können. In Bologna ließ sich schon etwas zusammenbringen, so daß, wenn auch die Pläne auf Florenz fehlschlugen, die pekuniäre Hilfe eine gewaltige war. Im Sommer 1512 erschien Medici mit den spanischen Hilfstruppen vor Bologna und begann die Belagerung. Drin saßen die Bentivogli, der Herzog von Ferrara und Lautrec von seiten Frankreichs. Jetzt ging es der Statue Michelangelos übel. Am vorletzten Tage des Jahres 1511 erschien ein der Armee vorausgesandter Herold in der Stadt und verlangte sofortige Übergabe in so stolzen Ausdrücken, daß die Bentivogli ihn ins Gefängnis warfen und erst auf Zureden ihrer Freunde wieder losgaben. Die Bildsäule des Papstes aber wurde an diesem Tage herabgestürzt. Stroh und Faschinen waren darunter angehäuft, damit ihr gewaltiges Gewicht die Kirchentreppe nicht zerstöre. »Die schönste Statue Italiens« nennt sie eine bolognesische Chronik. Sie wurde in Stücke geschlagen, und der Kopf rollte über den Platz hin. Der Herzog von Ferrara bekam das Erz zum Eintausch gegen Kanonen, die er lieferte. Der Kopf allein, der sechshundert Pfund wog, blieb erhalten und war noch lange Zeit in Ferrara zu sehen. Das übrige wurde eingeschmolzen.
Am 26. Januar begann das Bombardement, zugleich wurden die Mauern mit Minen untergraben. Am 2. Februar aber gelang es Gaston de Foix, der aus der Lombardei mit französischen Hilfstruppen kam, so geheim in die Stadt einzuziehen, daß die Spanier draußen nicht eher von seiner Anwesenheit erfuhren, als bis er längst in den Toren war. Auf der Stelle beschlossen sie jetzt, die Belagerung aufzuheben. Am 6. zogen sie ab. Die Franzosen verfolgten sie, erbeuteten Pferde, Kanonen und Kriegsgerät und würden die Armee aufgerieben haben, wenn sie sich aus Besorgnis einer Kriegslist nicht zurückgehalten hätten.
Sobald sich Gaston de Foix nach diesem Erfolge jedoch in die Lombardei zurückwandte, wo er die Venezianer schlug, erschien der Kardinal wieder vor Bologna. Abermals zeigen sich auch die Franzosen, im März geschah das, abermals weichen die Spanier, de Foix hinter ihnen drein bis Ravenna. Dort kommt es am ersten Ostertage 1512 zu einer Schlacht, in der die Spanier glänzend geschlagen werden, der französische Oberbefehlshaber aber sein Leben verliert. Er war jung, schön und ritterlich, eine von den poetischen Gestalten jener Tage.
Diese Schlacht ist so berühmt geworden, weil so furchtbar in ihr gekämpft wurde. Die Spanier galten damals nach den Schweizern für die ersten Soldaten der Welt, es kostete den Franzosen ungeheure Anstrengung, den Sieg davonzutragen. Auf beiden Seiten war die Nationalehre im Spiel. Zehntausend Tote blieben auf dem Platze. Eine Anzahl vornehmer Spanier gerieten in französische Gefangenschaft. Der Kardinal Medici wurde von den Stradioten aufgebracht und dem Kardinal von San Severino überliefert, der gleich ihm, im Namen des Pisaner Konzils jedoch, Legat von Bologna war. Die ganze Romagna fiel den Franzosen zu, und wieder stand ihnen der Weg nach Rom offen.
Am 13. April langte die Trauerbotschaft dort an. Die Kardinäle stürzten zum Papste und beschworen ihn, den Frieden anzunehmen, denn nicht nur die siegreichen Feinde, sondern auch der römische Adel, die Colonna, Savelli und andere, die von Ludwig Geld empfangen hatten, drohten dem Papste unmittelbare Gefahr. Die Gesandten von Venedig und von Spanien widerriefen voreilige Entschlüsse. Giulio schwankte, er saß auf der Engelsburg, von den Kardinälen waren einige schon nach Neapel geflohen, da kam Giuliano dei Medici, der Vetter des gefangenen Kardinals, ein unehelicher Sohn des von den Pazzis ermordeten Giuliano, in Rom an und berichtete über die Plünderung Ravennas, zugleich jedoch brachte er die Nachricht, daß die Führer der Franzosen uneins unter sich, mit dem Kardinal von San Severino im Streite lägen und daß die Schweizer, um deren Gunst sich päpstliche, kaiserliche und königliche Gesandten abmühten, sich für den Papst entschieden hätten und in die Lombardei einzubrechen bereit wären. Wenn das erfolgte, stellte sich alles anders. Die französische Armee war dann im Norden notwendig, Bologna und die Romagna wieder mögliche Beute. Dennoch zögerte der Papst noch lange und zeigte sich geneigt, mit dem Könige von Frankreich zu akkordieren. Vielleicht nur ein Kunstgriff, um die Franzosen von Rom abzuhalten und völlig sichere Nachrichten aus der Schweiz abzuwarten. Endlich erfuhr er, die französischen Truppen seien nach dem Norden abmarschiert. Nun verschwand die Furcht und mit ihr der gute Wille gegen Ludwig. Die römischen Barone, die Geld vom Könige empfangen hatten und im Begriff waren, zu rebellieren, traten mit ihren Leuten in den Dienst des Papstes, der Krieg wurde neu aufgenommen und am 3. Mai das lateranische Konzil in Rom mit außerordentlicher Pracht eröffnet, während der Kardinal Medici in Mailand, wo er mehr wie ein Sieger als wie ein Gefangener eingezogen war, die Soldaten, welche gegen die heilige Kirche gestritten hatten, absolvierte. Giuliano dei Medici, der wieder bei ihm war, hatte die Vollmacht dazu mitgebracht. Die Sekretäre waren kaum imstande, die betreffenden Ablaßbriefe einzeln alle auszufertigen. So machte damals der rohe Stoff, mit dem man die Kriege führte, der gemeine, verachtete Söldner, die Fragen der hohen Politik abhängig vom religiösen Bedürfnisse seines kirchlich geschulten Geistes. Denn verbunden mit diesem Ablasse war ein Gelöbnis des Empfängers, gegen die Kirche keine Dienste mehr zu tun. Und dies geschah unter den Augen des Pisaner Konzils, das sich nach Mailand zurückgezogen hatte.
Bald erfolgte nun die Vereinigung der Schweizer mit den Venezianern. Maximilian gestattete den Durchmarsch durch Tirol. Die Franzosen zogen sich zurück. Es hieß, Mailand solle für die Söhne Sforzas, seine rechtmäßigen Herren, zurückerobert werden. Medici, der von der französischen Armee mitgenommen wurde, entkam, die ganze Lombardei bis auf wenige Plätze ging dem Könige verloren. Aus Genua entfloh der Gouverneur, und ein Fregoso wurde zum Dogen eingesetzt. Die französische Politik war wieder in eines jener Stadien eingetreten, wo sich Verluste auf Verluste häufen
An die glückliche Flucht des Kardinals erinnert das spätere Gemälde Raffaels in den vatikanischen Zimmern, das die Befreiung Petri aus dem Gefängnisse darstellt; an die Niederlage der Franzosen der von himmlischen Mächten aufgehaltene Heerzug Attilas, beides die ersten Wandgemälde, die Medici, nachdem er Papst geworden war, ausführen ließ.
Bologna war nun wehrlos. Der Herzog von Urbino rückte vor die Stadt, die Bürgerschaft bewog die Bentivogli fortzugehen; sie zogen mit tausend Pferden nach Ferrara ab, dessen Herzog, verlassen wie sie selber, einer bedenklichen Zukunft entgegensah. Der Papst erklärte sogleich alle Örter als dem Bann der Kirche verfallen, in denen die Bentivogli Aufnahme fänden. Bologna tat das Mögliche, Giulio zu besänftigen. Seine schimpflich zerschlagene Bildsäule aber konnte man nicht wieder herbeizaubern. Er war so wütend, daß er die Stadt von Grund aus zerstören und die Bürger auf einer andern Stelle ansiedeln wollte.
Indessen auch jetzt, wo er die Dinge so ganz zu beherrschen schien, durfte er nicht, wie er wollte. Der mächtigste Mann im Lande war der König von Spanien und Neapel, der seine Truppen für 40 000 Scudi monatlich dem Papste zur Verfügung ließ. Ihm mußte zugestanden werden, daß Ferrara unbelästigt bliebe. In Ferdinands Händen lag nun auch das Schicksal der Florentiner, gegen die der Kardinal Medici die spanische Armee zu gebrauchen wünschte.
In Mantua, wo ein Kongreß der bei der Unternehmung gegen Frankreich beteiligten Mächte stattfand, wurde Florenz verkauft. Maximilian wollte seine Krönungsfahrt nach Rom unternehmen, er brauchte Geld dazu und verlangte eine bestimmte Summe. Der König von Spanien mußte Geld haben, um seine Soldaten zu bezahlen. Die Medici boten reichlich an, was beide verlangten, wenn sie ihnen nur erst zum Besitze der Stadt verholfen hätten, der König mit den Truppen, der Kaiser mit seiner Autorität, denn Florenz war altes Reichslehn. Hätten die Florentiner selbst auf der Stelle diese Summen hergegeben, so wäre der König von Spanien mit dem Bleiben des Gonfaloniers und dem Fortbestande der Verfassung einverstanden gewesen, denn obgleich er dem Papste zum Sieg verholfen hatte, lag ihm jetzt nicht so sehr daran, dessen Macht in hohem Grade zu verstärken. Dem Kaiser konnte es vollends gleichgültig sein, woher das Geld käme, wenn es überhaupt nur kam. Der Kardinal Soderini war in Mantua und unterhandelte. In seinen Berichten drängte er seinen Bruder, sich zu entscheiden. Aber die Perfidie der Parteien machte dem Gonfalonier unmöglich, einen Entschluß herbeizuführen. Man ließ ihn im Stiche, und der Kardinal blieb ohne Anweisung.
Unterdessen fingen die spanischen Truppen an zu revoltieren. Den Raimondo di Cordona, der Befehlshaber, mußte auf jede Bedingung hin Geld zu schaffen suchen, um ihnen den Sold zu zahlen. Die Medici machten sich die zweifelhaften Umstände zunutze, und ehe der Kardinal Soderini in Mantua selbst nur ahnte, daß die Sache abgeschlossen sei, brach das spanische Heer über Bologna in Toskana ein, mit der offenkundigen Absicht, die Verfassung von Florenz zu stürzen und den Medici ihre alte Stellung wiederzugeben.
Es war unmöglich, den Spaniern eine Armee im freien Felde entgegenzusetzen. Kaum daß sich Lebensmittel in der Stadt fanden. Zeit und Geld indessen hätten die Gefahr abwendet, wären die Spanier draußen die einzigen Feinde gewesen. Die Partei der Aristokraten aber war die Herrin der Ereignisse. Mit einer Unbefangenheit betrieben sie ihre Sache, die nur bei dem überaus milden Charakter Soderinis erklärlich erscheint. Sie verhinderten jeden Entschluß im Schoße der Regierung; stellten die Lage der Dinge so dar, als sei es von den Medici nur darauf abgesehen, sich das Recht zu gewinnen, als bloße Privatleute die Stadt bewohnen zu dürfen. Der Gonfalonier wollte alles der Entscheidung des Volkes anheimgeben. In einer rührenden Rede sprach er über sich und seine Absichten, die Tränen stiegen ihm auf, er war ein alter Mann, der keine persönlichen Feinde hatte, den nicht der Ehrgeiz, sondern die Güte leitete. Er begehrte sein Amt niederlegen zu dürfen. Unter keinen Umständen wollte man das gestatten. Die Medici könnten zurückkehren, urteilte man; als Privatleute, ja, aber als mehr nicht. Man beschloß zu rüsten und mit den vorhandenen Mannschaften die kleinen Festungen um die Stadt und diese selbst zu verteidigen.
Die Volkspartei hatte bei diesen Entschlüssen scheinbar noch die Oberhand, ihrer Ausführung aber wußten die Pallesken lähmende Hindernisse in den Weg zu legen. Eine dumpfe Stimmung, ein Gefühl von Unsicherheit bemächtigte sich der Bürger, und all das bewegliche Auftreten des Gonfaloniers vermochte seinen Mangel an belebender Energie nicht zu ersetzen.
Cordona kam bis Prato, das, wenige Meilen von Florenz entfernt, besetzt und befestigt war. Weiter konnte er nicht vorwärts. Im Spätsommer bot das flache Land keinen Unterhalt, die Lebensmittel lagerten in Florenz und den kleineren Städten. Hunger und Krankheiten stellten sich ein. Cordona schlug mildere Saiten an: Soderini solle bleiben und der Bürgerschaft durchaus die Bestimmung der Bedingungen vorbehalten bleiben, unter denen die zurückkehrenden Medici Aufnahme fänden. Für sich begehre er eine mäßige Summe, nur um seine Soldaten zu bezahlen und das Land zu verlassen. Zu diesem Entschlusse trug der Umstand bei, daß König Ferdinand die Unterwerfung von Florenz immer mehr als eine zu starke Konzession an den Papst erachtete und zu zweifeln begann, ob er sie gestatten solle, eine Stimmung, die bald so sehr die Oberhand gewann, daß er Cordona den festen Befehl zukommen ließ, umzukehren und die Dinge in Toskana beim alten zu lassen.
Aber ehe diese letzten Entschließungen eintrafen, hatte Cordona gehandelt. Die Stadt verweigerte ihm Lebensmittel, deren er dringend bedürftig war. Baldasare Carducci, den der Gonfalonier ins spanische Lager geschickt hatte, schloß einen Akkord; die Pallesken in der Stadt aber verzögerten seine Annahme von seiten der Bürgerschaft. Cordona, in der übelsten Lage, versuchte einen Gewaltstreich, griff Prato, das in Florenz für uneinnehmbar gehalten wurde, unversehens an, stürmte es und gestattete den Soldaten die Plünderung. Furchtbar wurde da gewirtschaftet. Ein Schrecken durchlief Florenz bei dieser Nachricht wie damals nach den ersten Taten der Franzosen im Jahre 94. Auch jetzt hatten seltsame Gewitterschläge die drohende Zukunft vorausverkündet, auch diesmal herrschte die geistige Schwüle, welche die Haltlosigkeit des allgemeinen Zustandes bekundete, dazu kein Mann an der Spitze des Staates, der als natürlicher Rückhalt schwacher Geister dastand, und als höhnische Begleitung der großen Ratlosigkeit der steigende Übermut der Pallesken, die mit den Medici draußen im Lager in geheimem Verkehr das Zusammengreifen einer gemeinschaftlichen Politik verabredeten.
Die Eroberung von Prato änderte die Forderungen Cordonas sogleich. Geld und Lebensmittel hatten sich vorgefunden, auch verstand sich das naheliegende Pistoia, angesichts der Grausamkeiten, die von den Spaniern in Prato verübt worden waren, zu freiwilliger Lieferung dessen, was das Heer bedurfte. Florenz gegenüber begehrte man jetzt: Soderini fort; 50 000 Dukaten für den Kaiser; 50 000 für Cordona; 50 000 für die Armee. Die Medici dagegen verlangten immer noch nur das eine: ohne alle Vorrechte als einfache Privatleute in ihre Vaterstadt zurückkehren zu dürfen.
Hätte man rasch gezahlt, so wäre auch jetzt noch die Freiheit zu retten gewesen, denn den Spaniern kam es auf das Geld an; die mediceische Partei jedoch ließ es zu nichts Förderlichem kommen. Die Pallesken begannen bereits, persönlich die Stadt zu verlassen, und berieten mit Giuliano dei Medici, wie am besten zu verfahren sei. Am zweiten Morgen nach der Erstürmung von Prato drangen Bartolommeo und Paolo Valori, zwei energische junge Männer, denen ihrer großen Schulden wegen ein Umsturz der Dinge das Erwünschteste war, ins Zimmer des Gonfaloniers ein und stellten ihm die Wahl zu sterben oder sich auf die Flucht zu machen, wozu sie ihm behilflich sein wollten. Soderini hatte längst weichen wollen, seine Freunde aber verhinderten ihn, diesen Schritt zu tun, jetzt ließ er sich in das Haus der Vettori schaffen, die mit den Valori die Hauptanstifter dieses Planes waren, und von vielen Mitgliedern seiner Familie begleitet, mit einem Schutze außerdem von vierzig Bogenschützen, ritt er in der Nacht des 30. August davon. Seine ausgesprochene Absicht war, über Siena nach Rom zu gehen, wo der Papst ihm Schutz zugesichert hatte. Sein Bruder, der Kardinal, aber warnte ihn bei guter Zeit. Der Papst wollte ihn nur seiner Reichtümer wegen nach Rom in die Falle locken. Unterwegs schwenkte der Gonfalonier plötzlich von der Straße nach Rom ab und gelangte glücklich nach Ancona, von wo er über das Meer nach Ragusa ging.
Durch ihre Drohung, Soderini ein Leid anzutun, hatten die Freunde der Medici die Signorie dahin gebracht, am selben Tage noch den Gonfalonier für abgesetzt zu erklären. Die Stadt akkordierte mit Cordona; die Medici kehrten auf ihr ausdrückliches Begehren nur als Privatleute zurück; Florenz trat dem Bunde gegen Frankreich bei; der Kaiser erhielt 40 000, das spanische Heer 80 000 Dukaten, Cordona 20 000 zu eigener Verfügung. Bei der ersten Anzahlung verpflichtete er sich, das florentinische Gebiet zu räumen. Auch in betreff der mediceischen, vom Fiskus verkauften Güter wünschten die ehemaligen Herren nichts weiter, als daß ihnen gestattet sein sollte, sie innerhalb einer bestimmten Frist gegen bar zurückzukaufen.
Während über diese Bestimmungen verhandelt wurde und noch nichts abgeschlossen war, kam Giuliano dei Medici in die Stadt und durchritt, umgeben von seinen Anhängern, die Straßen. Dem Gesetz nach hätte man ihn töten dürfen, denn noch immer war er ein Verbannter. Bald erschien auch Cordona, von Paolo Vettori in das Consiglio grande feierlich eingeführt, wo er mitten unter den Signoren auf Soderinis leerem Sessel Platz nahm und in einer Anrede darauf drang, man solle durch geeignete Maßregeln die Stellung der Medici in der Stadt zu einer sicheren machen. Näher erklärte er sich nicht. Man nahm diese Worte mit ungünstigem Erstaunen auf, das Odium aber fiel mehr auf Vettori, durch den Cordona gleichsam in das Consiglio hineingedrängt worden war.
Ich erzähle diese Begebenheiten genauer, weil die Taktik der Medici aus ihnen mit so großer Deutlichkeit hervortritt. Immer bescheiden zurückstehen, immer andere vorschieben, nie etwas fordern, alles sich aufdrängen lassen und dabei die Dinge völlig in der Hand haben: so verfuhren sie. Besonders wichtig aber ist zu bemerken, wie sie das Mittel des Temporisierens anwenden. Sie kennen die Natur der Bürgerschaft genau, die lieber den ungesetzlichsten Boden für legal nimmt, sobald sich auf ihm bestimmte Propositionen regelrecht verhandeln lassen, als vor allen Dingen eine solide Basis zu fordern. Deshalb widersprechen die Medici selten und lassen die guten Leute reden und beschließen; wunderbar, wie man ihnen darauf hin gestattet, die eigentlichen Grundlagen des ganzen Zustandes umzuschaffen und nach Belieben einen neuen Bau aufzuführen.
Cordona hatte im Consiglio nichts zu tun und nichts zu reden, dennoch debattiert man seine Vorschläge. Es sollten eine Anzahl Bürger als Vertreter der Stadt gewählt und eine gleiche Anzahl von den Medicis genannt werden, die in Verbindung mit Cordona, der als unparteiischer Dritter dazwischenstände, diktatorische Gewalt erhielten, die Ämter frisch zu besetzen. Dies ein Vorschlag. Oder es sollte aus denen, welche bisher die höchsten Staatsämter bekleidet hätten, sowie aus fünfzig Bürgern, welche von den momentan fungierenden höchsten Kollegien zu ernennen wären, ein Senat erwählt werden. Auch möchte man acht junge Leute, denen das gehörige Alter fehlte, für amtsfähig erklären, um die guten Dienste einiger jüngeren Pallesken zu belohnen. Endlich, es sollte ein Gonfalonier auf ein Jahr mit vierhundert Dukaten Gehalt erwählt werden; und so weiter. Bei solchen Vorschlägen verging die Zeit. Im Consiglio grande wurde mit einer Majorität von drei gegen zwei ein Ridolfi zum Gonfalonier auf ein Jahr gemacht, ein naher Verwandter der Medici, aber zugleich ein Piagnone. Die Wahl erregte allgemeine Zufriedenheit. Unterdessen blieben die Spanier im Lande. Die Soldaten kamen häufiger in die Stadt. Auf Wagen brachten sie den Raub aus Prato herein und boten ihn feil. Das dauerte in den September. Am 15. abends sollte der Kardinal feierlich in den Palast der Signoren eingeführt werden. Die Herren versammeln sich und warten. Er bleibt aus. Man fängt an Unheil zu fürchten. Im Palast der Medici ist alles dunkel und still; man beruhigt sich. Am anderen Morgen aber kommen die Medici. Fremde und einheimische Freunde in Waffen umgeben sie, unter dem Geschrei palle! palle! ziehen sie auf den Platz. Oben sitzen die Signoren; Giuliano dei Medici tritt in den Saal, andere folgen ihm. Was er begehre. Nichts als seine Sicherheit verlange er! eine Antwort, die seine Begleiter im Chor wiederholen. Fragen und Antworten folgen jetzt rasch aufeinander. Das Parlament soll berufen werden, beschließt man.
Die große Glocke wird gerührt. Die Bürger kommen bewaffnet auf dem Platze zusammen. Die Feinde der Medici hüteten sich da wohl, draußen sichtbar zu werden. Die Signorie stand auf der Rednerbühne neben dem Tore des Palastes (dies war die erste Revolution, die der David des Michelangelo mitansah), Giuliano stand da auch, die große Fahne in den Händen, und die Fünfundzwanzig wurden gewählt. Die Fremden und Soldaten stimmten so gut mit wie die Bürger, denn die Truppen der Republik hatten sich von draußen alle in die Stadt gezogen, um sich den Medicis, den neuen Herren der Stadt, dienstwillig zu erweisen. Die Fünfundzwanzig annullieren das Consiglio grande, besetzen die Ämter neu und heben die eingeführte Nationalbewaffnung auf, eine Art Landwehr, bei deren Zustandekommen Machiavelli besonders beteiligt war. Der Regierungspalast erhält eine Besatzung spanischer Truppen unter Paolo Vettori. Im Palaste der Medici findet sich endlich die vertriebene Familie zusammen: die Stadt war auf die legitimste Weise unter ihre Botmäßigkeit zurückgekehrt. –
Es sind genug Briefe erhalten, um erkennen zu lassen, wie Michelangelo von Rom aus an allen Schicksalen Toskanas teilnahm. Ununterbrochen empfing er Mitteilungen von den Seinigen und gab Antwort. Im September, als die Dinge schlimm standen, war seine Meinung, sie sollten alles im Stiche lassen und nach Siena entfliehen, denn das Leben sei mehr wert als Besitz, und wenn ihnen Geld fehle, wolle er dafür sorgen.
Vierzehn Tage später, als die Medici eingezogen waren, erachtet er die Gefahr für beseitigt, die von den spanischen Truppen gedroht hatte. Nun dagegen ermahnt er Vater und Bruder wieder zur Sparsamkeit, denn wenn ihnen auch zu Diensten stehe, was er besitze, so gelte das doch nur für den äußersten Fall. Sie möchten still weiter leben und sich mit niemanden einlassen; niemanden weder Freundschaft noch Vertrauen zeigen, denn kein Mensch wisse das Ende, das diese Dinge nehmen könnten.
Unter solchen fortwährenden Kämpfen um das Geschick der Seinigen und des Vaterlandes malte Michelangelo an seinen Sibyllen und Propheten. Wiederum drängte der Papst auf Abschluß und wollte keinen Urlaub gestatten. Eines Tages erscheint er oben und wünscht zu wissen, wann Michelangelo denn endlich fertig sein werde. »Wenn ich kann«, antwortet dieser. »Du hast wohl große Lust, daß ich dich von dem Gerüst herunterwerfen lasse?« donnert ihn jetzt Giulio an. Michelangelo geht nach Hause und macht sich fertig, ohne weiteres abzureisen. Da stürzt der junge Accursio, der Lieblingspage des Papstes herbei, bringt fünfzig Scudi, entschuldigt den heiligen Vater, so gut es gehen will, und besänftigt Michelangelo, der nun auf einige Tage nach Florenz geht und sich dann zur Arbeit in Rom wieder einfindet. Condivi erzählt nicht genau, wann das vorfiel. Im September 1512 teilt Michelangelo seinem Vater mit: die Kapelle sei beendet und der Papst in hohem Grade zufriedengestellt. »Im übrigen«, fährt er fort, »gehen die Dinge nicht, wie ich wünschte, aber die Zeiten tragen Schuld, die unserer Kunst nicht günstig sind. Zu Allerheiligen werde ich diesmal nicht nach Florenz kommen können. Sorgt für euch selber, und kümmert euch nicht um die Sorgen anderer Leute.« Zu Allerheiligen 1512 wurde die Kapelle geöffnet, in welcher der Papst Hochamt hielt und wo wiederum ganz Rom zusammenströmte, um das vollendete Werk anzustaunen.
Dennoch war Giulio noch nicht zufrieden. Seine Ungeduld war schuld daran gewesen, daß Michelangelo die Malerei für fertig erklärt hatte, ehe die letzten Retouchen mit Ultramarin und Gold darauf angebracht worden waren. Jetzt sollte das Gerüst wieder aufgeschlagen und die Versäumnis nachgeholt werden. Michelangelo widersetzte sich. »Das seien keine Leute gewesen, die er da gemalt habe, welche Gold getragen hätten.« Aber es werde ärmlich aussehen, erwiderte Giulio. »Auch waren es ja nur Leute ohne irdisches Hab und Gut«, entgegnete Michelangelo, und die Sache unterblieb.
Dies ist das letzte, was Michelangelo für Papst Giulio arbeitete.
Neuntes Kapitel
1512-1525
I
Freilich wollte Giulio nichts wissen von Tod. Er trug sich mit politischen Plänen, als ständen ihm noch Dutzende von Jahren in Aussicht. Er hatte Siena dem Kaiser abgekauft für den Herzog von Urbino, das heißt Siena war altes kaiserliches Lehen, und Maximilian gab für eine bestimmte Summe den notwendigen Vorwand zum Kriege her. Giulio hatte ferner die Spanier zum Feldzuge gegen Ferrara im Solde. Er wollte die Medici wieder aus Florenz forthaben, weil sie sich dort so unabhängig gebärdeten; er wollte in Genua einen andern Dogen einsetzen: alles im Frühjahr 1513. Und doch lag er seit Weihnachten schon zu Bette. Aber es gibt Naturen, deren Energie die Schwäche des Körpers überwindet und Wachs in Stahl umschmiedet. Die letzten Taten des Papstes zeigen ihn als einen solchen Mann. Mitten aus dem Fieber hatte er sich vor kurzem noch in die Kälte des Winters gestürzt, das Volk von Bologna staunte, wenn er auf einem widerspenstigen Pferde dennoch fest durch die Straßen sprengte. Er wollte die Franzosen aus Italien haben: die Barbaren sollten fort, die ihn sein Leben lang in seinen Plänen aufgehalten, obgleich er ihre Hilfe benutzte; als Erlöser Italiens von äußeren und inneren Tyrannen erschien er sich selbst zu notwendig an seinem Platze, als daß ihn aus dieser sich nach frischen Taten sehnenden Kraft der Tod mit sich führen könnte. Am 21. Februar 1513 aber traf das Ende aller Dinge doch ein. Der Papst war wirklich tot diesmal und täuschte die Welt nicht wieder.
Bis zum Äußersten hielt er fest an seinen Herrschergedanken. Ich finde eine Ähnlichkeit mit Friedrich dem Großen in seinem Charakter, dessen Alter auch kein Abnehmen des Geistes bekundete, der wie Giulio eines Tages zerbrach, weil der einen Hälfte unseres Wesens nur beschränkte Dauerhaftigkeit zugemessen ist, und der eine Stirn voll kühner Gedanken zur Befreiung Deutschlands mit ins Grab nahm, zu denen sich lange kein Erbe meldete. Je mehr Giulio wagte, je treuer schien ihm das Glück, je heftiger ward er selber. Auch Friedrich wurde immer gewaltsamer mit zunehmenden Jahren. Sie lernten beide mehr und mehr, daß Handeln die einzige Art sei, die Dinge zu fördern, und daß rasches, blitzartiges Vorgehen die einzige Art zu handeln sein dürfe, endlich aber, daß das Glück oder das Schicksal, oder wie man die Macht nennen will, von der der irdische Ausgang der Dinge abhängig ist, dadurch zu einer fast dienenden Gewalt gemacht werde, daß man sie herausfordere und von vornherein als Bundesgenossin betrachte. Denn der allein darf handeln, der eine Ahnung hegt vom Gelingen seines Anschlags, und dem Unglücke geht der Zweifel an der eigenen Überlegenheit voran.
Wenn irgendein Mann den Geist Giulios zu begreifen fähig war, so ist es Michelangelo. Gleich nach dem Tode des Papstes, den man nun wohl seinen alten Freund nennen darf, nahm er die Arbeit am Grabmonument wieder auf. Bei seinem Leben hatte Giulio nicht wieder daran gewollt: in seinem Testamente aber war gesagt, Michelangelo solle das Werk fortführen.
Zwischen Michelangelo und den Erben des Papstes wurde den 6. Mai 1513 ein Kontrakt geschlossen, demzufolge das Werk in anderer Gestalt errichtet werden sollte. Das dafür angefertigte Modell ist nicht mehr vorhanden, aber im Kontrakte selber ist es beschrieben. Das Grabmal sollte nicht mehr frei in der Kirche stehen, sondern mit einer der schmäleren Seiten an die Wand anstoßen. Während die beiden unteren Stockwerke ziemlich der Darstellung entsprechen, die Condivi vom ersten Entwurfe gibt und die von der noch vorhandenen Zeichnung bestätigt wird, war für die dritte Etage ein an die Wand sich anlehnender Abschluß von bedeutender Höhe beabsichtigt. Deshalb auch wohl nennt Michelangelo das neue Projekt »größer« als das frühere, maggior cosa, eine Größe, die allerdings nur durch die Benutzung der Wand erzielt worden war. Ein Preis von 16 500 Kammer-Dukaten wurde festgesetzt. Soviel Bronzeteile sollten dabei in Anwendung kommen, daß Michelangelo seinen Bedarf dafür auf mehr als 200 Zentner Metall berechnete.
In den Jahren 1513 bis 1516 sehen wir ihn dieser Arbeit zumeist hingegeben. Er ließ die Blöcke aus seiner Werkstätte am Vatikan weit herüber zum Macel dei Corvi schaffen, unweit des Kapitols, wo viele Bildhauerwerkstätten lagen und wo er ein eigenes Haus inne hatte, das er bis zu seinem Tode bewohnt hat. Auch bot dieser Umzug den Vorteil, daß er aus der ungesunden leoninischen Vorstadt in einen der gesündesten Teile Roms versetzt wurde.
Ich nehme an, daß er anfangs mit dem Moses vorzüglich beschäftigt war, obgleich die Statue nach dieser Zeit noch vierzig Jahre in seiner Werkstatt blieb. Es ist als wäre diese Gestalt die Verklärung all der gewaltigen Leidenschaften, die die Seele des Papstes erfüllten, das Abbild seiner idealen Persönlichkeit unter der Gestalt des größten, gewaltigsten Volksführers, der jemals eine Nation aus der Knechtschaft zu eigener Stärke wieder emporgebracht.
Wer die Statue einmal gesehen hat, dem muß ihr Eindruck für immer haften bleiben. Eine Hoheit erfüllt sie, ein Selbstbewußtsein, ein Gefühl, als ständen diesem Manne die Donner des Himmels zu Gebote, doch er bezwänge sich, ehe er sie entfesselte, erwartend ob die Feinde, die er vernichten will, ihn anzugreifen wagten.
Er sitzt da, als wollte er eben aufspringen, das Haupt stolz aus den Schultern in die Höhe gereckt, mit der Hand, unter deren Arme die Gesetzestafeln ruhen, in den Bart greifend, der in schweren Strömen auf die Brust sinkt, mit weit atmenden Nüstern und mit einem Munde, auf dessen Lippen die Worte zu zittern scheinen. Ein solcher Mann vermochte wohl ein empörtes Volk zu dämpfen und wie ein wandelnder Magnet es mitten durch die Wüste und durch das Meer selber sich nachzuziehen.
Was bedarf es der Nachrichten, der Briefe, der Rechnungen, der Urkunden über Michelangelo, wenn wir ein solches Werk besitzen, dessen jede Linie ein Schriftzug seines Geistes ist?
Der Moses ist die Krone der modernen Skulptur! Nicht allein dem Gedanken nach, sondern auch in Anbetracht der Arbeit, die, von unvergleichlicher Durchführung, sich zu einer Feinheit steigert, die kaum weiter getrieben werden könnte. Welch ein Paar Schultern mit den Armen daran! Welch ein Antlitz! Die drohend sich zusammenballenden Stirnmuskeln, der Blick, als überflöge er eine ganze Ebene voll Volkes und beherrschte es, die Muskeln der Arme, deren unbändige Kraft man empfindet! Was meißelte Michelangelo in diese Gestalt hinein? Sich selbst und Giulio: beide scheinen sie drinzustecken. All die Kraft, die Michelangelo besaß, unverstanden von der Welt, zeigte er in diesen Gliedern, und die dämonisch aufbrausende Gewaltsamkeit Giulios in seinem Antlitz. Man fühlt, wie Ulrich von Hutten von diesem Papste in bewundernder Ironie sagen konnte, er habe den Himmel mit Gewalt stürmen wollen, als man ihm oben den Eintritt verweigerte.
Sicher wissen wir, daß Michelangelo im ersten Jahre Papst Leos auch an einem der beiden gefesselten Jünglinge arbeitete, welche damals noch für das Grabmal bestimmt, später, als die Maße verkleinert wurden, als zu kolossal fortblieben und nach Frankreich kamen. König Franz schenkte sie dem Connetable von Montmorency, der sie als äußerlichen Schmuck seines Schlosses in Ecouen aufstellte. Von dort brachte sie der Kardinal Richelieu in eins seiner Schlösser von Poitou, seine Schwester sie in späteren Zeiten nach Paris, 1793 wurden sie dort öffentlich verkauft und für das Museum des Louvre erstanden, in dem sie heute befindlich sind.
Die eine dieser beiden Statuen ist es, die als Gegensatz des Moses angeführt werden soll, damit es nicht den Anschein habe, als ob die Bewunderung dieses Werkes zugleich alles erschöpfte, was bei Michelangelo im höchsten Sinne bewundert werden kann: die Darstellung des Großen, Überwältigenden, Furchtbaren, des terribile mit einem Wort. Vielleicht ist die zarte Schönheit dieses sterbenden Jünglings noch durchdringender als die Gewalt des Moses.
Persönliches Gefühl kann hier allein den Ausschlag geben. Wenn ich ausspreche, daß sie für mich das erhabenste Stück Bildhauerarbeit ist, das ich kenne, so tue ich das in Erinnerung an die Meisterwerke der antiken Kunst. Der Mensch bleibt immer beschränkt. Es ist unmöglich, im weitesten Leben alles vor Augen zu haben, und das, was man gesehen hat, stets in der besten, würdigsten Stimmung betrachtet zu haben. Allein es gibt ein unbewußtes Wiederkäuen dessen, was man erlebte, neben dem bewußten Genusse der Betrachtung, und was als endliches Resultat dieser willenlos arbeitenden Tätigkeit in der Seele zurückbleibt, ist es am Ende, worauf man sich allein als auf das Resultat der Erfahrung berufen kann. Frage ich mich, welches Werk der Skulptur nennst du zuerst, wenn das beste genannt werden soll, so liegt auf der Stelle die Antwort da: den sterbenden Jüngling des Michelangelo.
An Unschuld in Auffassung der Natur lassen sich mit dieser Gestalt nur die besten griechischen Arbeiten vergleichen, in denen sich ebenfalls keine Spur von Schaustellung dessen, was man zu schaffen imstande sei, sondern der einfachste angemessenste Ausdruck der Natur darbietet, wie sie der Künstler empfand und sich allein zur Freude nachbilden wollte. Welches Werk eines antiken Meisters aber besitzen oder kennen wir, das uns so nahe stände als dieses, das uns tiefer in die Seele griffe wie diese Verklärung des höchsten und letzten menschlichen Kampfes in einer eben erblühenden Männergestalt? Dieser äußerste Moment zwischen Leben und Unsterblichkeit, dieser Schauder des Abschieds zugleich und der Ankunft, dies Zusammensinken kraftvoller, jugendlicher Glieder, die, wie ein leerer, prachtvoller Panzer, gleichsam von der Seele fortgestoßen werden, die sich emporschwingt, und nun, indem sie ihren Inhalt verlieren, ihn dennoch so ganz noch zu umhüllen scheinen.
Mit einem über die Brust unter den Achseln herlaufenden Bande ist er an die Säule gefesselt, es schwinden ihm eben die Kräfte, das Band hält ihn aufrecht, er hängt beinahe darin, die eine Achsel wird emporgezwängt, zu der der rückwärts sinkende Kopf sich seitwärts hinneigt. Die Hand dieses Armes ist auf die Brust gelegt, der andere erhebt sich eingeknickt hinter dem Haupte in der Stellung, wie man im Schlafe den Arm zu einem Kissen des Kopfes macht, und ist so am Gelenk angefesselt. Die Knie, dicht aneinander gedrängt, haben keinen Halt mehr; keine Muskel ist angespannt, alles kehrt in die Ruhe zurück, die den Tod bedeutet. –
Die Räume, welche im Berliner Neuen Museum für die Gipsabgüsse bestimmt sind, bestehen aus aneinanderstoßenden Sälen, welche, mit den Erzeugnissen griechischer Kunst beginnend, bis auf die der heutigen Zeit führen. Tritt man aus der Mitte der griechischen Werke unter diejenigen, welche in den Zeiten der römischen Kaiser von den Nachkommen jener ältesten Generationen griechischer Künstler gearbeitet worden sind, so kann man sich des Eindruckes der Kälte und der kühlen Eleganz nicht erwehren, die an die Stelle des herzlichsten Zusammenhanges mit der Natur und der unschuldigen Grazie getreten sind. Jene späteren spekulierten auf das unfreie römische Publikum, die Griechen dachten an das eigene freie Volk. Die griechischen Werke atmen eine in sich zufriedene glückliche Kräftigkeit aus, die römischen den künstlichen Parfüm vollendeter Virtuosität: es sind Leistungen, siegreiche Lösungen schwieriger Aufgaben, das Gefühl aber mangelt, daß der Künstler, der hier formte, sich seinem eigenen Herzen zu genügen sehnte. Seine Statuen waren nur die verhüllenden Ornamente des toten Mauerwerks, aus dem die römische Gesellschaft in den Tagen der Kaiserherrschaft gebaut war.
Dagegen die Griechen! Ich betrachte, von Figur zu Figur fortschreitend, den Festzug des Parthenonfrieses: die sprengenden Reiter, – wie die Verse eines herrlichen Gedichtes scheinen sie dahinzufluten! – die Jünglinge, welche die Stiere führen, die Jungfrauen mit den Gefäßen: es liegt viel Zeit zwischen heute und damals, aber ich glaube mitten unter dem Volke gelebt zu haben, und erst, wenn ich zu den Römern komme, drängt sich das Gefühl der Vergangenheit wieder auf.
Dieser Unterschied zwischen griechischer und römischer Kunst wiederholte sich in den modernen Zeiten. Wir erblicken die ersten Bemühungen des Mittelalters: unbehilfliche Anfänge, die sich zu der vollendeten Technik der antiken Meister ähnlich verhalten wie die ältesten Werke der Griechen vielleicht zu denen der Ägypter, die seit undenklichen Jahren freie, aufs feinste der Natur nachgearbeitete Skulpturen lieferten. Eine seltsame Mischung eingentümlicher Nachbildung des Lebendigen und bewußter Benutzung der in den Überresten der antiken Kunst gebotenen Vorbilder tritt uns in den Werken der ältesten Italiener entgegen. Immer umfangreicher wird dann die erneute Bekanntschaft mit den aus den Tiefen der Erde wieder ans Licht gezogenen Skulpturen der Alten, die hier wie eine verlorengegangene Schöpfung götterartig jetzt über dem stehen, was man aus eigener Kenntnis zu schaffen vermag; zugleich aber, im Kampfe mit der sich hingebenden Nachahmung, ein immer erneuter, immer glücklicherer Anschluß an die Natur. Ghiberti sehen wir sich fügsamer den Alten unterordnen, Donatello widerstrebender, endlich in Michelangelo die Versöhnung beider Richtungen, und durch den Hinzutritt der eigenen Kraft aus allem, was bisher geschehen war, die Blüte einer neuen Kunst, die über die vorher geschaffenen Werke größere hinstellt.
Wie die Meister der alten Griechen arbeitete Michelangelo als Mitglied eines schönen mächtigen Volkes zu dessen Verherrlichung. Im Herzen den noch ungebrochenen Stolz auf die Freiheit des Vaterlandes, sah er sich von Männern umgeben, welche dachten wie er, und einen Fürsten sich zur Seite, dessen Devise die Wiederherstellung der Freiheit von Italien war.
So wahrhaft die für das Grabmonument dieses Mannes bestimmte Statue des Moses seinen Willen, seine Kraft und seine Sehnsucht zum Ausdruck bringt, ebenso wahrhaftig ist auch die Gestalt des sterbenden Jünglings kein bloßes Symbol geblieben: mit dem Tode Giulio des Zweiten starben die Künste hin. Nach ihm kam kein Fürst mehr, der würdige Aufgaben für große Künstler zu ersinnen vermochte, und keine Zeit der Freiheit brach ein in irgendeinem Lande, durch die den Werken der bildenden Kunst jener letzte Schimmer der Vollendung und großartiger, hinreißender Inhalt allein verliehen werden kann.
II
Das Emporkommen der Medici in Florenz und in Rom brachte Michelangelo die doppelte Aufgabe, nicht nur als römischer Künstler mit Papst Leo, sondern auch als Florentiner Bürger sich mit den neuen Gebietern von Florenz gut zu stellen.
Denn als Künstler blieb ihm in Florenz nichts mehr zu tun. Von den alten unerledigten Aufträgen hatte er sich frei gemacht. Die zwölf Apostel für Santa Maria del Fiore waren schon 15I2 unter eine Anzahl jüngerer Bildhauer verteilt worden, die sie im Laufe der nächsten zehn Jahre zustande brachten. Von der kolossalen Statue für den Platz am Regierungspalaste war keine Rede mehr. Ebensowenig von der Malerei im Saale des Consiglio grande. Soderini war ja fort, das Consiglio aufgehoben und der Saal, seiner früheren Würde entkleidet, absichtlich zum Aufenthalte von Soldaten erniedrigt, deren an die Wände anstoßende Piken vielleicht die Schuld trugen, daß Leonardos bereits vollendetes Werk zu verschwinden begann.
Über beide berühmte Kartons muß hier noch ein Wort gesagt werden.
Fest steht, daß sie zerstört und verschwunden sind, nachdem sie eine kurze Reihe von Jahren als Musterdenkmal gleichsam dessen, was die florentinische Kunst zu schaffen vermochte, Leonardos Werk im Saale der Päpste, Michelangelos Karton im großen Saale des Regierungspalastes aufgestellt gewesen waren. Eine ganze Reihe heranwachsender Künstler zeichnete vor ihnen und empfing aus ihren Linien die ersten Eindrücke. Einer von diesen jungen Leuten wird von Vasari des Verbrechens angeklagt, Michelangelos Karton böswillig zerschnitten zu haben. Und zwar soll die Tat im Jahre 1512 begangen worden sein, in jenen Tagen der Unruhen, als niemand für die Werke der Kunst Zeit und Gedanken übrig hatte.
Bandinelli ist sein Name. Wir kennen ihn aus Cellinis Lebensbeschreibung, der auf genügende Weise dafür gesorgt hat, den unausstehlichen Charakter dieses Bildhauers zu verewigen. Vasari urteilt nicht besser über ihn. Beides aber könnten die Erzählungen neidischer Kunstgenossen sein. Doch es ist eine lange Folge von Bandinellis eignen Briefen erhalten, hinreichend, den neidischen, falschen, verleumderischen Geist und die alberne Eitelkeit des Mannes offenbar zu machen. Dazu treten seine geschmacklosen Werke noch. Nur eins muß man ihm lassen: unermüdliche Arbeitsamkeit; und von einem Verbrechen dürfen wir ihn freisprechen, mögen auch die anderen Niederträchtigkeiten wahr sein: er kann den Karton des Michelangelo im Jahre 1512 nicht zerschnitten haben.
Vasari erzählt allerdings ganz genau, wie Bandinelli sich den Schlüssel verschafft, wie er als ein Anhänger der Leonardoschen Partei Michelangelo gehaßt und beneidet habe, und was die Stadt dazu gesagt, nachdem die Tat begangen war. Aber es ist gelogen. Vasari zeigt sich erbärmlich bei dieser Gelegenheit. In der ersten Ausgabe seines Buches findet sich Bandinellis Leben nicht. In dem Michelangelos wird da nur gesagt, der Karton sei im Jahre 1517, als der Herzog Giuliano im Sterben gelegen und niemand Zeit gehabt hätte, sich darum zu kümmern, zerschnitten worden; die einzelnen Stücke seien verlorengegangen. Als die zweite Ausgabe des Bandes erschien, war Bandinelli inzwischen gestorben, und seine Biographie wurde den andern beigefügt. Hier nun erscheint in Bandinellis Leben die Anklage, daß er 1512, als in Florenz alles drüber und drunter ging, in den Saal des Palastes geschlichen sei und den Karton zerschnitten habe, während zugleich im Leben Michelangelos die alte Angabe von dem, was 1517 vorgefallen sei, von Vasari gedankenlos wiederholt wird.
Also in demselben Buche schon ein Widerspruch. So stark aber war der Eindruck von Bandinellis unerträglichem Wesen, daß man die Anklage als begründet angenommen und was für ihn zu sagen war, außer acht gelassen hat. Zwei Umstände sprechen ihn frei. Erstens Condivis Schweigen. Condivi sagt, der Karton sei verloren gegangen, man wisse nicht wie. Hätte Bandinelli die Tat begangen, Condivi (Michelangelo selbst also) würde sie wenigstens angedeutet haben. Zweitens aber gibt uns Benvenuto Cellini selbst das Mittel an die Hand, noch schärferen Gegenbeweis zu führen.
Cellini erzählt, wie er sich erst im Jahre 1513 ernstlich entschieden habe, bei der Goldschmiedekunst zu bleiben; wie er darauf in Siena, Bologna und Pisa gearbeitet und endlich, nach Florenz zurückgekehrt, vor dem Karton des Michelangelo und dem Leonardos gezeichnet habe. Dies muß also notwendigerweise noch 1513 gewesen sein. Hätte Bandinelli aber statt 1512, 1517 die Tat begangen, so wäre auch Cellini nicht der Mann gewesen, sie unerwähnt zu lassen, denn er haßte Bandinelli wie Gift und verehrte Michelangelos Karton als das Höchste, was jemals von diesem geschaffen worden sei.
Diese böse Erinnerung also brachte die Rückkehr der alten herrschenden Familie für Michelangelo nicht mit sich. Überhaupt scheint er das abermalige Emporkommen der Medici zu jener Zeit nicht mit ungünstigen Augen betrachtet zu haben.
»Teuerster Vater«, hatte er nach dem Wiedereintritte der ehemaligen Herren in die Stadt an den alten Lodovico geschrieben, »in Eurem letzten Briefe steht, ich möchte kein Geld bei mir im Hause halten und keins bei mir tragen, und dann, es sei bei Euch darüber gesprochen worden, daß ich mich in ungünstiger Weise über die Medici geäußert hätte. Was das Geld anbelangt, so liegt, so viel ich davon habe, in der Bank bei den Balduccis, und ich führe bei mir zu Hause oder in der Tasche nur, was ich zu den täglichen Ausgaben bedarf. Was die Medici anlangt, so habe ich niemals gegen sie gesprochen, es sei denn, wie alle Welt über sie geurteilt hat. So zum Beispiel über das, was in Prato geschehen ist. Darüber aber würden die harten Steine geredet haben, wenn sie Stimme hätten. Und in der Art ist viel über sie gesagt worden, was ich gehört und wiederholt habe: ob es wahr sei, daß sie so auftreten und so übel wirtschaften; doch will ich nicht sagen, daß ich es geglaubt hätte, und Gott gebe, daß es gelogen sei. Vor vier Wochen aber hat jemand, der sich meinen besten Freund nannte, sehr stark bei mir gegen sie losgezogen, ich verbat mir das jedoch und sagte ihm, es sei nicht recht so zu reden, und er möge stillschweigen. Es wäre doch gut, wenn Buonarroto unter der Hand herausbrächte, von wem man die Angabe haben will, daß ich gegen die Medici gesprochen, ich könnte dann nachforschen, ob es von einem von denen kommt, die sich so freundschaftlich an mich heranmachten, und kann mich in Zukunft vorsehen. Ich bin gegenwärtig ohne Arbeit und warte ab, daß mir der Papst einen Auftrag gebe.«
So hatte Michelangelos Meinung Ende 1512 oder Anfang 1513 gelautet, als Papst Giulio noch lebte. In dem Maße aber, als die Medici sich mehr und mehr in ihrer alten Heimat festsetzten, kehrte größeres Vertrauen zu ihnen zurück, und Michelangelo, der in ihrem Hause aufgewachsen war und sie alle persönlich kannte, hatte keinen Grund. sich auf Seiten ihrer Gegner zu stellen.
In der Tat benahmen sich die Medici unter der Leitung des Kardinals so gut, daß selbst ihre Feinde ihnen die Anerkennung nicht versagen konnten, es werde von ihnen in altgewohnter, vollendeter Staatsweisheit die richtige Mitte innegehalten.
Sie verfuhren als ausgelernte Kenner des florentinischen Naturells. Die Stellung, die ihnen bei ihrem ersten Auftreten gegeben worden war, erschien bald nur als das Resultat der drängenden Aufforderungen Cordonas, denen sich nicht ausweichen ließ; der Staatsstreich und die Berufung des Parlamentes als Gewaltmaßregeln, zu denen sie die Uneinigkeit des Consiglio grande geradezu gezwungen hatte; das Nachfolgende war das Werk der freien Bürgerschaft gewesen. Die spanischen Truppen führten freilich fünfhundert Gefangene, Männer und Weiber, mit sich fort und brandschatzten das Land, eine greuliche Bande diese Armee, mit Türken und allem möglichen Gesindel darunter, an barem Gelde hatten sie von Florenz allein 150 000 Dukaten bezogen, das abgerechnet, was Lucca und Siena zahlten, um sich loszukaufen, aber die Medici waren es, die ihren Abzug vermittelten, während die Soderini ja daran schuld gewesen, daß sie ins Land kamen! Denn der Kardinal Giovanni hatte nur als Legat den Befehlen des Papstes gehorcht, Giulio dei Medici nichts getan, als den Pallesken in Florenz guten Rat gegeben, Giuliano diente beim Heere, und Lorenzo, Pieros Sohn, für den die Stadt eigentlich erobert wurde, hatte sich gar nicht bei den Ereignissen beteiligt. Dieser stellte sich dann erst ein, als alles abgemacht war, und betrat die Stadt als ein Jüngling, der von nichts gewußt und zu nichts verholfen hatte.
Begnadigungen der verurteilten Bürger waren die erste Handlung der Medici. Anhänger der Soderini, die in äußerster Furcht schwebten, wurden persönlich aufgesucht, mit Versicherungen der Hochachtung beruhigt oder gar in Schutz genommen; die Verbannung der Soderini in der mildesten Form ausgesprochen. Der Gonfalonier sollte auf fünf Jahre Ragusa nicht verlassen dürfen, die anderen kamen mit zwei Jahren durch. Es handelte sich ja nur um die Sicherheit des Staates; die Medici dachten nicht daran, Rache zu nehmen.
Zu gleicher Zeit die Entfaltung äußerlichen Glanzes. Giuliano und Lorenzo errichteten zwei Verbindungen junger reicher Leute zum Zwecke öffentlicher Vergnügungen. Die Gesellschaft Giulianos hieß die compagnia del diamante, weil der Diamant das Zeichen Lorenzos, seines seligen Vaters, gewesen war, während die compagnia del broncone, Lorenzos Schar, das Symbol des verstorbenen Piero, einen Zweig, führte. Diese beiden verherrlichten den Karneval des Jahres 13. Während Papst Giulio zu Rom im Sterben lag, bezeichneten prachtvolle Feste das erneute Aufblühen der Medici in Florenz. Das sind die romantischen Zeiten, von denen Vasari so gern spricht, der damals geboren wurde und in seinen Kinderjahren sich erzählen ließ, welch eine pompöse Rolle die Florentiner Künstlerschaft dabei spielte.
Hinter dieser Delikatesse und Zurückhaltung aber lauerte die äußerste Vorsicht, und wo diese besorgt zu werden begann, griff unter dem Sammetmantel hervor eine Tatze mit scharfen Krallen, die keine Rücksicht kannte. Die Partei der Pallesken begann sich zu sondern, nachdem die Medici endlich wieder oben saßen. Unter den Soderinis war es gleichsam Mode geworden, Palleske zu sein, mehr aus Opposition gegen den halb demokratischen Gonfalonier als aus Anhänglichkeit an die verflossene Herrschaft der seit beinahe zwanzig Jahren vertriebenen Familie. Nun war sie wieder da und Soderini fort, die eine Gewalt ersetzt durch die andere: die alten Arrabiaten, die weder die Demokratie noch die Medici, sondern sich selbst oligarchisch an der Spitze der Dinge sehen wollten, fingen an in der Stille zu wühlen. Die Capponi, Albizzi und die alten Erbfeinde, die nach Vertreibung Pieros rehabilitierten Pazzi, waren die Häupter der Opposition. Gleich anfangs hatten sie die Berufung des Parlaments zu hindern gesucht, jetzt verdichtete sich die allgemeine Unzufriedenheit zu einer Verschwörung.
Diese wird entdeckt. Und nun Kerker, Tortur, Hinrichtungen, Verbannungen. Die Medici zeigen sich hier so unerbittlich, daß einer von den Valoris, einer Familie, von der der Umschwung zu ihren Gunsten hauptsächlich ausgegangen war, nur deshalb erst zum Tode, dann zu ewigem Gefängnis verurteilt wird, weil er die Anträge der Verschworenen abgelehnt hatte, ohne sie zu denunzieren. Unter den gefänglich Eingezogenen befand sich auch Machiavelli, der, durch Soderinis Abgang aus seiner amtlichen Tätigkeit herausgerissen, zu den Unzufriedenen gehörte. Glücklicherweise wurde der Kardinal Medici bald zum Papste gewählt: Leo der Zehnte. Nun fühlte man sich sicherer und behandelte die Gefangenen milder, bis endlich die Amnestie erfolgte.
Die Verschwörung fällt in Papst Giulios letzte Tage, die Wahl Medicis auf den 11. März. Einstimmig wurde er gewählt, und wer es am meisten betrieben hatte, war der Kardinal Soderini, mit dem man sich versöhnte. Gleich nach des neuen Papstes Thronbesteigung wurde auch der Gonfalonier aus Ragusa nach Rom berufen und freundschaftlich empfangen. Ein Jubel herrschte in Rom, wie er seit den Tagen der alten Kaiser nicht erlebt war, und in Florenz nicht minder, wo durch die Ehre, die der Stadt mit dieser Wahl widerfuhr, alles ausgelöscht schien, was man gegen die Medici auf dem Herzen hatte. Leider lesen wir, daß die habsüchtige Kaufmannsnatur des Volkes den größten Anteil an dieser Zufriedenheit trug, denn jedermann hoffte durch den Papst emporzukommen und Geld zu verdienen. Eine Art Raserei von Servilismus beherrschte plötzlich die Gemüter; überall wurden die alten Wappen der Stadt, die roten Kreuze, welche die Freiheit bedeuteten, herabgerissen und die mediceischen Kugeln an deren Stelle gesetzt; in Rom drängte sich halb Florenz in den Vatikan und küßte dem Papste die heiligen Füße. Leo äußerte ziemlich verachtungsvoll, nur zwei Leuten sei er begegnet, die es gut mit der Stadt gemeint und ihm die Wahrung ihrer Freiheit ans Herz gelegt hätten: der eine, ein als öffentlicher Narr bekannter armer Teufel, und der andere, Soderini, der Gonfalonier, der, in Rom bis an sein Ende lebend, diesen Titel fortführte.
Die Freiheit schien aber auch in der Tat ein unmöglicher Besitz für die Florentiner geworden zu sein. Denn sogleich wurden nun von den Medicis die alten Pläne, die schon die Borgias hegten, wieder vorgenommen. Ihren Gedanken nach zerfiel Italien jetzt in zwei Königreiche: Neapel, das Giuliano haben sollte, und die andere, nördliche Hälfte der Halbinsel, mit der Hauptstadt Florenz, als die Beute Lorenzos. Ganz ebenso hatte Alexander der Sechste einst das Land unter seine Söhne zu teilen gehofft, jetzt lenkte Leo mit der Kraft eines Mannes, der von Jugend auf für seine große Rolle eingeübt worden war, ein in die Spuren dieser Vorgänger.
Der neue Herr glich dem verstorbenen wenig. Leo der Zehnte war ein Mann von Geschmack und Bildung, liebte geistreiche Leute und fand sein Behagen in verschwenderischem Geldausgeben, aber er wäre in Sachen der Kunst nicht imstande gewesen, die großen Meister zu wählen wie Giulio, hätte nicht wie dieser gesagt, dies kann Michelangelo allein, dies Raffael leisten. Musik war seine Leidenschaft, allerlei Narrheiten und Witze sein unentbehrlicher Zeitvertreib. Schlau und rücksichtslos in politischen Dingen, erreichte er viel, aber seine Erfolge scheinen ärmlich den Taten Giulios gegenüber. Fett, mit gewaltigem Oberkörper und schwammig riesenhaft geschnittenen Gesichtszügen, stand er auf schwächlicheren Beinen, seine blöden, kurzsichtigen Augen drangen froschartig vor, die dicken Lippen packten wie zwei Fäuste ineinander: wie anders die tiefliegenden, durchdringenden Blicke Giulios und dessen energischer Mund mit den eingebohrten, dreieckigen Winkeln. Leo des Zehnten Bild von Raffael ist geschmeichelt; auf Münzen und Medaillen erscheint er weniger geistig in seiner ganzen wanstartigen Fülle. Wenn man dieses gedunsene, große Gesicht sieht und sich denkt, wie der Papst mit einer Brille auf der Nase mitten unter schmeichelnden Musikern die erste Stimme singt, wie er, ewig in Transpiration und mit den von Ringen blitzenden Händen, auf deren Schönheit er eitel war, herumkokettierend, über die Späße seiner Tischgesellschaft lacht, wie er einem wackeren, weitgereisten deutschen Edelmanne Audienz gibt, der ihm, nach abgetanem Fußkusse sich aufrichtend unter die Nase stößt, so wird er fast lächerlich; ekelhaft sogar, wenn wir von seinen Krankheiten lesen; – Raffaels bloßes Dasein aber macht alles wieder gut, er erhebt den Papst und ganz Rom in eine ideale Sphäre.
Wie der Geist Shakespeares die Zeit der Königin Elisabeth mit einem Firnis überglänzt, der das unscheinbarste frisch und neugiererregend macht, so verleiht die Gegenwart Raffaels dem Hofe Leo des Zehnten den Anstrich jugendlicher Anmut. Es ist als hätte sich das sonst trübe hinfließende Gewässer des Lebens in lauter sonnenblitzende Springbrunnen verwandelt. Raffaels Porträt des Papstes, und wenn wir es noch so sehr für geschmeichelt halten, gewinnt den Schein der wahrsten Wirklichkeit, und der gesamte Charakter des Mannes, alles in allem, etwas Freies, Unabhängiges, ja Großartiges. Denn Papa Lione war von fürstlicher, unwiderstehlich einschmeichelnder Herablassung gegen Niedere, ein vollendeter Diplomat aber Fürsten gegenüber. Nichts von Feigheit liegt in seinem Wesen. In schwierigen Lagen war er kaltblütig aufgetreten. Als er im Kardinalskollegium die Zettel vorzulegen hatte, und es sich zeigte, daß er selber der gewählte Papst sei, las er ruhig weiter, ohne daß seiner Stimme die mindeste innere Bewegung anzumerken gewesen wäre. Er erkannte die Charaktere der Menschen, er lenkte und benutzte sie, und seine prachtvolle Art, Rom als den Mittelpunkt der zivilisierten Welt darzustellen, hat sich so erfolgreich erwiesen, daß er, der für die bildenden Künste nur wenig getan hat, dennoch Giulios Ruhm beinahe ganz auf sich zu übertragen und in der Geschichte als der Mann aufzutreten verstand, ohne dessen Namen von der Blüte der modernen Kunst nicht gesprochen werden kann.
Nennen wir Glück ein erhebendes Gefühl der Gegenwart mit der Aussicht auf eine Zukunft, deren sich mehrende Vorteile ein ins Unendliche fortschreitendes Wachstum erwünschter Zustände darbieten, so daß die Erinnerung an die Vergänglichkeit des Irdischen und an die zerstörerische Ironie des Schicksals leicht von der Seele gescheucht wird, als ließe die gewaltige Regel dennoch Ausnahmen zu, dann war die Familie Medici vollkommen glücklich in jenen Tagen, als Leo der Zehnte im November 1515 in Florenz einzog. Giuliano, den Gonfalonier der Kirche, hatte er mit einer französischen Prinzessin vermählt. Lorenzo ist Generalkapitän der florentinischen Republik (gegen die Gesetze, denn kein Eingeborner durfte diese Würde erhalten; das aber kümmerte ihn wenig), er kommandierte die Stadt so unumschränkt, als wenn er ihr Herzog wäre. Giulio dei Medici ist Erzbischof von Florenz, Kardinal und Legat in Bologna. In Frankreich ist Ludwig der Zwölfte gestorben. Seine Rüstungen zur Wiedereroberung der Lombardei sind dem Herzoge von Angoulème zugute gekommen, der als Franz der Erste im Beginn des Jahres 1515 den Thron besteigt, mit einem Heere in Italien erscheint, in der Schlacht von Marignan das Beispiel glänzender siegreicher Tapferkeit gibt und, nachdem er Frankreich abermals zum Herren der italienischen Politik gemacht hat, den Papst und die Medici, die anfangs gegen ihn mit dem Kaiser zu Felde gezogen sind, zu seinen Freunden umschafft. Jetzt, im Herbste 1515, will Franz mit dem Papste in Bologna zusammentreffen, und auf der Reise dahin betritt Leo zum ersten Male nach seiner Erhöhung die Vaterstadt wieder, deren Bürger im Entzücken über seine Ankunft die Mauer einreißen, um ein neues Tor zu schaffen: Leos Einzug in Florenz schien die Besiegelung der in Dienstbarkeit verwandelten Freiheitsliebe.
Damals war es, daß Machiavelli sein zwei Jahre früher begonnenes Buch über den Fürsten, il Principe, dem jungen Lorenzo zueignete, ein Akt, der in jenen Zeiten weniger als heute eine bloße Höflichkeit bedeutete. In diesem Fürsten, dessen Begabung der venezianische Gesandte mit der Cesare Borgias vergleicht, erblickte Machiavelli den zukünftigen Herrn und Retter Italiens. Das Buch, so objektiv und allgemein es gehalten scheint, ist im Grunde doch nur für Florenz und Lorenzo berechnet – und für Machiavelli selber. Denn er wollte sich als brauchbaren Mann darstellen und auf alle Fälle wieder in aktive Dienste treten. Das aber gelang ihm doch nicht. Die Medici urteilten vielleicht, daß ein Geist, der so genau die Mittel und Wege und Leidenschaften der Fürsten kannte, ein zu bedenklicher Beobachter in ihrer nächsten Nähe sei.
Den 11. November war Leo, wie Michelangelo seinem Bruder Buonarroto schreibt, von Rom nach Florenz abgereist. Buonarroto dann wiederum schildert ihm in einem langen Briefe die Pracht des Einzuges, der übrigens in einem besonderen Buche offiziell der Welt mitgeteilt wurde.
Zwölf Triumphbögen erwarten den Papst in den Straßen von Florenz, Tempel, Säulen, Statuen, Fahnen, Blumen, Teppiche, die Stadt erschien wie ein einziger geschmückter Palast und die Bürgerschaft, in ausgesucht prachtvoller Kleidung, wie eine Schar glückseliger Kinder, die ihrem Vater entgegenjubeln.
Damals war auch Granaccio wieder bei der Hand und errichtete einen der Triumphbögen, grau und grau die Malereien und freie Statuen darauf, er und Aristotile di Sangallo hatten diese Arbeit vollbracht, die Staunen erregte; Giuliallo und Antonio di Sangallo vor dem Palaste der Regierung einen Tempel aufgebaut; Rosso, Montelupo, Puntormo, lauter Namen einer Generation, sich beteiligt. Das Prachtvollste aber war eine aus Holz aufgebaute, marmorartig gemalte Fassade vor Santa Maria del Fiore, von Sansovino nach den Zeichnungen des alten Lorenzo dei Medici errichtet, der sich wohl auf die Architektur verstand. An diesen Herrlichkeiten vorüber wälzt sich der schimmernde Zug des Papstes, in dessen Gefolge sich Raffael befindet. Diese Reise auch bot dein Papste Gelegenheit, zum erstenmale Michelangelos Dienste in Anspruch zu nehmen.
III
Michelangelo hatte schon vor dem Regierungsantritte des neuen Herrn im Vatikan nichts mehr zu tun gehabt, Raffael, der von Würde zu Würde stieg, war dort allmächtig. Selbst in die Sixtinische Kapelle einzudringen, war Raffael endlich gelungen. Er arbeitete an den Kartons für die Teppiche, welche den tiefsten Teil der Mauer rings herum bedecken sollten, Werke, die durch innere Größe, Einfachheit und Beherrschung aller Körperformen das Bedeutendste sind, was er geschaffen hat. Hier tritt er am nächsten an Michelangelo heran, und wenn Raffaels Absicht war, ihn durch eine gewaltige Leistung zu bekämpfen, so gelang es ihm. Ob Leo jedoch, Raffael für den vorzüglicheren Künstler haltend, deshalb so viel Gunst auf ihn gehäuft, oder ob dies nur die Folge jener zweiten Kunst war, die Raffael im höchsten Grade besaß: die Menschen unwiderstehlich anzuziehen, ist ungewiß. Es scheint, daß Leos und Michelangelos Naturen einander leise abstießen. Es gehörte ein Mann wie Giulio II. dazu, um bei persönlicher Frage und Antwort Michelangelo zu überbieten, Leo scheute sich vor ihm. Er sprach offen aus, Michelangelo sei so wild, und es lasse sich mit ihm nicht verkehren. Indessen, Leo war Papst und Michelangelo war Michelangelo. Er nahm eine Stellung ein, welche Aufträge für ihn wie eine Notwendigkeit erscheinen ließen,
Auch erwartete Michelangelo diese Aufträge als etwas Sicheres und suchte sich für den Fall, daß sie erfolgten, die Schultern frei zu machen. Mit der größten Anstrengung wurde die Fortführung der Grabmalarbeiten betrieben. Im Sommer 1515 werden von Buonarroto 1500 Dukaten als Betrag aller beim Spitalmeister niedergelegten Gelder nach Rom gesandt. Michelangelo wollte das Metall zu den Bronzeteilen des Monumentes dafür kaufen. Er müsse rasch fertig werden, schreibt er, denn der neue Papst werde nächstens seine Dienste in Anspruch nehmen. Er mahnt die Seinigen, sich einzuschränken und keine unsichern Spekulationen zu unternehmen. Der Spitalmeister, höre er, habe sich beklagt, daß er so große Summen verlange. Der Spitalmeister sei verrückt: so lange Jahre habe der Mann das Geld ohne Zinsen von ihm gehabt, und nun, wo man sein Eigentum verlange, räsoniere er. Oft sind Michelangelos Briefe jetzt im hellen Ärger geschrieben, wenn die zu Hause seinen Anordnungen nicht nachgekommen waren, immer aber voll Sorge um das Wohl der Familie. Vom 21. April 1516 haben wir ein kurzes Billet des Kardinals Aginense an ihn, eines der Testamentsexekutoren Giulios, der in Ausdrücken, welche eine gewisse Ängstlichkeit verraten, die Bitte ausspricht, Michelangelo möge doch die Herzogin von Urbino nicht mit dem unangenehmen Gefühle von Rom abreisen lassen, nichts von dem Monumente gesehen zu haben. Am 8. Juli desselben Jahres wird mit den Erben Giulios ein neuer Kontrakt vereinbart, demzufolge das Grabmal abermals neue Gestalt erhalten soll. Jetzt soll es ganz dicht an die Wand gerückt werden. Der Preis 16 500 Dukaten, von denen 3 500 bereits gezahlt worden waren. Die Arbeitszeit neun Jahre. Fälle von Krankheit oder andere Verhinderungen besonders vorgesehen. Versprechen angestrengter Tätigkeit von seiten des Meisters zugesagt, der nach Belieben in Rom, Pisa, Florenz oder Carrara arbeiten dürfe: all das aber wiederum umsonst, denn es ergeht der Ruf an Michelangelo, im Vatikan die Befehle des Papstes für Erbauung einer Marmorfassade der Kirche San Lorenzo in Florenz in Empfang zu nehmen.
Michelangelo befand sich im Herbste 1516 in Carrara, wo unter seiner Leitung Marmor für das Grabdenkmal gebrochen wurde, als ihm zwei Nachrichten gleichzeitig zukamen: die eine aus Rom, jener Befehl des Papstes; die andere aus Florenz, daß sein Vater lebensgefährlich erkrankt sei. »Buonarroto«, schreibt er am 23. November 1516 aus dem Gebirge an seinen Bruder, »ich ersehe aus deinem letzten Brief, daß der Vater todkrank gewesen ist und daß der Arzt ihn jetzt, falls keine bösen Zwischenfälle eintreten, außer Gefahr erklärt hat. Ich komme deshalb nun nicht nach Florenz, ich stecke zu tief in der Arbeit, wenn sich aber sein Zustand verschlimmern sollte, so will ich ihn auf alle Fälle vor seinem Hinscheiden noch gesehen haben, und wenn ich selber mit ihm sterben müßte. Doch hoffe ich, es geht gut, und komme deshalb nicht. Sollte aber, wovor Gott ihn und uns bewahren möge, ein Rückfall eintreten, so sorge dafür, daß ihm die letzten Tröstungen und das Sakrament gereicht werden, und laß dir von ihm sagen, ob es sein Wunsch ist, daß von uns etwas für das Heil seiner Seele geschähe. Sorge auch dafür, daß ihm zu seiner Pflege nichts mangele, denn ich habe mich für ihn allein abgemüht, um ihm bis zu seinem Tode ein sorgenfreies Leben zu schaffen. Auch deine Frau muß sich seiner annehmen und auf seine Bedürfnisse achthaben, und ihr alle, wenn es darauf ankommt, dürft keine Ausgaben scheuen, und sollte es unser Vermögen kosten. Gebt mir bald Nachricht, denn ich bin in großer Besorgnis.«
Diesem Briefe beigeschlossen war ein anderer, welchen Borgherini so rasch als möglich nach Rom befördern solle, da wichtige Dinge darin enthalten seien. Am 5. Dezember geht Michelangelo selbst dahin ab, vernimmt die Absichten des Papstes und fertigt eine Zeichnung an, auf welche hin er mit dem Bau der Fassade beauftragt wird.
Michelangelo hat alles auf den Fassadenbau Bezügliche in einer Denkschrift zusammengestellt, deren größter Teil erhalten blieb. Dies ist deshalb besonders wichtig, weil dadurch eine Anschuldigung gegen seinen Charakter als grundlos beseitigt werden kann, welche verschiedenfach formuliert immer wieder aufs neue gegen ihn erhoben worden ist.
In Vasaris Leben des Leonardo da Vinci lesen wir: Zwischen Leonardo und Michelangelo herrschte Gereiztheit und Übelwollen. Und deshalb, als Michelangelo vom Papste zur Konkurrenz für die Fassade von San Lorenzo nach Rom berufen ward, ging er, mit Erlaubnis des Herzogs Giuliano, von Florenz dahin; Leonardo, als er dies hörte, verließ Rom und reiste nach Frankreich.
Neuere Biographen Leonardos haben, was Vasari sagt, zu einer Erzählung ausgebildet, deren Widerlegung nicht zu umgehen war. Man berichtet: kaum habe Michelangelo in Florenz Nachricht empfangen, daß Leonardo in Rom sei, als er sich sofort dahin aufmachte, um dem Einflusse seines alten Gegners entgegenzuwirken. Um vom Herzog Giuliano aber die Erlaubnis zu dieser Reise zu erlangen, habe er bei demselben vorgegeben, daß er vom Papst der Fassade wegen nach Rom berufen sei. Diese Mühe jedoch (Leonardo zu verdrängen nämlich) sei ihm von Leonardo selbst erspart worden, der sich, sobald er von seines alten Nebenbuhlers Ankunft gehört, freiwillig von Rom fortbegeben habe.
Ist nun zwar, was uns auf diese Weise als eine ausgemachte Sache vorgetragen wird, schon dadurch zu beseitigen, daß ein Mißverständnis der italienischen Sprache nachgewiesen werden kann (denn es ist immer noch besser, hier Unkenntnis statt absichtlicher Verdrehung vorauszusetzen), so darf jetzt jedoch mit Sicherheit behauptet werden, daß auch Vasaris Angabe eine Unmöglichkeit enthält. Wir besitzen eine eigenhändige Notiz Leonardos, derzufolge er, nachdem er in Rom das nicht gefunden, was er erwartet, bereits Ende Januar 1516 für immer von dort wieder fortzog. Ende November 1516 aber erst erging der Ruf des Papstes an Michelangelo. Sollte Leonardo aber florentinisch gerechnet haben, so daß nach römischer Zählung der Januar 1517 als die Zeit seiner Abreise anzunehmen wäre, so stimmte das ebensowenig zu jenen Behauptungen. Denn dann wäre zur Zeit seines Fortgehens die Bestellung längst erfolgt und Michelangelo bereits wieder in Carrara gewesen.
Leonardo war im Jahre 13, als Giuliano dei Medici zur Krönung Leos nach Rom zog, mit diesem dorthin gegangen, vom Papste jedoch seiner zögernden Art zu arbeiten wegen ohne größere Aufträge gelassen worden. Nicht durch Michelangelo, sondern durch Raffael würde er verdrängt worden sein, wenn er wirklich aus Eifersucht Rom verlassen hätte. Doch auch das ist nur eine leere Vermutung. Warum durchaus immer auf solche Persönlichkeiten kommen? An nichts wird lieber geglaubt als an kleinliche Leidenschaften und Fehler großer Männer und nichts sorgfältiger ausgebeutet als die darauf hinzielenden Andeutungen der Biographen. Wieviel mag in Vasaris Erzählungen stehen, wo wir nicht einmal ahnen, daß es falsch ist, um vielleicht niemals aufgeklärt zu werden. Denn es gibt Charaktere unter seinen Zeitgenossen, die Vasari, weil er die einzige Quelle ist, aus der wir sie kennen lernen, geradezu vernichtet haben kann.
Als Michelangelo im Dezember 1516 in Rom eintraf, fand er dort eine Anzahl von Künstlern versammelt, deren Zeichnungen gleich der seinigen für die projektierte Fassade eingefordert worden waren. Die Ausführung dieses letzten fehlenden Schmuckes der mediceischen Familienkirche, in der Brunelleschi und Donatello sich verewigten, war oft beabsichtigt worden. Lorenzo Medici hatte seinerzeit selbst eine Zeichnung dafür entworfen. Man führte Kirchenbauten damals nicht selten in dieser Weise aus, daß die Fassade von vornherein außer Anschlag kam und ihre Errichtung späteren Zeiten mit neuen Geldmitteln aufgespart blieb. Kostbare, fertig ausgebaute Kirchen bieten so in italienischen Städten häufig den sonderbarsten Anblick. Auch Santa Maria del Fiore, ringsum mit dem prachtvollsten Marmorgetäfel bekleidet, zeigte bis auf die neuere Zeit als Fassade eine häßliche kahle Wand, die nun freilich mit einer ungeheuren, schneeweißen Marmordekoration zugedeckt worden ist. Deshalb war auch bei Leos Einzug die Holzfassade des Sansovino der passendste Schmuck zur Verschönerung des Domes und der ganzen Stadt, der sich nur ersinnen ließ.
Die Aufführung der Fassade von San Lorenzo bildete eine gewaltige Aufgabe. Hätte Michelangelo sie übernommen, so wäre an eine Rückkehr zum Grabdenkmale Giulios einstweilen gar nicht zu denken gewesen. Er stellte dies Leo vor und berief sich auf seine Verpflichtungen gegen die Familie Rovere; er sei kontraktlich gebunden und habe bereits Geld empfangen, man fordere Arbeit dafür. Der Papst erwiderte, er möge ihn nur gewähren lassen; mit den Rovere wolle er schon fertig werden, daß sie die Einwilligung gäben. Diesen blieb denn auch nichts anderes übrig, als ja zu sagen; das einzige, was sie erreichten, war das Zugeständnis, daß Michelangelo gestattet wurde, während er mit dem neuen Auftrage beschäftigt sei, zugleich am Grabdenkmale wenigstens weiterzuarbeiten. Denn gemeinhin wurden die Kontrakte so abgefaßt, daß bis zur Vollendung der Arbeit, um die es sich handelte, inzwischen keine andere angerührt werden durfte.
Zusammengefunden hatten sich zur Konkurrenz vorerst Raffael, seit dem vergangenen Jahre oberster Baumeister am Sankt Peter und vom Papste ausdrücklich mit nach Florenz geführt. Die beiden Sansovini ferner, Neffe und Onkel, die Sangalli, endlich Baccio d'Agnolo. Michelangelos Entwurf, der noch vorhanden ist, wie auch einige der übrigen Zeichnungen, nur daß bei diesen nicht entschieden feststeht, welchen Meistern sie einzeln zuzuteilen sind, trug den Sieg davon. Der Papst gab ihm den Auftrag, versuchte jedoch die Sache zu drehen, daß Michelangelo als Leiter des Ganzen andere Meister unter sich arbeiten ließe und besonders in Betracht der Skulpturen jüngeren Bildhauern die Modelle lieferte. Davon wollte Michelangelo unter keiner Bedingung hören. Entweder er allein oder gar nicht, dabei blieb er und setzte es durch. Aber diese Ausschließlichkeit machte böses Blut und wurde ihm von vielen Seiten nachgetragen. Am 31. Dezember ist er schon in Carrara zurück. Am 8. Januar 1517 empfängt er dort 1000 Dukaten zum Beginn der Arbeiten; der Gonfalonier mußte sie ihm durch einen Expressen nachsenden, weil Michelangelo, als er sich in Florenz des Geldes wegen bei ihm gemeldet hatte und im Vorzimmer warten sollte, ohne weiteres abgereist war.
Die nun folgende Zeit wird durch die Beaufsichtigung des Marmorbrechens im Gebirge ausgefüllt.
Die neue Tätigkeit, in welche Michelangelo durch den Auftrag Leo des Zehnten versetzt worden war, forderte nicht nur einen Bildhauer und Baumeister, sondern einen Ingenieur und dazu einen Mann, der Leuten zu befehlen verstand. Die Fassade einer Kirche, wie der von San Lorenzo, mit Skulpturen zu bedecken, war eine Aufgabe, neben der das Grabdenkmal Giulios ein bescheidenes Ansehen annimmt. Dazu kam, daß Michelangelo sich auch bei diesem von niemand wollte helfen lassen. Frühling und Sommer 1517 verstreichen ihm im Gebirge. In Carrara sowohl läßt er arbeiten als bei Pietrasanta und Serravezza, an Plätzen, die er selbst herausgefunden, Steinbrüche auftun. Im August kommt er nach Florenz, um auf den Wunsch des Papstes ein Modell der Fassade anfertigen zu lassen. Baccio d'Agnolo stellt das Architektonische aus Holz her, Michelangelo arbeitet die Figuren in Wachs dazu. Dazwischen erkrankt er. Endlich sendet er das Ganze durch seinen Diener nach Rom, wohin er vom Papste durch besonderen Befehl dann selbst entboten wird. Jetzt erst werden die näheren Bedingungen der Bestellung verabredet. Michelangelo erlangt, daß die Arbeiten für das Grabdenkmal nebenher fortlaufen dürfen. Er läßt, um dies zu ermöglichen, das dafür bestimmte Marmormaterial nach Florenz schaffen und erhält die, in der Folge freilich nicht gehaltene Zusage, es würden die Fortschaffungskosten sowohl als die beim Rücktransporte nach Rom zu erhebenden Eingangszölle vom Papste getragen werden.
IV
Einen Teil des Winters 1517 und 18 blieb Michelangelo in Rom, um dort sein Hauswesen aufzulösen und den Umzug nach Florenz zu bewerkstelligen. Durch diesen Aufenthalt, bei dem von ungnädiger Gesinnung des Papstes so wenig die Rede sein kann als bei früheren Gelegenheiten, verschwinden nun auch die Vermutungen über Leo des Zehnten und Raffaels feindschaftliches Verhältnis zu Michelangelo.
Die beiden großen Künstler standen einander nicht im Wege. Jeder besaß seinen Wirkungskreis. Sie hatten beide zu Gewaltiges geleistet, um sich verkennen zu dürfen. Ihre Gegnerschaft kann nur im Auftreten ihrer Anhänger widereinander beruht haben. Was ist über Goethes Verhältnis zu Schiller nicht bis auf unsere Tage erzählt und geglaubt worden, und endlich, nachdem ganz in die Tiefe gedrungen und jede Äußerung beider an die richtige Stelle gesetzt ward, wie rein erschienen sie in ihren Gefühlen zueinander. Es gibt eine falsche Vergötterung großer Menschen; ebenso falsch aber ist es, sie allzusehr nach dem gewöhnlichen Maße zu nehmen und die Feindschaft, die bei bloßen Talenten vielleicht natürlich erscheint, bei denen für möglich zu halten, die in zu vollem Maße begabt wurden mit eigenem Besitztum, um auch die reichsten neben sich beneiden zu dürfen.
Ohne Nebenbuhler in Rom, umgeben von einem Hofstaate lernender und mitarbeitender Künstler, entfaltete Raffael eine umfangreiche Tätigkeit. Er baute am Sankt Peter; er malte im Vatikan; er stand an der Spitze der Ausgrabungen und gab sich diesem Geschäfte mit besonderem Eifer hin. Es genügte nicht, daß jeder antike Marmor in Rom bei Strafe vorher ihm gezeigt werden mußte, ehe er verwandt werden durfte: durch Italien bis Griechenland hatte er seine Leute, die für ihn zeichneten, wo antike Werke vorhanden waren oder gefunden wurden. Das allein, was Raffael nebenbei abtat, hätte andere Männer ganz und gar in Beschlag genommen mit ihren Gedanken. Für ihn aber scheint es wie ein Spiel gewesen zu sein. Vom Morgen bis zum Abend muß seine Tage ein Wirbel von Geschäften, Arbeiten und Besuchen, die er empfing oder abstattete, erfüllt haben, niemals Ruhe, immer vorwärts, und trotz dieser Flüchtigkeit tief in seinem Herzen die Macht, sich ganz zu versenken in seine Werke und die Dinge so still und rein zu erfassen, als hätte er wie ein Mönch in der Zelle gesessen und gearbeitet.
Jener Bibbiena, der einst den armen Improvisator Cardiere so hart angefahren hatte, dann den Medicis in das Exil folgte und am Hofe von Urbino den fidelen Gesellschafter abgab, der alle Welt närrisch machte, war jetzt Kardinal. Bekannt ist er in der Literaturgeschichte als Verfasser des ältesten gedruckten italienischen Lustspieles. Seine Nichte Maria hatte er Raffael zur Gemahlin zugedacht. Es finden sich einige Briefe Bembos, Geheimschreibers des Papstes, an diesen, worin von Raffael die Rede ist, und die, obwohl sie ihn kaum erwähnen, dennoch zeigen, wie eingelebt er in diese höchsten Kreise war. »Der Papst«, lautet der Schluß eines Schreibens vom 3. April 1516, »befindet sich wohl, morgen wird er wahrscheinlich auf drei bis vier Tage nach Palo auf die Jagd gehen. Ich, Navigero, der Graf Castiglione und Raffael wollen morgen nach Tivoli, wo ich vor siebenundzwanzig Jahren zuletzt gewesen bin.« Am 19. April meldet er die Ankunft der herzoglichen Herrschaften aus Urbino: »Gestern war ich bei der Herzogin, der ich übrigens, so oft ich kann, meine Aufwartung mache. Sie empfiehlt sich Ihnen und Madonna Emilia gleichfalls. Signor Unico ist dort als beständiger Verehrer stets zu finden. Immer noch die alte Leidenschaft, die nun schon drei und halbes Lustrum alt ist, wie er selbst eingesteht. Diesmal aber ist er hoffnungsreicher als jemals, die Herzogin hat ihn aufgefordert, vor ihr zu improvisieren, und er denkt bei dieser Gelegenheit ihr steinernes Herz zu rühren. Raffael, der sich Ihnen empfehlen läßt, hat von unserem Tebaldeo ein so vortreffliches Porträt geliefert, daß es ein Spiegel nicht ähnlicher zeigen könnte. Ich habe nie eine solche Ähnlichkeit auf einem Bilde gesehen. Die Porträts des Grafen Castiglione und unseres seligen Herzogs sehen dagegen aus, als wenn sie von Raffaels Lehrjungen gemacht worden wären, sowohl was die Ähnlichkeit an sich betrifft, als auch im Vergleich zu dem Tebaldeos. Ich beneide ihn förmlich und gedenke mich eines Tages auch malen zu lassen. Eben, wie ich soweit geschrieben habe, kommt Raffael selber, er muß geahnt haben, daß von ihm in dem Briefe die Rede war, und bittet mich zu bemerken, Sie möchten ihm doch die Angaben zu den übrigen Gemälden zukommen lassen, die in Ihrem Zimmer ausgeführt werden sollen; diejenigen, über welche Sie bereits bestimmt hätten, würden diese Woche fertig werden. Wahrhaftig, es ist keine Lüge, in diesem Augenblicke erscheint auch Graf Castiglione! Ich soll Ihnen seinerseits vermelden, er würde, um seine alten guten Gewohnheiten nicht zu unterbrechen, diesen Sommer in Rom bleiben.«
Das gemalte Zimmer, von dem die Rede ist, scheint das Badezimmer des Kardinals Bibbiena im Vatikan zu sein. Damals stand Raffael im dreiunddreißigsten Jahre. Er war stärker und voller geworden. Er hatte seinen eigenen Palast, und wenn er nach dem Vatikan ging, sagt Vasari, bildeten fünfzig Maler sein Gefolge. Seine Liebenswürdigkeit aber war so groß, daß aller Neid und jede Mißgunst zwischen den Künstlern zu Boden gehalten wurde.
Keines seiner Werke ist so charakteristisch für jene Tage als eins, das als ihre freiesten reizendste Ausgeburt auch jetzt noch, verdorben und übermalt, den Hauch des römischen Lebens in sich trägt, dem Raffael sich damals hingab. Er hat das meiste daran nicht einmal selbst gemalt, sondern nur die Zeichnungen geliefert. Aber auch das gehört zu seinem Wesen, daß er andere arbeiten ließ und, was sie auf sein Geheiß geschafft hatten, mit wenigen Meisterstrichen zu seinem Eigentum stempelte.
In Trastevere (jenseits der Tiber) liegt das Gartenhaus des Bankiers des Papstes, des reichsten Mannes seiner Zeit, Agostino Chigis, heute die Farnesina genannt, weil es in späteren Jahren in den Besitz der Familie Farnese kam. Mitten in den Gärten steckt es, die sich den Fluß entlangziehen, an dessen anderes Ufer dichtan die vollen Häusermassen der Stadt anstoßen. Hinüberfahrend ist man aus den stillen Gebüschen in lärmende Gassen versetzt. Das war vor Jahrhunderten wohl nicht anders als heute.
Erbaut hatte das Haus Baldassare Peruzzi, aus Siena gebürtig, das heute noch, reichlich geschmückt von den Werken dieses Meisters, überhaupt neben Florenz den Ruhm beanspruchen darf, die Mutter tüchtiger Künstler gewesen zu sein. Peruzzi arbeitete unter den Borgias in Rom und für Papst Giulio in Ostia, als er noch Kardinal war. Nach dessen Erhebung wurde er von Bramante beim Bau des vatikanischen Palastes verwandt. Er paßte durchaus in die frische, produktive, drauflosarbeitende Wirtschaft in Rom, malte Häuserfassaden, Bilder für Kirchen und Privatpersonen, baute und zeigte in seinem Stil, der gleich dem Bramantes und Sangallos eine heitere, doch bei ihm mehr zierliche Nachahmung der Antike ist, eigentümlichen Charakter. Seine Gemälde weisen ihn in Raffaels Schule, bewahren jedoch eine aus dem Meister selbst stammende edle Einfachheit. Er ist ein Mann, der für sich allein steht.
Auch Peruzzis schönstes Bauwerk ist die Farnesina. Vasari sagt mit Recht, sie scheine nicht gemauert, sondern aus dem Boden geboren zu sein, so ganz vollkommen steht sie da in ihrer reizenden Einsamkeit. Heute [1857] ist sie verlassen, ihre offenen Hallen sind zugemauert, ihre Malereien der Anßenwände verblichen oder mit dem Kalke abgefallen, und in den schlecht gepflegten Gärten, zu denen eine verrostete Eisentüre aufgeschlossen wird, sieht man die alten Springbrunnen kaum noch von dürftigem Gewässer angefeuchtet oder vertrocknet und die leeren Postamente ohne Statuen. Auch die breite Eingangshalle, deren Decke Raffael malte, ist verschlossen: man hat zwischen den Säulen Wände gezogen und oben, in den Bogen, Fenster grob eingesetzt. Allmählich aber, wenn man sich in die Gemälde vertieft, schwindet das Gefühl der Vergänglichkeit.
Die Decke ist wie die der Sixtina ein glattes Tonnengewölbe, das in runden Bogen ringsum an die Wände ansetzt. Raffael hatte bei Michelangelo gelernt. Auch er nahm die Wölbung als die blaue, lichte Luft, in die er eine neue Architektur hineinbaute. Aber er führte sie aus Blumenkränzen auf. Über jedem runden Bogen malte er einen emporstrebenden Spitzbogen aus Girlandenwerk gebildet, und die sämtlichen, sich einander zuneigenden Spitzen verband er durch einen umlaufenden Kranz, der, weil das Gewölbe gleich dem der Sixtina, lang und schmal ist, in der Mitte einen langen viereckigen Raum bildete. Diesen teilte er quer durch und spannte in den beiden immer noch länglichen Vierecken zwei Teppiche aus, auf denen wir die Hauptgemälde erblicken, während das Übrige innerhalb der durch die aneinander stoßenden Spitzbogen gebildeten Dreiecke gemalt ist, perspektivisch so gehalten, als schwebten die Figuren hoch in den Lüften, zu denen man durch die Girlanden emporschaut.
Den Inhalt all dieser Gemälde bildet die Geschichte Amors und Psyches, das bekannte, reizende Märchen des Altertums. Psyche ist die Tochter eines Königspaares, das, verblendet von der Schönheit ihres Kindes, dessen Schönheit über die der Venus selber setzt und dadurch den Zorn der Göttin herabfordert. Jeder hat gelesen, wie es dahin kommt, daß das arme Kind, auf der Spitze eines Felsens verlassen, seinen Tod erwartet, wie sanfte Zephyre es niedertragen, wie Psyche, in einen Zauberpalast geleitet, Amors Gemahlin wird, wie ihre Schwestern sie verführen, den im Dunkel der Nacht verhüllten Gatten mit der Lampe heimlich zu betrachten, wie Amor flieht, wie sie verzweiflungsvoll ihn sucht und nach den grausamsten Proben neu mit ihm vereinigt wird. Unendliche Bilder scheinen in der Erzählung zu liegen. Raffael hatte nur eine kleine Anzahl Räume damit zu füllen. Wie ging er zu Werke?
Es scheint, als hätte er von dem, was sich zunächst aufdrängt, gar nichts gezeigt. Der Stolz der Eltern, ihre Verzweiflung, Psyche trostlos verlassen, dann im Palaste von unsichtbaren Händen bedient, dann Amor belauschend, dann in Tränen umherirrend, von einer Prüfung zur anderen: – nichts davon. Raffael fühlte, daß die Geschichte drei Hauptpersonen habe: die erzürnte Venus, die unschuldig liebende Psyche und Amor: und daß sich in diesen dreien der Gang der Fabel konzentriert. Venus muß besänftigt werden, Psyche um Amor leiden, Amor sich endlich wieder mit ihr vereinigen. So erblicken wir Venus zuerst, die auf einer Wolke sitzend auf etwas deutet, das in der Tiefe unten vorgeht. Sie zeigt ihrem Sohne das verblendete Volk, das entzückt von Psyches Anblick, ihr wie einer Gottheit Opfer bringt, während Venus' eigene Altäre vernachlässigt bleiben. Amor, neben ihr stehend, blickt kühn hinab, wohin ihr Finger seinen Augen den Weg weist. Ein fünfzehnjähriger Jüngling; mit der rechten ganzen Faust hat er, wie man eine Lanze angreift, einen Pfeil gefaßt, als wolle er ihn als einen Speer hinabstoßen, um die zu zermalmen, die seine Mutter beleidigten. Man fühlt, er hat verstanden, was sie meint, und verspricht ihr, die Rache zu vollführen.
Raffael hat das Märchen gleichsam in ein Drama verwandelt. Hier gibt er die erste Szene. Wir wissen was geschehen ist, wir erwarten was geschieht.
Die zweite Szene stellt einen Moment dar, der in der Erzählung ganz fehlt: Amor, den drei Grazien Psyche aus der Ferne zeigend. Die Göttinnen sitzen vor ihm auf zusammengeballten Wolken. Die erste, vorderste hat uns den Rücken zugewandt und blickt seitwärts herab. Ihr im Profil erscheinendes Gesicht ist bis zum Auge von der Schulter bedeckt. Die zweite sieht zu Amor auf, der aus der Höhe herab auf Psyche deutet, die wiederum unsichtbar in der Tiefe gedacht wird. Sie scheint Amor lieber zuzuhören als, wie die erste, hinabzugehen. Sie hat ein Bein über das andere gelegt, und ihre rechte Hand ruht auf dem Knie; ihre Haarflechten sind vorn am Halse unter der Kehle zusammengeknotet und fallen in blonden Löckchen in die Brust herab. Die dritte, etwas höher als die beiden andern, ist die reizendste. Ihr Kopf ist zu drei Viertel sichtbar, und die kühne Schönheit einer unschuldigen Natur erfüllt ihn. Amor braucht die rechte Hand um herabzudeuten, mit der linken redet er, das heißt, ihre Finger sind in einer Weise gestellt, daß man sogleich die Geste erkennt, mit der er seinen Worten Ausdruck geben will. Er scheint zu sagen: seht, wie schön sie ist! Scheint euch nicht auch natürlich, daß ich Psyche zu meiner Geliebten mache, statt sie zu vernichten? Und alle drei sind damit einverstanden.
Zwischen dieser und der dritten Szene ist geschehen, was scheinbar den Schwerpunkt der Fabel bildet. Psyche ist Amors Gattin geworden; die Schwestern haben sie verleitet, nachts mit der Lampe ihn zu beschleichen; er ist entflohen; verwundet von dem abgesprungenen glühenden Funken, geplagt von den Schmerzen der Wunde und von der Leidenschaft zu der verlorenen Geliebten, liegt er im Palaste seiner Mutter. Eine Möwe aber taucht in die Tiefen des Meeres, wo Venus haust, und verrät ihr, was geschehen sei. Von Wut entflammt darüber, daß Amor, statt ihre Feindin ins Verderben zu stürzen, von ihrer Schönheit selbst gefesselt worden ist, und im festen Entschlusse, die Vereinigung beider nun und nimmermehr zuzugeben, stürzt sie (wütend wie eine alte Fürstin von gutem Adel etwa, die gehört hat, daß ihr Sohn ein Bauernmädchen heiraten wolle) empor in ihren alten Palast, läßt über Amor einen Strom von Schimpf und Drohungen aus und eilt weiter, um Psyche zu suchen und an ihr selber ihren Zorn auszulassen. Da begegnen ihr Juno und Ceres. Was sie hätte? wohin sie wolle? warum sie erzürnt sei? Sie trägt den Fall vor und verlangt ihre Hilfe, Psyche vorher nur erst ausfindig zu machen. Höhnisch aber wird sie von den beiden Göttinnen gebeten, sich doch ihrer eigenen Aventuren zu erinnern und ihren Sohn tun zu lassen, wozu er Lust habe.
Dies ist die dritte Szene. Prächtig die Bewegung der Juno; ein rötliches Tuch umfliegt ihr Haupt und ist leicht über das Haar gedeckt. Ceres, mit dem Körper von Venus abgewandt, sich mit dem Kopfe aber nach ihr umdrehend, hat ein goldnes, bis zum Halse reichendes Gewand an und goldne Ähren wie einen Kranz im Haare. Mit Juno zu gleicher Zeit redet sie Venus an und läßt die Hände mitsprechen. Venus steht vor ihnen. Ein rötlich und golden schimmerndes Gewand flattert wie ein langer Streifen Zeug um sie her, den sie mit den Armen an sich festhält.
Verspottet von den Göttinnen und mit ihrer Bitte abgewiesen, eilt sie nun auf den Olymp, um sie Jupiter selbst vorzutragen.
Ihre Reise empor durch die Lüfte zeigt die vierte Darstellung. Sie steht in einem goldenen Wagen, ein in grau und roten Schatten wechselndes Gewand, das um sie her fliegt, hält sie mit der Linken, mit der Rechten den Faden, an dem ein Taubenpaar den Wagen hinaufzieht. Sie ist eine volle, kräftige, doch nicht üppige Frau. Wie verwandelt aber sehen wir sie in der folgenden Szene! Wie ein armes, unschuldiges Mädchen, dem alle Welt Leides antun will, steht sie vor Jupiter. Die Schultern ein wenig aufgezückt, die Knie zusammengedrückt, die Arme an sich gezogen und nur die beiden Hände schüchtern auseinander nach unten hin; den Kopf hält sie nach der Seite gelehnt, – es ist als sähe man die personifizierte scheue, schmeichlerische Bitte gegenüber der allmächtigen Gewalt. Jupiter, mit dem Flammenbündel im Arm, hört die Göttin wohlwollend an, blickt halb auf sie, halb sinnend in die Luft und überdenkt, wie die Sache am besten zu behandeln sei. Ganz wie ein regierender Herr, der, in eine Familiensache hineingezogen, beschwichtigend das Seinige zu tun verspricht, um die gefürchtete Mesalliance zu verhindern.
Den Erfolg sehen wir in der nächsten Szene: Merkur, der hinabschwebt, um das allgemeine Gebot zu verkünden, wodurch jeder Sterbliche bei Strafe verpflichtet wird, die flüchtige Königstochter im Betretungsfalle anzuhalten und auszuliefern. Mit ausgebreiteten Armen schwebt der Gott herab, sein Mantel, golden und braun, wird vom Winde in schönen Falten nach oben hin gerissen, man sieht den Sturz der Gestalt aus den Lüften nieder; die linke Hand erhebt er mit ausgebreiteten Fingern als Botschafter, in der rechten hält er eine Tuba; der geflügelte Helm, den er trägt, läßt einen Schatten auf sein Gesicht fallen, als schwebte er eben unter der Sonne fort.
Nun, im siebenten Bilde, erblicken wir Psyche zum ersten Mal. Sie ist lange umhergeirrt, hat sich der grausamen Venus zuletzt freiwillig ausgeliefert und die furchtbarsten Mißhandlungen erduldet. Unmögliche Dinge befiehlt ihr die Göttin, aber die Tiere helfen ihr; die Ameisen sortieren ihr einen aus verschiedenen Getreidearten durcheinander aufgeschütteten Körnerhaufen, die Schwalbe holt ihr die Flocke aus dem Felle des goldenen Widders, endlich, der Turm, von dem sie sich beim dritten Auftrage, der ihr ganz unausführbar scheint, herabstürzen will, beginnt zu reden und gibt ihr guten Rat, wie sie aus der Unterwelt die Büchse mit einem Teilchen von der Schönheit der Proserpina zurückbringen könnte.
Ihre Rückkehr aus den finstern Höhlen der Unterwelt zeigt die folgende Szene. Wiederum hat Raffael eine neue Episode des Märchens geschaffen, denn es steht nichts davon zu lesen, daß Psyche von Genien aus den Tiefen der Erde zum Palaste der Venus zurückgetragen sei. Einer der kleinen Liebesgötter, der sich ihr unter die Achsel drängt, um sie emporzutragen, gehört zu den reizendsten Kindergestalten Raffaels die ich kenne: dunkle kühne Augen und ein himmlischer Trotz in dem kleinen Munde. Psyche, von einem lichtgrünen Gewande kaum bedeckt, scheint ganz willenlos. Sie blickt mit stillbeglücktem Ausdruck vor sich nieder, das Gefäß hält sie hoch über sich mit der linken Hand, eines der geflügelten Kinder unterstützt den Ellenbogen, damit sie nicht ermüde; den andern Arm hat sie dem kleinen Genius, der sich mit der Schulter unter ihre Achsel drückt, über den Rücken gelegt.
Nun trifft sie mit Venus wieder zusammen. Kniend, die Hand auf die Brust gelegt, blickt sie wehmütig zu ihr empor und überreicht die Büchse der Proserpina. Über ihrem Haupte flattern die Tauben der Göttin, die beide Arme hoch erhoben hält. Nicht bloß vor Erstaunen, scheint es, sondern auch als sei es eine Wonne für sie, Psyche dadurch noch zu quälen, daß sie das Gefäß nicht annehmen will.
Unterdessen aber hat sich Amor, von Sehnsucht gequält, seinesteils auch zum Vater der Götter aufgemacht, und klagend über die Härte seiner Mutter bittet er um Gnade für sich und für die Geliebte. Diese Szene ist eine der herrlichsten und mit Recht berühmt. Jupiter nimmt den guten Jungen beim Kopf, küßt ihn auf die Wange und tröstet ihn. Amor blickt dem alten König des Himmels und der Erde so zuversichtlich froh ins Auge; Jupiters schneeweißes Lockenhaar und Bart berühren sich so schön mit der blühenden Wange. Er sitzt mit übergeschlagenen Beinen, ein violettgraues Gewand liegt über seinem Schoß, hinter ihm der Adler, den Schnabel voll Blitze. Amors eine Hand, mit dem Bogen darin, ruht in Jupiters Schoße, die andere, mit einem senkrecht ruhenden Pfeil zwischen den Fingern, fällt glatt an seiner Seite herab; er steht im Profil, der vordere Flügel, den man ganz übersieht, liegt im Schatten, der andere, dessen Spitze und oberer Rücken dahinter hervorgehen, leuchtet ganz hell.
Zum Schluß: Merkur, der Psyche zum Olymp trägt. Sie hat die Arme auf der Brust gekreuzt, die Augen wenden sich empor, sie lächelt, es ist als lauschte sie den Worten Merkurs, der ihr im Fluge schon allerlei von den Palästen der Götter erzählt. Sein Haupt wird im Profil über dem ihrigen sichtbar. Mit dem Caduceus deutet er nach oben, man sieht jedoch nur seine Hand mit dem Stiel des Stabes darin. Wiederum umfliegt ihn der braungoldne Mantel, und auf seine silberne Flügelkappe scheint das Licht scharf herab, daß ihm ein Schatten über das Gesicht fällt. Die Flügel des Helmes sind golden, seine flatternden Locken blond; Psyches Haar aber, das gleichfalls sonnenblond erscheint, ist ihr über dem Haupte in einen sanften Knoten geschlungen, und was davon frei blieb, fliegt nach oben, als trügen wirbelnde Lüfte sie beide aufwärts.
Auf den großen Bildern, die eins neben dem andern die Mitte der Wölbung einnehmen: die Darstellung Psyches im Kreise der Götter und ihre Vermählung. Es sind volle, figurenreiche Kompositionen, am schönsten die letztere, wo wir die Götter und Göttinnen alle um den goldnen, auf zartvioletten Wolken ruhenden Tisch zum Hochzeitsmahle gelagert sehen. Wenn irgend etwas ein Spiegelbild der Zeit bietet, in der diese Werke entstanden, so sind sie es. Die ganze heidnische Pracht des damaligen Daseins drücken sie aus, den Schluß der üppigen Wiedergeburt des alten Römer- und Griechentums in Rom, das nach diesen Tagen allmählich wieder in Verfall geriet.
Ich habe die Gemäldefolge so genau beschrieben, weil sie am wenigsten bekannt ist und weil sie Raffaels Talent bewundern läßt für die Wahl der Momente, in denen geistig der Umschwung des Märchens liegt. Doch wir gewinnen noch ein anderes Resultat. Wie Homer in der Ilias nicht die Eroberung Trojas, sondern den Zorn des Achilles besang, so malte Raffael nicht die Leiden der Psyche, sondern den Zorn der Venus. Steht das aber fest, so wird es fast zu einer Notwendigkeit, sein berühmtes, unter dem Namen Galatea bekanntes Wandgemälde im Zimmer nebenan nicht als eine Darstellung dieser Nymphe, sondern als den Zug der Venus über den Ozean aufzufassen, wie er zu Anfang des Märchens von der Psyche bei Apulejus genau beschrieben steht. Dieses Bild eröffnet das Ganze und gehört so notwendig dazu, als die letzten großen Gemälde in der Mitte der Decke, die den Abschluß bilden. Auch begreift sich nun, warum diese Darstellung von Raffael in früheren Jahren zuerst gemalt und das folgende, das längst versprochen und immer aufgeschoben war, in späteren Zeiten dazugesetzt wurde.
Noch eines bestimmte mich, so ganz abgehend von Michelangelo ein Werk Raffaels hier völlig auszubreiten. Kein anderes legt in solchem Grade Zeugnis ab von der glücklichen Stimmung jener Tage. Chigis Gartenhaus war der Schauplatz von Festlichkeiten, denen der Papst beiwohnte, nach deren Schluß die goldenen Schüsseln, von denen man gespeist, in die Tiber geschleudert wurden, Schüsseln, zu denen vielleicht auch Raffael die Zeichnungen geliefert. Chigi, dem die Juwelen der päpstlichen Krone versetzt worden waren, der alle Künstler beschützte, dessen Haus die Dichter besangen und der von einem sienischen Kaufmann zu einem der ersten römischen Adligen emporstieg. Wir haben, wenn wir der damaligen Zeiten gedenken, zu sehr die innere Fäulnis im Sinne. Schon um Raffaels willen müssen wir anders urteilen. Was Raffael gedacht und wie er gehandelt, wissen wir nicht. Die überlieferten Zeugnisse geben nur Äußerlichkeiten. Aber daß er mitten in der Gesellschaft Leos drinsteckend all die herrlichen Werke schuf, deren Adel und Reinheit uns noch im frischesten Glanze vor Augen stehen, läßt sich nicht leugnen, und daß er, obgleich die Quelle seiner Kunst nur in seinem Herzen lag, dennoch unmöglich dem Einfluß dessen, was seine tägliche Gewohnheit war, sich entziehen konnte, wird niemand annehmen. Was aber war es, was die römische Gesellschaft unter Giulio und Leo so fruchtbar für die Geister gemacht hat?
Es sind drei Mächte stets, welche die Welt regieren: Geld, Geist und Gewalt. Diese feinden sich an untereinander. Steht ihr Einfluß auf die Geschicke eines Volkes aber in solchem Verhältnis zueinander, daß keine die andere überbietet, dann offenbart sich die Blüte eines Volkes. Man könnte sie auch benennen: Energie, Genie und Geburt, oder Erwerbende Kraft, Wissenschaft und Adel: es sind immer die drei Zeichen, durch die das Schicksal Menschen erhöht, indem es sie reich macht, ihnen überragende Seelenkräfte oder eine erhabene Stellung durch die Geburt verleiht. Immer wo einer dieser drei Titel mehr gilt als der andere, krankt die freie Entfaltung eines Volkes, weil sie den richtigen Schwerpunkt verloren hat.
Wie heute in England etwa oder wie in Griechenland einst, so in Italien zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts hielt sich der Einfluß dieser drei Mächte im Gleichgewichte. Raffael war Maler, aber konnte Kardinal werden. Nirgends ist es so leicht gewesen für eine bedeutende Persönlichkeit, sich zu jeder Stellung emporzuschwingen, als in Rom damals. Der familienlose, vielgestaltete geistliche Staat bildete den Durchgang zu allem Erreichbaren. Eine lebendige Zirkulation aller menschlichen Kräfte fand statt. Das Pedantische, Voraussichtliche heutiger Laufbahnen verschwand. Jeder Übergang war möglich. Man konnte mit geringer Anstrengung seine Vergangenheit vernichten, man kompromittierte sich durch nichts auf die Dauer, auch durch die furchtbarsten Verbrechen nicht, so erfüllt war der Moment stets vom Geräusch des Gegenwärtigen, daß keiner sich auf die Melodie des vorhergehenden Tages besonnen hätte. Vorwärts strebten die Menschen. Wie im Laufe die Kleider fliegen, so zeigt sich jeder bald unverhüllt, bald in den prächtigsten Falten wieder, und indem jeder das Leben kannte, lernte er sich schützen gegen die Gefahren, die es mit sich brachte. Das Verstecken des wahren Charakters, das bei uns mit kalter Faulheit oft ein Leben lang leicht vollbracht wird, war dort unmöglich oder gelang nur dem Geschicktesten. Man erkannte deutlicher, was drohte, und vermied es, mit furchtloser Kühnheit den sicheren Weg wählend.
Wenn wir heute von den verwerflichen Dingen hören oder sie selbst erleben, die Paris und London in sich tragen, so zweifeln wir dennoch nicht, welche Vorteile es mit sich bringe, dort gerade für das Leben geschult zu werden, und für den, der dort aufgewachsen ist, wird sich die Voraussetzung nicht bilden, er habe teil an der moralischen Verwilderung, in deren Mitte er sich bewegte, und wenn er sie noch so dicht gestreift hätte.
Eine solche Erziehung war es, die Raffael in Rom empfing. Seine Werke sind die Schöpfungen eines Mannes, dem nichts Schranken setzte, der sich vollkommen in seinem Elemente fühlt, der, wie es die Stunde verlangt, gehen, ringen, reiten, schwimmen oder sogar fliegen kann. Nur das Rom Leo des Zehnten war im Stande, das aus ihm zu machen und das ihm zu gewähren, dahingegen Michelangelo, der einsam ging, nur das besaß, was die Stille und Einsamkeit in einer großen Seele zeitigen.
V
Auch Michelangelo arbeitete wieder als Maler in den drei Monaten seines römischen Aufenthaltes im Winter 1517 auf 18. Bei jenen Geldsendungen aus Florenz nach Rom wird Francesco Borgherini von ihm erwähnt, ein florentinischer in Rom ansässiger Bankier, durch den das Geld ausgezahlt werden könne. Michelangelo nennt ihn »einen in Wahrheit vortrefflichen Mann, dem kein anderer von den Florentinern in Rom gleich komme«. Für diesen hatte er damals ein Gemälde auszuführen. Er bezeichnet es in seinem Briefe nicht näher, allein da die Kapelle in San Pietro in Montorio, wo Sebastian die Geißelung Christi malte, den Borgherinis gehörte, da Michelangelo um jene Zeit nichts anderes gemalt hat und es bekannt ist, daß Sebastians Werk um diese Zeit etwa nach einem Karton Michelangelos entstand, so wird unzweifelhaft für mich, welches Werk in den Briefen gemeint war. Sebastian malte den gegeißelten Christus an die halbrunde Wand der Nische, welche die Kapelle bildet, er führte das Gemälde in Öl aus, die Farben haben stark nachgedunkelt, sonst aber hat es wenig gelitten und ist ein prachtvolles Denkmal der Malerei seiner Zeit.
Daß Michelangelo nicht nur die Skizze machte, sondern den Umriß der Figuren auf die Wand zeichnete, glaube ich zu erkennen. Mit geneigtem Haupte an eine Säule angebunden, krümmt sich der Erlöser unter den Schlägen seiner Peiniger, aber man gewahrt beinahe nur das Bemühen, sich winden zu wollen: die gebundenen Glieder sind nicht imstande, die Bewegung wirklich auszuführen. Das lebendige venezianische Kolorit aber hebt die Zeichnung so sehr, daß Sebastian das meiste an dem Bilde getan zu haben scheint. Oben darüber, in der Wölbung der Altarnische, eine Himmelfahrt Christi, ebenfalls von Michelangelo, unbedeutender in der Malerei, als Komposition jedoch ganz gewaltig und, wie mir scheinen will, ein Werk, das Raffael bewußt oder unbewußt in den Gedanken lag, als er die seinige malte.
Die Neuheit der Malerei, der Reiz des Helldunkels, die Tiefe und Glut der Farbe erregten Aufsehen in Rom und gaben Sebastian von nun an eine bedeutende Stellung, die durch andere Werke, zu denen Michelangelo öfter die Zeichnungen lieferte, noch gehoben wurde. Ich nenne aus ihrer Zahl den vom Kreuz genommenen Christus in den Armen Josephs von Arimathia mit Maria daneben, eine Komposition von kolossalen Formen, in prachtvoll kräftiger Pinselführung ausgeführt und zu den kostbarsten Besitztümern des Berliner Museums zählend. Hier gerade um so besser an der richtigen Stelle, als Sebastian durch eine Menge unbedeutender Werke, welche auf vielen Galerien ohne Grund mit seinem Namen bezeichnet worden sind, bei uns den Anschein eines mittelmäßigen Künstlers gewonnen hat, dem sich ohne weiteres dies oder jenes zuerteilen lasse. Man muß seine unzweifelhaften Werke allein vor Augen haben, um ihn richtig zu schätzen, etwa das Bildnis des Admiral Doria im Palaste Doria in Rom, die Darstellung eines Mannes wie sie Tizian nicht zu geben vermocht hätte, so gewaltig ist die Zeichnung und so männlich stark der heldenmäßige Ausdruck des Charakters in diesem Bilde.
Für Sebastian del Piombo fand sich durch Michelangelos Vermittlung jetzt ein neuer Auftrag. Der Kardinal Medici bestellte bei ihm eine Auferweckung des Lazarus. Michelangelo zeichnete den Karton. Wir finden nicht besonders bemerkt, wann er mit dieser Arbeit beschäftigt war, aber da wiederum die Zeit zutrifft und nichts anderes vorliegt, was ihn den Winter über in Rom beschäftigt haben könnte, so darf hier mit einiger Bestimmtheit gesprochen werden. Auch zeichnete er gewiß nicht bloß die Figur des Lazarus, von der zufällig eine einzelne Skizze erhalten blieb, sondern die ganze Komposition, die durchaus in seinem Geiste erdacht und zusammengeschlossen worden ist. In diesem Winter erst, am 19. Februar 1518 wurde der Kontrakt über die Fassade von San Lorenzo abgeschlossen, deren beabsichtigte Form sich im Schriftstücke genau beschrieben findet. Anfang Februar erhebt Michelangelo Geld dafür in Florenz und geht nach Carrara weiter, wo in seinem Auftrage die Arbeiten ihren Fortgang genommen hatten.
Michelangelo war in Carrara zu Hause. Er kannte das Gebirge genau, und die Carraresen kannten ihn. Topolino, Steinmetz und Bildhauer dazu, war sein guter Freund dort. Keiner hatte so große Massen Marmor von Carrara bezogen als Michelangelo, keiner sich so sehr selber darum bekümmert, daß die Sendungen der Bestellung entsprächen. Der Grund, weshalb er sich hier so wenig als möglich auf andere verließ, lag auch darin, daß er peinlich genau in seinen Ausgaben war und sich nicht betrügen lassen wollte. In einem Briefe aus dem Jahre 1515 beklagt er sich über einen solchen Handel: »Gib den anliegenden Brief an Michele«, schreibt er von Rom an Buonarroto, »ich weiß recht gut, daß er ein unverschämter Narr ist, aber ich muß mich an ihn wenden, weil ich Marmor brauche und nicht weiß, wie ich anders welchen bekommen soll. Nach Carrara gehen will ich nicht, weil es mir unmöglich ist, schicken kann ich niemand dahin, der Bescheid wüßte, denn entweder lassen sie sich betrügen oder betrügen selber, wie Bernardino, der Schuft, der mich zuletzt hier um 300 Dukaten betrog und hinterher noch in ganz Rom über mich herumlamentierte, wie ich erfahren habe. Nehmt euch wie vor dem Feuer vor ihm in acht und laßt ihn euch nicht ins Haus kommen.« Solche Geschichten mögen oft vorgefallen sein. Die Italiener lassen beim gewöhnlichen Handel und Wandel eine so große Summe von Täuschung, Geschrei und Leidenschaft mit einfließen, daß ein Nordländer sich erst langsam daran gewöhnen muß. Auch Michelangelo widerstrebte dies Verfahren. Er war die Redlichkeit selbst in allen seinen Verhältnissen, aber bestand darauf, daß die Bedingungen, unter denen er auf ein Geschäft eingegangen war, streng innegehalten würden. Deshalb ließ er sich auch ungern auf verwickelte Kontrakte ein; für eine bestimmte Summe am liebsten übernahm er seine Aufträge in Pausch und Bogen. Bei Zahlungen notierte er auf Heller und Pfennig seine Ausgaben. Wo er mit seinen Brüdern aneinanderkam, geschah es deshalb, weil diese, entweder direkt oder durch den Vater, ihn zu unklaren Spekulationen zu bewegen versuchten, und wo er sich mit den Auftraggebern entzweite, lag der Grund darin, daß man die Kontrakte anders auslegte, als sie gemeint gewesen waren. Michelangelo bestand überall auf seinem Rechte, und so groß die Summen gewesen sind die er verschenkt hat, und so unbekümmert er sie fortgab, ebenso hartnäckig leistete er Widerstand, wenn ihm das Geringste unrechtmäßigerweise vorenthalten wurde.
Und glaubte er bei solchen Gelegenheiten, daß ihm Unrecht geschehen sei, so war ihm dann allerdings der härteste Ausdruck der liebste. Es sind schon Proben dieser Offenherzigkeit mitgeteilt worden: Michelangelo schonte den Papst selber nicht. Im Jahre 1518 hatte er von einer geistlichen Körperschaft in Florenz ein Stück Terrain gekauft und war dabei seiner Meinung nach übervorteilt worden. Die Herren beriefen sich auf eine Bulle des Papstes, welche ihnen formelles Recht zu ihrem Verfahren gäbe. Jetzt schreibt Michelangelo an den Kardinal Medici. Wenn der Papst, heißt es in dem Briefe, Bullen erlasse, welche das Recht gäben, Raub und Diebstahl zu treiben, dann wolle er doch gleichfalls um einen solchen Freibrief für sich gebeten haben. Habe der Papst aber diese Gewohnheit nicht, dann verlange er, daß ihm zu seinem Rechte verholfen werde. Es begreift sich, daß mit jemand, der einen solchen Stil schrieb, nicht leicht zu verhandeln war.
Als Michelangelo Ende Februar 1518 in Carrara ankam, fand er die bedungenen Arbeiten nicht kontraktmäßig ausgeführt. Er geriet mit den Reedern in Streit, denen der Transport der Blöcke übertragen worden war. Rasch entschlossen geht er nach Genua und mietet dort eine Anzahl Barken. Sie langen an, ihre Mannschaft aber wird von den Carraresen bestochen, und es kommt so weit, daß Michelangelo in seiner Wohnung angegriffen und belagert gehalten wird. Sie wollen ihn nicht fortlassen, wenn er nicht nachgäbe. Jetzt wendet er sich nach Florenz, man möge aus Pisa Fahrzeuge senden, geht selbst dahin, um die Sache zu betreiben, und setzt endlich seinen Willen durch. Nun aber will er den Carraresen zeigen, daß sie entbehrlich seien: er wendet sich nach dem nahen, auf florentinischem Gebiete gelegenen Serravezza und Pietrasanta und beginnt dort Marmorbrüche zu eröffnen.
Dies Unternehmen wurde eine Lieblingsidee des Papstes. 1515 war durch einen Gemeindebeschluß der Serravezzaner dem florentinischen Volke alles Terrain geschenkt worden, dessen man für die anzulegenden Arbeiten bedurfte. 1517 hatte Michelangelo Untersuchungen über die Natur des Gesteins anstellen müssen und sich von dessen Brauchbarkeit überzeugt. Der Papst wollte, daß das Material für die Florentiner Kirche auf florentinischem Gebiet gewachsen wäre. Michelangelo aber, dem mehr darum zu tun war zu arbeiten, als die Ausbeutung zweifelhafter Steingruben zu leiten, hatte anfangs solchen Widerstand geleistet, daß es (im Februar 1517) zu einer Korrespondenz zwischen ihm und dem Kardinal Medici kam, in der scharfe Dinge ausgesprochen wurden. Er scheine, lesen wir da, den Marmor von Pietrasanta seines eigenen persönlichen Interesses wegen gegen den von Carrara herabzusetzen. Der Gonfalonier Salviati habe den Stein an Ort und Stelle untersucht und vortrefflich befunden. Der Papst sei rücksichtslos entschlossen, keinen anderen beim Bau von San Lorenzo zur Anwendung zu bringen, und man werde alle weiteren Einreden Michelangelos als offenes Aufsagen des Gehorsams betrachten.
Also eigennützige Absichten zugunsten Carraras! Michelangelo scheint sich dennoch an diese Drohungen nicht gekehrt zu haben, denn erst vom März 1518 ist ein anderes Schreiben des Kardinals, der nun in den gnädigsten Ausdrücken die Zufriedenheit des Papstes zu erkennen gibt, daß in Pietrasanta so ausgezeichneter Marmor entdeckt worden sei, und der zugleich die Zusage enthält, alle Schwierigkeiten, die Straße betreffend, würden rasch beseitigt werden. Es handelt sich nun nämlich, und zwar beinahe wie um die Hauptsache selber, um die Anlage eines fahrbaren Weges von den Bergen zum Meeresufer, ein kostspieliges Unternehmen, da nicht nur die Steilheit des Gebirges, sondern auch die sumpfige Beschaffenheit der Ebene zu überwinden war. Der Papst suchte die bedeutenden Kosten dadurch zu ermäßigen, daß er die Zunft der Wollenweber bewog, für ein neues in Santa Maria del Fiore nötiges Marmorpflaster sich an der Unternehmung zu beteiligen; alles aber in der Art, daß Michelangelo die gesamten Anlagen auf sein Risiko übernahm, und indem er mit dem Papste und der Zunft der Wollenweber kontrahierte, den Straßenbau und die Steinbrüche der Serravezza als sein eigenes Geschäft beginnen ließ.
Daß dem so sei, behauptete wenigstens Michelangelo. Vielleicht haben die verschiedenen, nicht näher bezeichneten Hindernisse, welche sich, wie seine Briefe lehren, der endlichen Ausfertigung der betreffenden Kontrakte entgegensetzen, in einer Verschiedenartigkeit der Auffassung bei den verhandelnden Parteien ihre Ursache gehabt. Monatelang dringt Michelangelo auf Abschluß, ohne seinen Zweck zu erreichen. Endlich wird es ihm zuviel. Er ist in Serravezza anwesend und will arbeiten lassen. Der Gonfalonier, schreibt er an Buonarroto, scheine nichts tun zu können und deshalb die Sache zu stocken, er für sein Teil werde sich jetzt entweder an den Papst oder an den Kardinal Medici wenden, alles liegen und stehen lassen und nach Carrara zurückkehren, wohin man ihn, als wäre er unser Herr Christus selber, mit tausend Bitten zurückverlange. Man war dort, scheint es, zur Besinnung gekommen. Der Marchese Malespina, der Besitzer von Carrara, der, wütend über das Unternehmen bei Pietrasanta, Michelangelo so viel Unannehmlichkeiten hatte bereiten lassen, zeigte sich nun, da er dessen Hartnäckigkeit sah, nachgiebiger. Von beiden Seiten also wurde der Verdacht gegen ihn erhoben, es sei der eigene Gewinn im Spiele.
Michelangelo selber sehnte sich nicht ohne Grund nach Carrara zurück: »Diese Handarbeiter«, heißt es in dem eben angeführten Briefe weiter, »wissen nichts anzupacken. Hundertdreißig Dukaten hat mich ihre Arbeit schon gekostet, und bis jetzt ist noch kein Fuß breit brauchbarer Marmor zutage gebracht worden. Sie laufen herum, tun als täten sie etwas, und bringen nichts vor sich. Dabei suchen sie heimlich für den Dombau und andere zu arbeiten, wofür ich sie mit meinem Geld bezahlen muß; ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber der Papst soll genau wissen, wie es hier zugeht; 300 Dukaten habe ich so fortgeworfen und sehe noch nichts, das für mich geschafft worden ist. Es wäre leichter, Tote wieder lebendig zu machen, als Leben in dies Gebirge und etwas Kunstverstand hier unter die Leute zu bringen. Wenn mir die Wollenweberzunft 300 Dukaten alle Monate gäbe, würde ich noch schlecht genug bezahlt sein für das, was ich leiste, und so kann ich nicht einmal durchsetzen, daß der Kontrakt zustande kommt. Empfiehl mich Salviati (dem Gonfalonier) und schreibe mir durch meinen Diener, wie die Dinge stehen. Ich muß einen Entschluß fassen, denn so in der Schwebe kann ich nicht länger bleiben.« Nachschrift: »Die Barken, die ich in Pisa gemietet habe, sind ausgeblieben. Also auch auf dieser Seite geht alles schief. Tausendmal vermaledeit Tag und Stunde, wo ich von Carrara fortging. Das allein ist an allem Unheil schuld. Aber ich kehre dahin zurück. Wer heutzutage eine Sache gut machen will, der hat nur Schaden davon.« So schreibt er am 18. April 1518. Tags zuvor erst war er in Carrara gewesen, wo er einen florentinischen Bildhauer damit beauftragt hatte, seine Blöcke fortschaffen zu lassen. Er scheint sich mit den Leuten dort wieder ausgesöhnt zu haben und teilt fortan seine Zeit zwischen Carrara und Pietrasanta, läßt an beiden Stellen arbeiten, geht dazwischen wieder nach Florenz, wo man den Grund der Fassade von San Lorenzo legt und wo er im August ein Grundstück kauft, auf dem ein Haus gebaut wird. In den neuen Brüchen dagegen nimmt die Plage kein Ende. Krankheiten seiner Leute, Betrug, Faulheit, Widerspenstigkeit, deren letztes Ende ist, daß sie ihn ganz im Stiche lassen. Im September schreibt er rein verzweifelnd darüber. Der Regen will nicht aufhören im Gebirge, es ist kalt, die Arbeit wird eingestellt. Dennoch hält er den Winter über dort aus, ganz allein, scheint es. Im Oktober war er selber krank geworden und nach Florenz gegangen, am letzten dieses Monats aber schon ist er zurück. Im Dezember geht er dann wieder nach Florenz, aber nur um Weihnachten dort zu feiern. Endlich, im Frühjahr 1519, hat er es so weit gebracht, daß eine Anzahl bis auf einen gewissen Punkt bearbeiteter Säulen und Blöcke an das Meeresufer herabgeschafft worden sind, um nach Florenz verschifft zu werden, wobei eine der Säulen in Stücke ging: da plötzlich aus Rom der Befehl, alles liegen zu lassen, weil der Bau bis auf weiteres aufgeschoben sei, und keine Bezahlung!
In seiner Denkschrift über den Fassadenbau von San Lorenzo spricht Michelangelo mit Entrüstung über die Art, wie man ihn schließlich behandelt habe. »Und nun«, schreibt er, »untersagt mir der Kardinal Medici, im Namen des Papstes, mit den Arbeiten fortzufahren. Vorgegeben wird, man wünsche mich der Beschwerde zu überheben, den Marmor unter so viel Anstrengungen aus dem Gebirge herunterzuschaffen, man werde mir in Florenz bessere Aufträge zuweisen und wolle einen neuen Kontrakt mit mir abschließen, – und dabei ist es geblieben bis zum heutigen Tag!« Und zu derselben Zeit werden von seiten der Florentiner Dombauverwaltung Arbeiter nach Serravezza geschickt, welche sich der von Michelangelo gebrochenen Blöcke bemächtigen und sie auf der von ihm gebauten Straße ans Meer und weiter nach Florenz bringen. Einesteils sollte Santa Maria del Fiore damit gepflastert, andererseits der Bau der Fassade ohne Michelangelos Mitwirkung dennoch weiter betrieben werden.
Er behauptet nun, man habe sich der Straße wegen vorher mit ihm auseinanderzusetzen. Die Dombauverwaltung will darauf nicht eingehen. Sie hätte 1000 Dukaten für die Steinbrüche hergeben müssen und glaubte sich in ihrem Rechte, während Michelangelo dies Verfahren als einen Eingriff ansah, den er nicht zu gestatten brauche. Er dringt auf Erfüllung der Verbindlichkeiten und betrachtet bis dahin alles als sein Eigentum. Denn er habe die Sache in Bausch und Bogen übernommen und somit für sich allein arbeiten lassen.
»Der Kardinal«, fährt er fort, »verlangt jetzt von mir eine Aufstellung der Kosten und Auslagen, damit er sich mit mir vergleichen und den Marmor und die Straße nach Serravezza benutzen könne. 2300 Dukaten habe ich empfangen. Wann und wo, belegen die angeschlossenen Rechnungen. Davon sind 1800 ausgegeben. 250 für den Transport meines Marmors von Rom nach Florenz. Außer Rechnung lasse ich dabei das nach Rom geschickte Holzmodell, außer Rechnung die drei Jahre Arbeit, die ich verloren habe, außer Rechnung, daß ich ruiniert bin durch diesen Bau, außer Rechnung, in welchem Lichte ich dastehe, daß man mir das Werk übertragen und dann, ohne einen triftigen Grund anzugeben, wieder genommen hat, außer Rechnung mein Haus in Rom, wo für mehr als 500 Dukaten Marmor, Gerät und fertige Arbeit zugrunde gegangen sind: für all das bleiben mir von dem Gelde gerade 500 Dukaten übrig.«
»Aber gut so: der Papst nehme die von mir gebaute Straße samt dem gebrochenen Marmor, und ich behalte, was ich von Geld noch in Händen habe, bin meiner Verpflichtungen quitt und ledig und setze über alles eine Schrift auf, die der Papst unterzeichnet.« So Michelangelos Vorschlag. Die Blätter, woraus ich diese Sätze zitiere, scheinen das von ihm für sich selbst oder für einen seiner Freunde aufgesetzte Brouillon, nach welchem die Schrift ausgearbeitet werden sollte, welche Leo zu unterzeichnen hätte. Alle Ausgabeposten sind bis auf das geringste ausgeführt. Es ist unbekannt, zu welchem Ende die Angelegenheit gediehen ist. Im Jahre 1521 kam die erste und einzige der in Pietrasanta zugehauenen Säulen in Florenz an. Jahre lang lag sie dort auf dem Platze vor San Lorenzo, bis sie, wahrscheinlich nur um beseitigt zu werden, an Ort und Stelle unter die Erde gegraben ward. Die anderen lagerten noch zu Vasaris Zeiten auf dem Meeresufer bei Pietrasanta. In späteren Jahren erst wurden diese Steinbrüche regelmäßiger ausgebeutet und die Transportmittel vervollkommnet. Michelangelo entdeckte im Gebirge einen bunten, sehr harten, aber schön zu behandelnden Marmor, um dessentwillen in späteren Zeiten der Herzog Cosimo eine vier Miglien lange Fahrstraße bauen ließ. Als in dessen Auftrage 1568 die Berge dort untersucht wurden, fand man alles, wie Michelangelo es verlassen und die mit M gezeichneten Steine, die wichtige Punkte bezeichnen sollten.
VI
Michelangelo konnte sich mit einigem Rechte über die Medici beklagen: sehen wir die Gründe aber, aus denen der Bau der Fassade in jener Zeit ins Stocken geriet, so bleibt doch nur das allgemeine Schicksal als der Schuldige übrig. Zu der Zeit, wo der Bau beschlossen ward, stand die Familie auf dem Gipfel ihrer Macht. Von 1516 an aber war der Umschlag eingetreten. Gegen die Intrigen der Menschen waren sie stark genug gewesen: gegen den Tod vermochten sie so wenig als andere Sterbliche, und dieser vernichtete jetzt den stolzen Aufbau, den, der Zukunft vorgreifend, die Familie in Gedanken für sich errichtet hatte.
1516 starb Giuliano. Lange schon hatte er sich krank und melancholisch hingeschleppt. Ein Sonett von ihm ist erhalten, in dem er den Selbstmord verteidigt. Die herrschende Epidemie jener Zeiten fraß ihn langsam auf. Er war un uomo dabbene, urteilte man, und indem die Italiener von damals ihm ein solches Zeugnis der Ehrenhaftigkeit ausstellen, zeigen sie, daß doch das allgemeine Gefühl des Guten und Sittlichen immer gewürdigt und anerkannt wurde. Zu dem projektierten Königreiche Lorenzos war das Herzogtum Urbino durchaus unentbehrlich. Giuliano aber wußte, so lange er lebte, trotz der politischen Notwendigkeit zu verhindern, daß den Roveres etwas zuleide geschähe. In den bösen Zeiten des Exils hatte er in Urbino Aufnahme gefunden, und auch Leo, obgleich er den verstorbenen Giulio (ganz wie dieser Alexander Borgia) einen verfluchten Juden genannt, fühlte sich dessen Familie verpflichtet. Giulianos letzte Worte, die er mit seinem päpstlichen Bruder wechselte, waren eine Bitte zugunsten der Roveres. Leo erwiderte, er möge vor allem nur daran denken, bald wieder gesund zu werden. Kaum aber war Giuliano tot, als die Galgenfrist des Herzogs von Urbino abgelaufen war. Leo erklärte, der alte Mord am Kardinal von Pavia, um dessentwillen Giulio seinen Neffen in den Bann getan, in der Folge aber auch wieder absolviert hatte, sei noch ungesühnt, tat den Herzog aufs neue in den Bann, enthob ihn seiner Würde und machte Lorenzo dei Medici zum Herzog von Urbino.
Wir können, was nun folgte, als Unglück auffassen, genauer betrachtet wartete doch nur die natürliche Rache des Schicksals. Denn Leo hatte nicht nur Unrecht getan, sondern auch gegen seine innerste Natur gehandelt. Er war eigentlich bequem, liebte die Ruhe, wollte seinen Neigungen leben, im Vatikan sich das Geschwätz der Stadt zutragen lassen und mithineinreden, ein bißchen Kunst beschützen, ein bißchen auf die Jagd gehen, ein bißchen die Sitten der Geistlichen verbessern (wenn ein Geistlicher öffentlich auf den lieben Gott geflucht oder schimpfliche oder sogar obszöne Dinge auf den Herrn Christus oder die Jungfrau Maria gesagt hat, soll er, wenn er ein öffentliches Einkommen hat, das erste Mal drei Monate davon einbüßen, ein Herr von Adel dagegen hat nur fünfundzwanzig Dukaten zum Besten der Peterskirche zu erlegen; dies eine Probe von den neuen, verschärften Strafgesetzen) – kurz, der Papst war milde und liebenswürdig, und die Worte, die er nach seiner Erhebung zu Giuliano sagte: »Genießen wir nun die Herrschaft, die uns Gott gegeben hat«, waren gewiß aus tiefster Seele gesprochen.
Lorenzo aber und dessen Mutter Alfonsina bildeten das treibende Element. Sie stachelten Leo, der lieber mit der Zeit gelegentlich gehandelt hätte, zu rascherer Politik. Stolz, auffahrend, kriegerisch und von Ehrgeiz verzehrt, noch um die Hälfte mehr ein Orsini, als sein Vater Piero gewesen war, verachtete Lorenzo die stille Methode seiner Oheime. Er setzte den Krieg gegen Urbino durch und focht ihn aus in den Jahren 1517 und 18. Der Herzog von Urbino wird vertrieben, in Rom aber zettelt dessen Partei ein Komplott gegen das Leben des Papstes an (wieder war jener San Giorgio dabei beteiligt), die Verschwörung wird entdeckt, und die schuldigen Kardinäle, statt zu fliehen, werfen sich mit reumütig tränenvollem Bekenntnis dem Papste zu Füßen, der ihnen verzeiht. Nichts zeigt so sehr den Charakter Leos. Daß man ihm in einem solchen Falle zutraute, er werde verzeihen, und daß die Rechnung eine richtige war, beweist, wie sehr man die geheime Schwäche seines Wesens kannte. Giulio der Zweite hätte sie alle miteinander daran glauben lassen.
Endlich hat Lorenzo nun das Herzogtum in seiner Gewalt. Eine französische Prinzessin ist seine Gemahlin. Im Jahre 1518 feiert er die Hochzeit, das folgende aber wird sein Todesjahr. Und zu derselben Zeit sterben seine Mutter Alfonsina und Magdalena Cybo, Leos Schwester, nachdem Contessina Ridolfi schon früher vorangegangen war. Das war das Ende aller Pläne. Der Papst saß nun allein im Vatikan, in dessen Gärten der kleine Hippolyt, Giulianos nachgelassener unehelicher Sohn, spielte, sein einziges Kind überhaupt; in Florenz übernahm der Kardinal Medici die Regierung.
Wofür sollten die beiden sich jetzt noch bemühen? Aber auch hier die Heilung der Krankheit in dem Übel selbst wieder, das sie verursacht: Leos alte, unbesorgte Natur ließ sich nicht irre machen. Nach wie vor gab er sich den Dingen hin, die ihm die Zeit vertrieben, und statt über dem Unheil zu brüten, das ihn so arg betroffen hatte, jagte er, sang er, schwatzte er und verfolgte die allgemeine Politik der Päpste weiter: keine fremde Macht in Italien aufkommen zu lassen und sich der europäischen Fürsten, eines gegen den anderen zu bedienen. Nur Geld ausgeben konnte er nicht mehr wie früher. Alles war verschwendet. Der ganze ungeheure Schatz, den Giulio der Zweite aufgesammelt und Leo hinterlassen hatte, war daraufgegangen. Der Krieg Lorenzos gegen Urbino hatte zuviel gekostet. Alle Tage mußte ein frischer Korb mit Goldstücken dem Papste zur Hand stehen, der abends geleert war: 8000 Dukaten wurden dafür allein jeden Monat erfordert. Die Juwelen der Krone waren bei Chigi versetzt. Kardinalstellen wurden verkauft. Es waren wirklich die Mittel nicht mehr vorhanden, den Bau der Fassade von San Lorenzo fortzuführen. Man hätte gern weitergebaut, wenn es möglich gewesen wäre.
Von den neuen Arbeiten, mit denen Michelangelo zum Ersatz bedacht werden sollte, verlautete nichts einstweilen. So mißmutig war er, daß er eine Zeitlang gar nichts anrühren mochte und, was er etwa begann, unfertig wieder stehen ließ. Einige seiner unvollendeten Skulpturen, deren eine ziemliche Anzahl vorhanden sind, gehören vielleicht in diese Zeit. Zuletzt wandte er sich wieder zum Grabdenkmale Giulios, dessen Blöcke teilweise nun in Florenz lagen. Mit dem Kardinal Medici stand Michelangelo gut. Der Kardinal war ein ernster Mann, der statt des prachtvollen Hofes, in dessen Mitte Lorenzo mit seiner Gemahlin regiert hatte, einsam und still im Palaste Medici saß und die Gesellschaft geistreicher liberaler Männer suchte, deren Einfluß auf die Regierung nicht verborgen blieb.
Von diesem Umschwung im geistigen Leben der Stadt gibt ein Dokument Kunde, das, datiert aus dem Herbste 1519, Michelangelo als einen der Männer erscheinen läßt, die die geistige Aristokratie der Stadt bildeten. Es existierte noch immer die Stiftung des alten Lorenzo, die platonische Akademie in Florenz, in der philosophiert und gedichtet ward und die an öffentlichen Tagen die Blüte ihrer Bestrebungen dem ganzen Volke darzulegen pflegte. Heruntergekommen aber, fristete sie nur noch ein kümmerliches Dasein. Der Kardinal Medici brachte neues Leben in diese Dinge; im Oktober 1519 geht eine Bittschrift nach Rom ab, worin an die Gnade des Papstes appelliert wird, einmal um die Gewährung von Geldmitteln, dann aber um die Erlaubnis, Dantes Asche nach Florenz zurückbringen zu dürfen. Diese Bitte entsprang keiner romantischen Laune, etwa daß den Florentinern mehr an dem Namen des großen Dichters als an ihm selbst gelegen hätte: Dantes Gedicht war für Florenz etwa, was Homers Gesänge für Griechenland. Seit den öffentlichen Vorlesungen, welche Boccaz über ihn gehalten, finden wir immer wieder das Verlangen auftauchen, Dante müsse öffentlich erklärt werden. Zu Ende des 14. Jahrhunderts sorgte der Staat selbst dafür und setzte dem für dieses Amt zu erwählenden Gelehrten 100 Goldgulden jährlich aus, eine bedeutende Summe. Zu Anfang des 15. sehen wir diese Bestimmung erneuert. 1495 war Dantes Urenkel von den Folgen, welche die Verbannung seines Vorfahren etwa für ihn haben könnte, entbunden worden. Jetzt endlich verlangte man die Asche zurück.
Michelangelo liebte Dante vor allen anderen Dichtern. Er wußte ganze Gesänge von ihm auswendig. Seine eignen Gedichte bewegen sich in Dantes Formen und Anschauungen. Er soll ein Buch mit Umrissen zu Dante gezeichnet haben, das bei einem Schiffbruche verloren ging. Wir finden Michelangelos Namen mit unter der Petition. »Ich Michelangelo, der Bildhauer«, schreibt er, »ersuche gleichfalls Eure Heiligkeit und erbiete mich, dem göttlichen Dichter ein seiner würdiges Denkmal an einem ehrenvollen Orte in der Stadt aufzurichten.« Während die anderen nur um die Asche des Dichters und um Geld bitten, faßt Michelangelo die Sache anders und will ein Denkmal für ihn liefern. Er konnte das wohl, denn er war ein wohlhabender Mann, der sparsam lebte, für große Zwecke aber nie sein Geld zurückhielt.
Wir sehen aus den Unterschriften dieser Supplik zugleich, in welcher Gesellschaft er sich damals bewegte. Die bedeutendsten Namen der Stadt finden wir da vereinigt, den literarisch gebildeten Adel von Florenz, alle lateinisch gefaßt (statt Palla Rucellai lesen wir Pallas Oricellarius), nur Michelangelo schreibt dazwischen: io Michelagniolo schultore und so weiter. Italienisch, weil er Latein nicht verstand und weil er stolz auf die Sprache Dantes sie nicht zurückgesetzt wissen wollte. Öffentliche Dinge, sagte er, müßten in der Sprache aufgezeichnet werden, in der sie mündlich verhandelt würden. Er ist der einzige Künstler, der unter der Bittschrift steht. Es scheint, daß er sich aus den eigentlichen Künstlerkreisen ganz entfernt hielt. Aber, wie ein großer Gelehrter, der sich einsam in seiner Stube hält, dennoch die Seele einer ganzen Universität sein kann, so bildete er den Mittelpunkt der Florentiner Kunstbestrebungen.
Überhaupt, so zurückgezogen Michelangelo lebte, sein Auge wachte über allem, was geschah. Er trat nur selten öffentlich auf, bei solchen Gelegenheiten nur, wo er Einwirkung für unentbehrlich hielt, dann aber auch geschah es mit aller Energie. Sein alter Freund Baccio d'Agnolo, oberster Architekt an Santa Maria del Fiore, hatte für die noch unvollendete Kuppel des Domes den Entwurf einer außen, an der Stelle wo die Wölbung beginnt, rings umlaufenden Galerie gemacht, nach welchem bereits ein ziemliches Stück Arbeit zustande gebracht worden war. Brunelleschis Zeichnung dafür war verloren gegangen. Da läßt Michelangelo seine Augen einmal wieder über Florenz hingehen und entdeckt was geschieht. Er bemerkt, wie man der kühnen Art Brunelleschis entgegen und im Widerspruch gegen den ganzen Bau einen schmalen Gang um die Kuppel zieht, er sieht, wie man die mächtigen Tragsteine abmeißelt, welche Brunelleschi für das zukünftige Werk hatte ausragen lassen. Jetzt half keine Freundschaft mehr. Was der Heuschreckenkäfig da oben solle? Etwas Gewaltiges, Großartiges gehöre dahin. Er wolle zeigen, wie es zu machen sei.
Eine Kommission aus sachverständigen Künstlern und Bürgern verhandelt darauf die Angelegenheit in Gegenwart des Kardinals. Michelangelo legt seine Zeichnung vor, welche mit der Baccios verglichen wird. Solche Kommissionen, selbst wenn die klügsten Leute dabei sind, bringen nie Entscheidendes zustande: man begriff, daß Baccio etwas, wenn auch gut Angelegtes, doch zu Kleines, Unbedeutendes geliefert habe, konnte sich aber auch nicht zu Michelangelos Vorschlägen entschließen. Und so steht heute noch die Kuppel des Domes da, halb umgeben von Baccios Galerie, halb von den ausspringenden Tragsteinen Brunelleschis umringt. Das ist die wahre Geschichte des ungerechten Vorwurfs, den Passavant in seinem Leben Raffaels gegen Michelangelo erhebt: er habe die Vollendung der Kuppel des Doms von Florenz verhindert! Wie sehr Michelangelo die Werke Baccio d'Agnolos zu schätzen und zu schützen wußte, zeigt in späterer Zeit seine Sorge um den Turm der Kirche von San Miniato, der gerade jetzt zu bauen begonnen ward. Michelangelo hatte stets die Sache und niemals die Person im Auge. Daher so oft die schneidende Härte, mit der er auftrat, von der aber in den meisten Fällen die Betroffenen selber nicht beleidigt wurden. Sie verstanden ihn.
Noch eine unbedeutendere Arbeit für den Kardinal sei erwähnt, als in diese Zeit fallend. Im Erdgeschosse des Palastes Medici, den Michelozzo einst für den alten Cosmo errichtet hatte (heute unter dem Namen Palazzo Riccardi bekannt, da er in späteren Zeiten, als die Medici größere Paläste zu ihrer Residenz benutzten, verkauft worden war), befand sich eine Loggia, ein nach der Straße zu offener Raum, in welchem die Bürger der Stadt zu gelegentlichen Besprechungen zusammenzukommen pflegten. Der Kardinal ließ sie in ein geschlossenes Zimmer verwandeln. Die offenen Bogen wurden vermauert und Fenster eingesetzt. Michelangelo machte die Zeichnung dazu. Berühmt war das nach seiner Angabe vom Goldschmied Piloto anfertigte bronzene Gitterwerk der Fenster. Das Innere des Zimmers malte Giovanni da Udine aus, einer von den Gehilfen Raffaels, der ihm im Vatikan zur Hand gegangen war, besonderen Ruhm aber durch die Girlanden an der Decke der Farnesina erwarb, jene Blumenarchitektur, zwischen der Raffael die Geschichte der Psyche malte.
VII
Bald zeigte sich, daß der Kardinal wirklich nicht bloße Ausflüchte gemacht hatte, indem er Michelangelo auf würdigere Arbeit vertröstete, und es könnte jetzt gleich von dem Werke die Rede sein, das, im Winter 1519 bedacht, zu Ostern des folgenden Jahres begonnen war, fiele nicht auf dieselben Ostern 1520 das Ereignis, welches diesem Jahre für die Kunstgeschichte eine traurige Berühmtheit gegeben hat: der Tod Raffaels.
Noch um Weihnachten 1519 war Michelangelo an ihn erinnert worden. Sebastian del Piombo schrieb aus Rom, daß die Erweckung des Lazarus vollendet sei. Zuerst meldet er die glücklich vorübergegangene Taufe seines Söhnchens, dessen Pate Michelangelo war. Der Kleine hatte den Namen Luciano erhalten. Sodann, er habe das Gemälde in den Palast geschafft und sei mit dessen Aufnahme außerordentlich zufrieden. Nur die »Gewöhnlichen« hätten nichts zu sagen gewußt. Damit will er die Partei des Raffael bezeichnen, wie die gleich folgende Bemerkung bestätigt: er glaube, daß sein Bild besser gezeichnet sei als die eben aus Flandern angekommenen Teppiche.
Sebastians Gemälde ist nach mancherlei Schicksalen in die Londoner Nationalgalerie gelangt, ein vielfach beschädigtes nachgedunkeltes Werk, dessen außerordentliche Farbenwirkung aber noch sehr wohl zu erkennen ist. Vorn rechts sitzt Lazarus. Eben erwacht aus dem Totenschlafe und noch halb im Dämmerzustande der Betäubung, sucht er die linnenen Binden von sich abzureißen, mit denen er umhüllt ist. Um ihn her beschäftigte Männer wollen diese Mühe übernehmen, Lazarus aber, wie ein Mensch, der sich aus einem Gefängnisse rettet, zerrt selber an den Tüchern, die er mit der rechten Hand von dem linken Arme fortschaffen will, während er die Zehen des rechten Fußes in die Binden einbohrt, die um das linke Schienbein sitzen. Diese Bewegung bekundet Michelangelos Anteil an dem Bilde auf den ersten Blick, denn kein anderer hätte das ersonnen und so lebendig ausgeführt.
Lazarus gegenüber, auf der linken Seite des Gemäldes, steht Christus, die eine Hand dem erwachenden Manne entgegengestreckt, die andere mit ausgebreiteten Fingern erhoben. Vor ihm kniet Maria und blickt mit dem Ausdrucke glückseliger Dankbarkeit zu ihm auf; um ihn her von allen Seiten drängen sich die Jünger, die das Wunder mit dem Gefühl heiligen Schauers erfüllt. Den Hintergrund nehmen eine Menge von Figuren ein, sämtlich mit ungemeiner Lebendigkeit ausdrückend, was in ihnen vorgeht, keine einzige als Nebensache behandelt, und die Ferne bildet eine Landschaft, die Ansicht einer Stadt mit einem Flusse, über den eine Brücke führt, und ein mit Wolken belastetes Gebirge dahinter: – Sebastian hatte wohl Grund, stolz zu sein auf das mühsame Werk. Er bittet Michelangelo, in Florenz beim Kardinal die baldige Bezahlung zu bewirken, da er des Geldes bedürftig sei.
Leider ist dies nicht der einzige Brief unter den an Michelangelo zu jener Zeit aus Rom gerichteten, welcher Ungünstiges über Raffael enthält. Michelangelo hatte Anhänger in Rom, die es sich zum Geschäfte machten, Raffaels Werke herabzusetzen. So lesen wir das Härteste über die große Madonna, welche an Franz den Ersten ging, nicht minder scharf werden die Malereien in der Farnesina vorgenommen und schließlich, nach Raffaels Tode gesagt, was Raffaels Schüler im Saale des Konstantin als Probe ihrer Fertigkeit gemalt hätten, sei so gut, daß niemand die Gemälde Raffaels selber in den Stanzen nun weiter ansehen möge. Wir müssen uns leider entschließen, in Sebastian del Piombo einen Meister zu erkennen, der neben seinen eigenen Werken die eines Künstlers, der größer war als er, nicht zu beurteilen vermochte. Sebastian war nicht imstande, die Dinge weiter zu begreifen, als sein Geist reichte. Er selbst hat in seinen Gemälden niemals Ideen zum Ausdruck zu bringen versucht. Das Höchste, was er erkennen konnte, war die Technik, in der fast sein einziges Verdienst liegt, aber ein gewaltiges, denn nicht allein in der Farbe, auch in der Zeichnung leistete er Vortreffliches. Michelangelo hat sicherlich anders über den Lazarus und über die Teppiche gesprochen. »Die Teppiche«, sagt Goethe mit Recht, »sind das einzige Werk Raffaels, das nicht klein erscheint, wenn man vor Michelangelos Decke in der Sixtina kommt.« Eine Mannigfaltigkeit der Komposition offenbart sich in ihnen, die Michelangelos Macht im vollsten Maße gleichkommt, und zugleich eine Natürlichkeit und einfache Anmut, in der er selbst sich vielleicht als übertroffen anerkannt haben würde. Wohl möglich, daß der Anblick dieser Arbeit das Eis zwischen beiden Männern zum Schmelzen gebracht haben würde, wie es ja auch bei Schiller und Goethe langer Jahre bedurfte, ehe sie sich in der rechten Weise erkannten. Dazu aber bot sich nun keine Gelegenheit mehr. Sie begegneten sich nicht wieder. Am Karfreitage 1520, wenig Monate nach dem Briefe Sebastian del Piombos, starb Raffael und ließ den großen Michelangelo von nun an allein und ohne würdigen Nebenbuhler in der Welt zurück.
Das war ein Schlag, der den gemütsruhigen Papst doch aus der Fassung brachte. Die vierzehn Tage lang, die das zehrende Fieber dauerte, dem Raffael erlag, schickte er täglich, um nach ihm zu fragen, und brach in Tränen aus, als er die letzte Nachricht erhielt. Aufgezehrt von einem verderblichen Fieber, das ihn bei seinen Ausgrabungen des antiken Roms befallen hatte, ging er zugrunde. Tot lag er da in seinem Palaste, ihm zu Häupten stand seine letzte Arbeit, das unvollendete Gemälde von der Himmelfahrt Christi. Eine ungeheure Menschenmenge begleitete die Leiche zum Pantheon, wo die Marmorinschrift, die sein Grab verschließt, noch heute zu lesen ist. Sie sagt, daß er an demselben Tage gestorben sei, an dem er geboren ward.
Ein Jahr früher schon war Leonardo da Vinci gestorben in Frankreich, wo Franz der Erste ihm eine ehrenvolle Stellung bereitet hatte. Leonardo sah Italien nie wieder, wir haben wenig Nachrichten aus seinen letzten Jahren. Ein Dokument aber ist vorhanden, beredter als Briefe und Nachrichten: ein Porträt, das er von sich selbst gezeichnet hat, eine Rötelzeichnung in der Sammlung des Louvre. Ein unbeschreibbarer Zug herber Gedanken liegt in seinem Munde und eine finstere Schärfe im Blick, die genugsam beide sagen, daß dieser Mann in Zwiespalt lebte mit seinem Schicksal. Bitterkeit, Verschlossenheit, Überlegenheit, etwas wie das Wesen eines Zauberers redet aus dieser Zeichnung. Wenn man Vasaris Schilderung im Sinne hat, wie Leonardo in jungen Jahren so viel Liebenswürdigkeit ausströmte, daß alles sich festgehalten und mitgezogen fühlte, wenn wir da lesen wie er in jugendlicher Freude durch die Straßen von Florenz ziehend den Vogelhändlern auf dem Markte Geld gab so viel sie verlangten, damit sie ihre Käfige aufsperrten, wenn wir sehen wie sein Geist, im ungemeinen Umfange seiner Kraft schwelgend, schaffend und beobachtend alles erfaßte, alles leistete, und wenn wir ihn im Alter damit vergleichen, fern von seinem Vaterlande, ohne Freunde, die ihn nur vermißten dort, und ohne großartigen Abschluß seiner Tätigkeit in Frankreich, so fühlt man, wie zu den Gaben des Geistes das Glück hinzutreten muß, wenn sie sich entfalten und Früchte tragen sollen. Wie traurig mag er an Italien zurückgedacht haben. Melzi war bei ihm und zeigte den Verwandten in Florenz seinen Tod an.
Leonardos Verlust war ohne Bedeutung für die italienische Kunst, Raffaels plötzliches Verschwinden ein Schlag, der tief empfunden ward. Er starb zu früh, nicht für seinen Ruhm, aber für die Begründung seiner Schule. Er hätte doch Ungemeines schaffen und wirken können. Mit ihm erlosch ein Feuer gleichsam, das den Rädern einer ausgedehnten Fabrik die treibende Bewegung zuführte. »Rom ist leer und ausgestorben für mich, seit Raffael nicht mehr da ist«, schrieb der Graf Castiglione. Wer den plötzlichen Hinweggang einer großen geistigen Kraft jemals erlebt hat und die Leere, die sie zurückläßt, der vermag sich eine Vorstellung zu bilden, wieviel die Stadt an ihm verlor. Denn neben dem, was täglich zur Erscheinung kommt und dankbar empfunden wird bei so großen Naturen, solange sie leben und wirken, fühlt man nach ihrem Verluste erst die geheime aufrechthaltende Kraft, mit der sie alles um sich her erfüllen, ohne daß es sie selber ahnten, die sich stark durch diese fremde Stärke fühlten. Raffael diente in liebenswürdiger Nachgiebigkeit dem Hofe, der ihm viel gewährte: unter der äußerlichen Hülle dieser gehorchenden Freundlichkeit aber lebte ein scharfblickender königlicher Geist, der keiner Gewalt sich neigte und einsam seine eigenen Wege ging, wie die Seele Michelangelos. Wir in Deutschland denken an die Dresdner Madonna zuerst, wenn von Raffael die Rede ist, eines seiner letzten Werke mit und das ergreifendste, als hätte er nach so vielen Madonnen endlich das schönste Antlitz im Geiste gesehen, mit dem die übrigen sich nicht vergleichen lassen. Welch eine Schöpfung! – zu deren Lob sich nichts sagen läßt, so wenig wie zu dem des gestirnten Himmels oder des Meeres oder des Frühlings. Wer davorsteht, vergißt Rom, die Vergangenheit, die irdischen Schicksale Raffaels. Wie ein vertrauter Freund erscheint er uns, der unsere Gedanken kennt, wie eine milde, freundliche Macht, die sich der Formen und Farben nur bediente, um eine grenzenlose Fülle von Schönheit den Menschen mitzuteilen. Es gibt Naturen, denen Michelangelo nicht zusagt, es gibt keinen Künstler, glaube ich, der nicht irgendwo auf Widerstand stieße: – Raffael aber überwindet jeden; kein Mensch, der sich der beglückenden Gewalt seiner Werke verschließen könnte.
Wir wissen nicht durch die kleinste Äußerung, welchen Eindruck auf Michelangelo Raffaels Tod gemacht. Wiederum Sebastian del Piombo meldet das Ereignis. Sogleich kommen nun aber auch schon die praktischen Folgen des Verlustes in Rechnung. Sebastian war jetzt der Erste in Rom. Auf sein Drängen hin gab Michelangelo sich Mühe, die Malerei im Vatikan seinem Schützlinge zuzuschanzen, doch es glückte ihm nicht. Raffaels Nachfolger legten solche Proben ihrer Befähigung ab, daß der Papst, so sehr er den Vorschlägen Michelangelos günstiges Gehör zu leihen schien, Giulio Romano und Francesco Penni, welche das Atelier Raffaels repräsentierten, in ihrer alten Stellung erhielt. Zuletzt, als Sebastian einsah, daß er selber keine Hoffnung hegen dürfe, den Auftrag zu erlangen, wollte er Michelangelo bewegen, die Malerei für sich selbst zu beanspruchen. Hier aber scheiterte er vollständig: Michelangelo wies all dergleichen ab, und die Intrige blieb erfolglos.
Michelangelo wandte sich in dieser Sache niemals direkt an den Papst, sondern an den Kardinal, mit dem er damals im besten Vernehmen stand. Am letzten März des Jahres waren die Maurerarbeiten für das neue ihm vom Kardinal übertragene Werk in Angriff genommen. Die Fassade, das Denkmal des Überflusses und des Stolzes, hatten die Medici aufgegeben, statt ihrer sollte derselben Kirche eine Kapelle mit den Gräbern Lorenzos und Giulianos zugefügt werden; ein Pendant zur alten Sakristei mit den Gräbern der älteren Medicis, die Brunelleschi gebaut.
Indessen, so gut der Wille des Kardinals war, auch hier ließen die Verhältnisse die Fortführung des Werkes nicht recht in Schwung kommen. Das Jahr 20 über verblieb es bei den ersten Anfängen. Michelangelo muß mit der Anfertigung der Modelle beschäftigt gewesen sein. Im April 21 geht er nach Carrara und macht Bestellungen. Er entdeckt dort jetzt, wie Benvenuto Cellini erzählt, einen neuen Bruch, aus dem all der Marmor für die Figuren der Sakristei herkam. Am 22. April 1521 kauft er daselbst 200 Wagenlast Marmor, aus welchem drei Figuren, nach seinen Modellen bis auf einen gewissen Grad zugehauen, Ende 1523 in Florenz abgeliefert werden sollten. Er hatte dafür seine eigenen Steinmetzen an Ort und Stelle. Was abfiel, sollte, zu Werkstücken geschnitten, schon im nächsten Juli in der Stadt sein. Am 23. April kauft er eine zweite Quantität Marmor für eine sitzende Madonna, die bereits Ende 1523 in Florenz erwartet wurde.
Diese Madonna, die erste Figur der gesamten Anzahl, welche ausdrücklich erwähnt wird, gehört nicht zu denen, die ganz vollendet wurden. Bedeutend mehr als die letzte Überarbeitung mangelt ihr. Doch existiert ein kaum fußhohes Modell (in Berlin), das als Michelangelos Arbeit gelten kann. Die heilige Jungfrau sitzt auf einem Sessel ohne Lehne, sie hat, mit dem Oberkörper etwas vorgebeugt, ein Bein über das andere geschlagen, und das Kind sitzt rittlings über ihrem Schoße auf dem höher liegenden Schenkel. Es dreht sich um und nach der Mutter zurück, die das Antlitz ein wenig zu ihm herabneigt. Mit der rechten Hand stützt sie sich (indem der Arm nach hinten zurückgreift) auf die Sitzfläche des Sessels, eine natürliche Bewegung, die hier um so anmutiger wirkt, als sie durch eine reiche und mannigfaltige Gewandung, wie eine Zeichnung durch Farben gleichsam, in einem schöneren Lichte erscheint. Mit der linken Hand hält Maria das Kind an sich, dessen Mund und Händchen nach der sich ihm zudrängenden linken Brust suchen.
Vor dem Jahre 23 aber kann Michelangelo diese Figur in Florenz nicht in Arbeit genommen haben. Als er im beginnenden Sommer 21 aus Carrara zurückkam, sollte jetzt erst die ganze Bestellung kontraktmäßig festgesetzt werden. Er machte seine Vorschläge; der Kardinal war nicht zufrieden damit. Michelangelo erbot sich, das Innere der Sakristei als Modell in Holz, die Figuren in Ton anzufertigen und dann das Ganze gegen eine bestimmte Summe herzustellen. Er hatte gerade einen Ankauf von Grundstücken vor und wünschte das Geld darin anzulegen. Aber vom Kardinal war kein Entschluß zu erlangen. Nun machte der Krieg in der Lombardei seine Anwesenheit bei der Armee notwendig: diesmal sollten von Papst und Kaiser in Gemeinschaft dort einmal wieder die Franzosen herausgejagt werden, und so verläßt Medici Ende September Florenz, um als Bevollmächtigter des Papstes der Kriegführung größeren Nachdruck zu geben.
Vor der Abreise sprach er mit Michelangelo und bat ihn, die Ankunft des Marmors zu beschleunigen, Leute anzunehmen und arbeiten zu lassen, damit er bei seiner Rückkehr den Bau um ein tüchtiges Stück gefördert fände. Das ganze war überhaupt noch so sehr in den Anfängen, daß der Abschluß des Kontraktes späterer Zeit vorbehalten bleiben konnte. Auch gab er zu verstehen, daß die Ausführung der Fassade keine aufgegebene Sache sei; übrigens werde sein Schatzmeister, dem er Auftrag dazu erteilt habe, die erforderlichen Gelder auszahlen.
Dieser aber will nach der Abreise des Herrn keine solchen Befehle empfangen haben und ersucht Michelangelo, sich schriftlich an den Kardinal zu wenden. Hierzu jedoch läßt Michelangelo sich nicht herbei. Nun tritt der plötzliche Tod des Papstes ein. So wenig Geld ist in Rom vorhanden, daß kaum ein einigermaßen würdiges Leichenbegängnis ausgerichtet werden kann. Der Kardinal kehrt zurück, siegreich, durch den Verlust dessen aber, für den er gesiegt, um allen Vorteil seines Erfolges gebracht. Niemand hatte diesen Fall erwartet. Leo war, wenn nicht gesund, doch kräftig und in seinen besten Jahren. Augenblicklich mußte für die Medici die Sorge in den Vordergrund treten, sich selbst in Florenz zu erhalten, wo außer der allgemeinen Freiheitsliebe des Volkes der Haß der einzelnen drohte, vor allem die Feindschaft der Soderinis, die in Florenz, Rom und Frankreich damals so mächtig waren.
Ende Februar 1522 kam der Kardinal in der Stadt wieder an. Michelangelo erhält die besten Worte. Nichts wünsche man sehnlicher, wird ihm versichert, als etwas Ausgezeichnetes von seinen Händen für die Grabmäler zu besitzen, keineswegs aber übergab man ihm den ganzen Bau oder irgendwie bestimmte Aufträge. Michelangelo ging endlich mit der Bemerkung, er werde wiederkommen, wenn die Blöcke aus Carrara angelangt wären. Er kehrte zum Grabmale Giulios zurück, an welchem auch die Jahre vorher immer fortgearbeitet worden war, und zu anderen Werken, von denen wir, ohne sie näher zu kennen, stets annehmen müssen, daß sie ihn beschäftigten; denn in einer Werkstätte wie der seinigen konnte kein Stillstand eintreten.
Als eins von den Werken, welche in diese Zeit fallen, sei die Statue des am Kreuz stehenden Christus in der Kirche sopra Minerva in Rom genannt. Im Jahre 1514 bereits wurde sie von einem römischen Privatmanne bestellt und gelangte zu so großer Berühmtheit, daß Franz der Erste sie später abformen ließ, um in Paris einen Erzguß danach anfertigen zu lassen. Der äußeren Vollendung nach und als Darstellung eines nackten männlichen Körpers in seiner schönsten Blüte, ist sie ein bewunderungswürdiges Werk, als Bild desjenigen aber, an den sie uns doch erinnern soll, die erste Statue Michelangelos, die als manieriert bezeichnet werden muß.
Ein Kunstwerk wird manieriert genannt, wenn bei ihm die Form so behandelt erscheint, daß der geistige Inhalt neben ihr in die zweite Linie gedrängt wird. Die Grenze ist hier oft schwer zu finden. Auch der größte Künstler kann in die Manier verfallen, denn es braucht dazu nicht bloß Nachahmung fremder Eigentümlichkeit: ein leises Abweichen vom reinen Gedanken läßt das reichste, unabhängigste Genie manierierte Werke schaffen. Michelangelos Kraft beruhte in seiner Kenntnis der Anatomie. Er sezierte Körper oder zeichnete sie nach dem Leben in den schwierigsten Lagen, bis ihm die Bewegung der Muskeln durchaus geläufig war. Verkürzungen, welche die Meister vor ihm kaum zu denken gewagt, brachte er zur Anschauung. Er hob das alte steife Exerzierreglement auf und erlaubte den Figuren, frei ihre Glieder zu brauchen. In der Skulptur trat seine Meisterschaft durch die Richtigkeit zutage, mit der er bei jeder Wendung der Gestalt die durchschimmernde Muskellage erscheinen ließ. Hier aber verleitete ihn seine Kunst. Der gewohnten ruhigen Stellungen müde, bei denen die unangespannten Glieder die Veränderung, deren ihre unter der Haut liegenden Teile fähig sind, zu wenig hervortreten lassen, sucht er Schwierigkeiten, nur um sie zu überwinden, und läßt seine Gestalten Wendungen machen, welche weniger die Bewegung des sie erfüllenden Gedankens als die Kühnheit und Kenntnis Michelangelos zeigen.
Die Statue des Christus in der Minerva empfängt an ihrem Platze das in solchen Räumen hergebrachte zerstreute Licht, welches eine richtige Ansicht selten zuläßt. Die Gestalt steht aufrecht, das aus Rohrstäben gebildete Kreuz an ihrer Seite; die rechte Hand hält es mit herabgesenktem Arm unten leicht gefaßt, während die linke, über die Brust herübergreifend, es weiter oben berührt. Die Beine und der Unterkörper sind dabei in der Bewegung nach links gewandt, indem das linke Bein ein wenig vor-, das rechte zurücktritt; der Oberkörper jedoch dreht sich den Schultern mit nach der andern Seite, und diese Drehung der Gestalt über den Hüften ist das Meisterstück der Arbeit.
Die Stellung aber entspricht nicht der Person dessen, den sie erscheinen lassen soll. Nehme ich den Abguß des kleinen, zart ausgeführten Modells der Statue in die Hand, wo Schultern und Kopf fehlen, so glaube ich den Torso eines Achilles zu sehen. Eine schlanke, kühne Vollkommenheit männlicher Kraft läßt diese Bildung ahnen: man denkt, das Haupt müsse ein Helm bedeckt und an dem fehlenden Arm ein Schild gehangen haben. Etwas kriegerisch Heldenhaftes liegt im Aufstehen der beiden Füße, das uns befremdend sein muß bei einer Erscheinung, die sanft hinwandelnd über die Erde gedacht wird, als müßten sich die Blumen auf die er getreten, wieder aufrichten nachher, wie wenn sie nur ein Windhauch beugte.
Dieses Sanfte, Duldende war Michelangelo überhaupt nicht eigen; er konnte nicht in seine Werke legen, was er nicht besaß. Christus' Leichnam stellte er in zart mißhandelter Weichheit dar, aber wo er ihn lebendig gibt, läßt er ihn groß und stark auftreten, wie das auch Raffael zuweilen tut, oder wie er in der uralten deutschen Übersetzung des Evangeliums einhergeht als der »starke, gewaltige Herr«. Wie ein Heerführer in Waffen und die Apostel sein Gefolge von streitbaren Rittern. Etwas Riesenhaftes hat er oft bei Michelangelo, besonders auf seinen Zeichnungen. Ich erinnere an eine, wo der sitzende tote Körper zur Seite hin ineinanderbricht, oder an eine andere, wo er aus dem Grabe auffliegt. Die verschränkten Arme emporgehalten, das Haupt aufwärtsschauend und weit zurückgewandt, die Füße dicht nebeneinander, schwingt er sich aus dem offenen Sarge auf. Eine stürmische Gewalt liegt in der Bewegung. Man meint, er könnte die ganze Erde wie bei den Haaren packen und mit sich reißen. Die Wächter stieben auseinander, als wäre zwischen ihnen ein Vulkan ausgebrochen. Es hat keinen Künstler auf der Welt gegeben, der das sich Bewegende in den Gestalten so in Linien zu fassen vermochte wie Michelangelo.
Bei Beurteilung des Christus in der Minerva muß jedoch in Betracht gezogen werden, daß er nicht ganz von ihm vollendet worden ist. Michelangelo sandte das Werk mit einem seiner Arbeiter nach Rom, der es dort zu Ende bringen und aufstellen sollte. Dieser aber verdarb die Arbeit dermaßen, daß ein anderer römischer Bildhauer angegangen werden mußte, die Statue wieder instand zu setzen. Ein Brief Sebastian del Piombos an Michelangelo sagt, an welchen Stellen die Fehler begangen worden seien: an der Hand, welche das Kreuz halte, am einen Fuße, am Barte und so weiter. Man wußte dem dann so gut abzuhelfen, daß der Besteller sich als vollkommen befriedigt erklärte. Dies war nicht das einzige Mißgeschick, welches Michelangelo bei der Statue zustieß. Er hatte sie überhaupt von frischem in Florenz beginnen müssen, weil die erste, die er in Rom angefangen hatte, wegen eines Fehlers im Steine ganz aufgegeben werden mußte.
Der Tätigkeit des römischen Mitarbeiters darf ein Teil des Eindruckes wohl zugeschrieben werden, den die Statue macht. Seltsam ist auch das Antlitz, das eine fast individuelle Physiognomie zeigt, dazu bis in den Rücken hinabgelocktes Haar: man würde die Gestalt, unbefangen davor tretend, für einen Johannes erklären.
VIII
Die Jahre 1519 bis 22 werden zu den glücklichsten der Stadt Florenz gezählt. Endlich hatte man durch das zu erwartende Aussterben der Familie eine Befreiung von ihrer auf erbliche Herrschaft losdrängenden Tyrannei vor Augen. Der Kardinal ließ, als er für seinen Neffen Lorenzo eintrat, dessen auch schon äußerlich monarchische und mit rücksichtslosen Mitteln arbeitende Regierungsweise fallen und richtete die Dinge wieder mehr nach der Idee des Selbstgouvernements ein. Mit allen Parteien stellte er sich gut. Der Bürgerschaft ward ein Teil ihrer Befugnisse freiwillig zurückgegeben; von einer idealen Verfassung war die Rede, welche die Stadt sich in nächster Zukunft selbst zu erteilen hätte, und als im Jahre 1521 die Franzosen, die bis dahin die Herren in Italien gewesen waren, unterlagen und die Furcht vor ihrem Einflusse auf die an gewaltsamere Wege zur Freiheit etwa denkenden Bürger verschwunden war, milderte sich die Strenge des mediceischen Regiments in unerhörter Weise.
Die Übermacht Franz des Ersten hatte seit 1515 auf dem Papste gelastet. Schon damals, als Leo nach dem Siege des Königs bei Marignan gute Miene zum bösen Spiel machen und sich ihm nachgiebig in die Arme werfen mußte, wollte er mit Franz lieber in Bologna als in Florenz zusammenkommen. Die Anwesenheit des Königs in Toskana erschien ihm als zu bedenklich, er hatte das schon einmal erlebt. Die Florentiner wußten es auch recht gut und ließen es den Papst trotz der prachtvollen Empfangsfeierlichkeiten fühlen. Leo wurde nicht wohl damals in seiner treuen Stadt, und er fürchtete für sie, so lange die Franzosen die italienische Politik in Händen hatten. Seit 1519 aber, wo Karl von Spanien trotz der Gegenanstrengungen des Königs von Frankreich zum deutschen Kaiser gewählt worden war und das ungeheure Gebiet von Spanien, Burgund, Deutschland, Ungarn und Neapel unter ihm zu einem einzigen Lande wurde, wandten sich Leos Hoffnungen der neu entstehenden Macht zu. Ein Bündnis kam zustande, das Glück war günstig; die letzte Nachricht, welche der Papst vor seinem Tode empfing, war die von der Niederlage der Franzosen. Hätte man nicht so gute Gründe, zu glauben, daß Leo an Gift starb, man hätte sagen dürfen, er sei aus übermäßiger Freude dahingefahren.
Auf der Stelle jedoch nahmen die Anstrengungen der Besiegten, Mailand zurückzuerobern, ihren Anfang. Von dem Tage, wo Franz bei der Kaiserwahl unterlag, dreht sich die Geschichte der nächsten dreißig Jahre für Europa um die Anstrengungen der beiden Nebenbuhler, einander zu beweisen, wer der Stärkere sei und wem in Wahrheit die Leitung der Dinge dieser Welt gebühre. Persönliche Erbitterung war dabei im Spiele, die es bis zur persönlichen Herausforderung kommen ließ. Mailand aber bildete den Zankapfel, mit dessen Besitz das Übergewicht Spaniens oder Frankreichs sichtbar verbunden schien. Wer Mailand und die Lombardei einbüßte, unterlag. Alle Künste der Politik und des Krieges lenkten auf dieses Ziel des Ehrgeizes hin, und es war undenkbar, daß der eine, sobald er hatte weichen müssen, nicht augenblicklich das Äußerste versuchte, um dem andern dasselbe Los zu bereiten. Denn an Mailand hingen Toskana und Venedig (und Genua, an Genua das Mittelländische Meer und Neapel, und daran von anderer Seite wiederum Toscana und Venedig) und an allem endlich der Papst, der unfehlbar, zugleich mit der Laune des Schicksals, demjenigen sich zuneigen mußte, der als Herr Mailands den Schlüssel zu diesen Schätzen besaß.
1521 aber hatten die Franzosen besondere Eile, die verlorene Stellung wieder einzunehmen. Die Wahl des neuen Papstes war zu wichtig. Zwei Männer standen sich unter den Kardinälen gegenüber: Medici, als das Haupt der spanischkaiserlichen Partei, und Soderini, der unermüdliche Feind der Medici und der Freund Frankreichs. Die Entscheidung drohte sich hinzuziehen. Soderini und die verbannten Florentiner am Hofe Franz des Ersten drängten zu einer augenblicklichen Unternehmung gegen die Stadt, und als dann, mit Umgehung der beiden Nebenbuhler, der alte niederländische geistliche Herr, der sich als Bischof von Valladolid nichts von der ihm zufallenden Würde träumen ließ, aus der Wahl hervorging, sollte nun wenigstens, bevor dieser Italien erreicht hatte, ein Schlag geschehen.
Medici suchte sich gegen den drohenden Sturm mit den Mitteln zu halten, deren seine schlaue und zu vollendeter Verstellung erzogene Seele fähig war. Sein Leben lang hatte er, auf den verschlungensten Linien wandelnd, die Interessen der Familie verfolgt. Jetzt, wo ihm niemand mehr zur Seite stand, spielte er am feinsten. Soderini und Frankreich versprachen den Florentinern das Consiglio grande, dieses Ideal, an dem die Bürger hingen wie die Deutschen an der Idee ihrer Einheit: auch der Kardinal versprach es. Die geistreiche gelehrte Gesellschaft der Männer, welche, im Garten der Rucellai zusammenkommend, als eine Art ästhetisch liberaler Klub ihre Kontrolle über das Geschehende ausübten (unter denen Machiavelli eine der Hauptstimmen führte, und zu denen auch Michelangelo gerechnet ward), suchte er durch Gespräche, die er mit einzelnen von ihnen über die Entfaltung der Florentiner Verfassung zur freiesten Form führte, an sich heranzulocken. Er forderte sie auf, ihre Ansichten schriftlich zu begründen. Er suchte nicht minder die Anhänger Savonarolas mit Vertrauen zu erfüllen, die immer noch eine mächtige Partei bildeten. Schon war davon die Rede, unter welchen Modalitäten, an welchem Tage die neue Verfassung proklamiert werden würde. Jedermann hegte Hoffnungen, deren Mittelpunkt der freundliche, gefällige, uneigennützige Kardinal war, der ja, selbst wenn er für seine Familie hätte intrigieren wollen, gar keine mehr besaß, der sogleich nach dem Tode Leos allen gefangengehaltenen Bürgern ihre Freiheit gegeben hatte und der sich jetzt ja nur deshalb nicht entscheiden konnte, weil er nicht zu wissen schien, wie er die der Stadt zugedachte Wohltat groß und schön genug gestalten sollte.
Da plötzlich kommt eine Verschwörung zutage. Der Tod des Kardinals ihr Zweck. Soderini, der in Rom den neuen Papst gänzlich in seinen Netzen hält, ihr Anstifter. Aus der Mitte jener Männer des Gartens der Rucellai ihre gefährlichsten Teilnehmer. Denn dort auch durchschaute man die Verstellung am scharfsichtigsten und hielt unverbrüchlich zu Frankreich. Was die Verstellung Giulios aber anbetrifft, so braucht nur an das Dasein Ippolitos und Alessandros dei Medici erinnert zu werden. Der Kardinal dachte von Anfang an nicht daran, das geringste von dem zu gewähren, was er, nur weil er nicht anders konnte, versprochen hatte.
Im Mai 1522 ward das Komplott entdeckt. Einige der Verschworenen retten sich durch die Flucht, andern wird der Prozeß gemacht. Zu gleicher Zeit gelingt es, Soderini im Vatikan zu stürzen. Adrian läßt ihn in die Engelsburg abführen, während Medici, unter dem Jubel des römischen Volkes einziehend, von nun an seine Stelle einnimmt. Jetzt ist er der Notwendigkeit überhoben, den Florentinern gute Worte zu geben. Keine Rede mehr von Consiglio grande und Verfassung. Gehorsam wird gefordert.
Es ist schade, daß Nardi da, wo er das Entkommen der Verschworenen erzählt, durch seine Methode, statt die Namen der Leute zu geben, sie zuweilen nur anzudeuten, uns im ungewissen läßt, wer der »sehr berühmte Bildhauer« (scultore assai segnalato) war, der damals dem flüchtigen Zanobi Buondelmonti ein Obdach gewährte. Eben nämlich will dieser durch die Porta Pinti aus der Stadt entfliehen, als der Kardinal dort einreitet. Buondelmonti, der die Straße versperrt sieht, tritt in eine dicht am Tore gelegene Bildhauerwerkstätte, die der Kardinal selbst, sowohl der Skulpturen wegen, als auch weil ein schöner Garten um das Haus lag, öfter zu besuchen pflegte. Diesmal geschah das glücklicherweise nicht, und der Flüchtige findet Zeit, seine Kleider zu vertauschen und später in der Dunkelheit davonzukommen.
Außer Michelangelo befanden sich eine Anzahl anderer nicht unbedeutender Bildhauer in der Stadt. So Bandinelli; doch war dieser damals mit keiner Arbeit beschäftigt, welche ein Atelier erforderte, geschweige denn daß dieses, selbst wenn Bandinelli in Marmor gearbeitet hätte, mit Skulpturen gefüllt gewesen wäre. Außerdem hätte ihn Nardi wohl genannt; und schließlich, Bandinelli würde sich ein wahres Vergnügen daraus gemacht haben, Buondelmonti dem Kardinal auszuliefern. Ferner Jacopo Sansovino, der, gleich Baudinelli, als nach Leos Tode in Rom die fröhliche Wirtschaft ein trauriges Ende nahm, sich nach Florenz zurückzog; aber auch er dort schwerlich mit einem Atelier von Arbeiten. Weiter Benedetto da Rovezzano, der den vom Gonfalonier Soderini vor Zeiten nach Frankreich gesandten David des Michelangelo zu ziselieren hatte und dem später einer von den Aposteln für den Dom zuerteilt wurde, die Michelangelo wieder aufgab. Sein Atelier aber lag in einer anderen Stadtgegend. Endlich Tribolo und Mino da Fiesole. Jener noch jung und dem Kardinal ergeben, dieser alt und ohne große Aufträge. Es scheint, daß Nardi Michelangelo gemeint habe. Die Werkstätte war wohl jenes besonders für ihn erbaute Haus, das nach Beendigung der Apostel sein Eigentum werden sollte, in der Folge aber dem Dome verblieb und von diesem vermietet wurde. Es lag dicht an der Porta Pinti, dem alten Zisterzienserkloster gegenüber. Möglich, daß Michelangelo, der es früher schon einmal gemietet hatte, jetzt wieder darin arbeitete. Soviel steht fest, er war mit den Verschworenen befreundet. Einer von ihnen, Luigi Alamanni, unterzeichnete mit ihm die Bittschrift an Leo wegen der Asche Dantes; auch Nardis Name stand darunter, und dieser wußte vielleicht näher um die Verschwörung, als in seinem Buche gesagt wird. Und deshalb konnte ihm geboten erscheinen, Michelangelos Namen nicht zu nennen, denn er pflegt diese Art des Umschreibens da zumeist eintreten zu lassen, wo es sich um ihm befreundete Männer handelt.
Kein anderer auch hätte den Mut gehabt, Buondelmonti so aufzunehmen und sich dem Gesetz gegenüber zum Mitschuldigen zu machen. Und endlich, es verdient Michelangelo neben jenen andern vielleicht allein die Bezeichnung »sehr berühmt«, da Nardi mit dergleichen sparsam umgeht. Dennoch sind dies nur Vermutungen.
IX
Obgleich es Michelangelo nur hätte lieb sein können, von aller dringenden Arbeit frei, die Beendigung des Grabdenkmales betreiben zu dürfen, sah er sich doch durch äußere Gründe bewogen, nach einiger Zeit beim Kardinal wegen Weiterführung des Baues der Sakristei Schritte zu tun. Wie er seinen Auftraggebern stets zu langsam arbeitete, schien es nun auch den Erben Giulios, daß er nicht rasch genug vorwärts käme. Sie hatten zurückstehen müssen im Jahre 16, als der Papst den Bau der Fassade anbefahl, sie hatten, als diese Arbeit Michelangelo bald ganz in Anspruch zu nehmen schien, sich bei Leo nicht beklagen dürfen, denn der Papst, nachdem er sie mit so rücksichtsloser Ungerechtigkeit um ihr Herzogtum Urbino gebracht, würde sich wahrhaftig nicht um solche Beschwerden gekümmert haben. Sie ließen Michelangelo damals privatim in Florenz mahnen. Dieser führte ihren Abgesandten ins Atelier und zeigte ihm, was bereits vollendet dastand. Als er nun aber die Sakristei mit den Grabmälern der Mediceer übernahm, schien den Roveres das zu viel. Sie waren nach Leos Tode nach Urbino zurückgekehrt und nahmen die alte mächtige Stellung wieder ein, jetzt ließen sie Papst Adrian den Fall vortragen und forderten, daß von Michelangelo das Grabdenkmal vollendet oder das empfangene Geld herausgegeben würde. Zu der Zeit aber, als dies geschah, wandte der Kardinal Medici seine Gedanken wieder auf die neue Arbeit, die eine Verherrlichung seiner Familie und eine Pflicht der Dankbarkeit gegen diejenigen war, denen die Grabmäler in der Sakristei errichtet werden sollten. Auch das mag ein Antrieb für Michelangelo gewesen sein, eine Entscheidung über das, was geschehen sollte, herbeizuführen, daß die Blöcke aus Carrara anlangten, jener eine wenigstens, der für die Statue der Jungfrau bestimmt war und Ende 1522 in Florenz abgeliefert werden mußte. Der Kardinal war in Rom. Michelangelo richtete an einen der Herren aus seiner Umgebung ein Schreiben, worin er seine Wünsche zu erkennen gab. Vor allen Dingen müsse der vom Papste ausgegangene Befehl, daß entweder das Grabdenkmal Giulios jetzt vollendet oder das Geld den Roveres wiedererstattet würde, rückgängig gemacht werden. Sein Wille war nicht, das Grabdenkmal liegenzulassen, denn nie kam es ihm in den Sinn, sich einmal eingegangenen Verpflichtungen zu entziehen, aber die neue Arbeit reizte ihn, und beide konnten zu gleicher Zeit betrieben werden. Deshalb, schließt er, auch wenn es dem Kardinal nicht gelänge, ihm freie Hand zu verschaffen, werde er dennoch neben dem, woran er übrigens zu arbeiten gezwungen sei, seinen Aufträgen Genüge leisten. Lieber wäre es ihm, wenn sich das erstere bewirken ließe.
Der Tod Adrians machte dieser Ungewißheit ein Ende. Kein Jahr hatte er im Vatikan gesessen. Unverstanden in seiner bürgerlichen Einfachheit und im guten Willen, den er nach allen Seiten geltend machen wollte, ohne Verständnis für das, was der Stadt, der er das Zentrum der geistigen Bewegung sein sollte, willkommen wäre, nicht imstande sogar, mit vielen der Kardinäle nur zu reden, weil sie kein Lateinisch wußten, während ihm das Italienische fremd war, starb er unbetrauert und zur Befriedigung derer ab, welche sich auf den päpstlichen Hof angewiesen sahen. Nirgends paßte er weniger hin als nach Rom. Bei seinem Einzuge hatte er sich Triumphbögen verbeten, es seien das heidnische Ehrenbezeugungen. Die kostbare Sammlung antiker Bildsäulen im Belvedere verschließt er; alle Türen, bis auf eine einzige, zu der er den Schlüssel bei sich trägt, werden zugemauert. Die Decke der Sixtinischen Kapelle will er herunterschlagen lassen, weil nackte Gestalten nicht in eine Kirche gehörten. Eine alte Magd hat er aus seiner Heimat mitgebracht, der er alle Tage selber ein Goldstück gibt, um die Ausgaben für das Haus damit zu bestreiten. Seine Verwandten, die in Hoffnung auf gute Beute ankommen, schickt er mit einem mäßigen Reisegelde wieder nach Hause. Für Porträts, die von ihm zu malen wären, hatte er einen jungen niederländischen Maler bei sich, der im Vatikan arbeitete. Doch auch Sebastian del Piombo widerfuhr die Ehre, ihn porträtieren zu dürfen. Der Schüler Raffaels aber und der gesamte große Haufe der römischen Künstler saßen da wie Schmetterlinge im Platzregen. Ein Schrecken ergriff sie; Giulio Romano voran, verließen sie die Stadt und zerstreuten sich in Italien. Es schien, als sei dem römischen alten Leben für immer ein Ende gemacht. Und so war es in der Tat. Denn obgleich nach Adrians Tode die Dinge äußerlich wieder ins Blühen kamen: die Sonne strahlte doch nie mit dem alten Glanze wieder, und die Früchte wurden nicht so süß, die sie zeitigte. Die neue Zeit brach ein. Adrians kurze Regierung ging wie eine prophetische Inhaltsanzeige den Ereignissen voran, die allmählich dann voller und langsamer eintretend, der Kunst und Freiheit in Florenz ein trauriges Ende bereiteten.
In den nun folgenden hartnäckigen Kämpfen siegte Medici. Soderini stand neben ihm anfangs so sehr im Vorteil, daß auf ihn gewettet wurde, zuletzt aber beugte er sich dem Mächtigeren. Im November 1523 erfolgte die Wahl. Wie bei Leos Erhebung strömte Florenz über von Freudenbezeugungen. Auch Michelangelo hatte Ursache, zufrieden zu sein. »Mein lieber Meister Domenico«, schreibt er an seinen alten Freund Topolino in Carrara, »der Überbringer dieses ist Bernardino da Pierbasso, den ich wegen einiger Blöcke, deren ich bedürftig bin, nach Carrara schicke. Seid so gut, ihn dahin zu dirigieren, wo er am besten und raschesten seinen Zweck erreicht. Nichts weiter für den Augenblick. Ihr werdet gehört haben, daß Medici Papst geworden ist. Alle Welt ist entzückt darüber, und auch mir will scheinen, als würde es jetzt neue Bestellungen geben. Deshalb bedient mich diesmal gut und ehrlich, damit es ihm zur Ehre gereiche.«Vielleicht wußte Michelangelo damals schon mehr, als er Topolino mitteilte. Denn sofort nach der Wahl Medicis wurde der Bau der Sakristei nicht nur frisch aufgenommen, sondern als neue Bestellung die Ausführung der Bibliothek von San Lorenzo beschlossen. Der Zeit nach trifft dies zusammen mit dem Termine, wo die übrigen Blöcke aus Carrara eintrafen. Michelangelo erhält ein monatliches Gehalt von fünfzig Dukaten und beginnt die beiden Statuen der Herzöge von Nemours und von Urbino, die zu den erhabensten Denkmälern gehören, welche die Bildhauerkunst hervorgebracht hat.
Lasse ich alles, was mir von Porträtstudien bekannt ist, vor meinen Augen vorübergehen, so finde ich, daß diese beiden Gestalten von keiner übertroffen werden. Was ihnen an Einfachheit vielleicht abgeht, ersetzt die Würde der Erscheinung. Dächte ich mir, was immer die äußerste Probe bleibt, jene griechische Statue des Sophokles im lateranischen Museum zwischen die sitzenden Helden gestellt, sie würden ein wenig hohl werden und ihr prachtvolles Aussehen an natürlicher Grazie verlieren, etwa als wollte man einem der hohenstaufischen Kaiser Alexander den Großen entgegentreten lassen, allein dieser Unterschied kann als natürlich und notwendig verteidigt werden. Denn die beiden Medici sind weder Göttersöhne noch Helden gewesen. Michelangelo hat sie so hoch erhoben, als sie sich erheben ließen, und, indem er die Nachkommenschaft seines alten Gönners Lorenzo und dessen Bruder so darstellte, alles, was er in ihrem Hause an Wohltaten empfing, in einer Weise vergolten, die mehr als königlich ist. Die ganze Familie gewinnt durch diese Statuen ein Aussehen gewaltiger Fürstlichkeit und höheren Adel, als ihr weder ihre eigenen Taten noch die Verbindungen mit den Häusern der Kaiser und Könige jemals verschaffen konnten.
Ein Beweis, wie wenig von dem Andenken an das, was Lorenzo und Giuliano im Leben waren, übrigblieb, und wie, was sie heute sind, nur in der Arbeit Michelangelos liegt, ist die Verwechslung der Namen bei diesen Statuen, die bis auf unsere Zeiten gedauert hat. Denn sollte auch hier oder dort darauf aufmerksam gemacht worden sein, was mir jedoch nicht bekannt ist, so drang die Berichtigung sicher nicht durch, und die falschen Bezeichnungen hafteten. Lorenzo, der hochmütige, kriegerische Herzog von Urbino, wird von Vasari »der in Nachdenken Versunkene« genannt, und die Darstellung seines melancholischen, so traurig endenden Oheims Giuliano auf ihn gedeutet, während dieser, zu dem »kühnen, stolzen« Lorenzo gemacht, bisher unter der Gestalt seines Neffen betrachtet wurde.
Die Marmorbilder, wie sie heute in der Sakristei von San Lorenzo stehen, bilden den Gegensatz des sich in sich selbst zurückziehenden Erwägens und des zur Tat sich erhebenden Entschlusses. Beide ruhen. Aber Lorenzo sitzt da wie ein Feldherr auf der Höhe eines Hügels, von dem herab er seine kämpfenden Soldaten beobachtet und den Lärm der Schlacht vernimmt, während Giuliano, taub für das, was um ihn her sich ereignet, über Gedanken ohne Ende zu brüten scheint.
Lorenzo war tapfer, wie sein Vater Piero gewesen war; er leitete in Person den Sturm auf Monteleone, als er dem Herzoge von Urbino mit Gewalt das Herzogtum abnahm, dessen Titel ihm vom Papste geschenkt war. Er erscheint in der Tracht eines römischen Feldherrn aus der Kaiserzeit, die Ornamente seiner Rüstung sind reich und mit reinlicher Sorgfalt ausgeführt. Der rechte Fuß tritt geradeaus, daß das Knie nach vorn vorsteht, der linke zurück unter den Sessel, so daß das Knie hier, bei gesenktem Schenkel, tiefer als das andere liegt: ganz die Stellung zum Sicherheben mit einem Ruck, sobald es notwendig scheint. Quer über seinen Schoß ist ein schwerer Feldherrnstab gelegt, dessen eines Ende, weil das rechte Knie höher steht, aufwärts über den Schenkel hinausreicht. Auf diesen Teil des Stabes lehnt sich die Hand, oder (man möchte so sagen, obgleich es die Hand eines Mannes ist) sie ist darüber hingegossen, mit so unbeschreiblicher Grazie hat Michelangelo sie dargestellt. Diese Hand – und die andere, die auf dem andern Ende des Stabes liegt, noch nachlässiger in der Bewegung, mit dem Rücken ihn berührend und ohne jede Absicht, zu greifen etwa oder sonst etwas zu tun, was einen Willen andeutet – sind die beiden schönsten Männerhände, die ich im Bereiche der Skulptur kenne. Schon bei dem Leichnam Christi im Schoße der Mutter sind die Hände unvergleichlich zart und ausdrucksvoll, und wenn irgendein Zweifel bei der Madonna von Brügge aufsteigen könnte, ihre Hände deuteten auf die einzigen Hände wiederum, die sie zu formen imstande waren. Nichts läßt so durchaus sicher auf den ersten Blick die Stufe erkennen, auf der ein Künstler steht, als seine Art, die Hände zu bilden.
Was der Gestalt des Herzogs von Urbino aber den Stempel aufdrückt, ihr Wahrzeichen gleichsam, ist der sich aus der viereckig geschnittenen, reichverzierten Öffnung des um Brust und Schultern dicht anliegenden Panzers aufreckende Hals, Kraft und Stolz sind der Inhalt seiner Bewegung. Noch einmal, mit einem Blicke auf die ganze Gestalt: was Gutes und Edles in Lorenzos Charakter lag, seine Tapferkeit, seine Hoffnung, die italienischen Staaten zu einem Königreich für sich zu erobern, enthält diese Statue, und wer sie betrachtet und nachher den Mann selbst in seinen Schicksalen, dem löst sich auf das leichteste die Frage, was unter Idealisierung einer Person zu verstehen sei. Ein Künstler, der das Ideal eines Menschen schaffen will, nimmt aus ihm heraus was bleibenden Wert hat, tut dazu was er als Mensch und Künstler selbst ist, und formt daraus eine neue Erscheinung.
Wir haben kein Porträt, um die Ähnlichkeit der Züge zu vergleichen. Raffael malte den Herzog, das Bild ist verlorengegangen. Doch hat sich Michelangelo nur wenig an die Natur gehalten bei beiden Statuen, wie er selbst eingestand. Wer denn in tausend Jahren auftreten und beweisen wolle, die Herzöge hätten anders ausgesehen, antwortete er, als ihm die mangelnde Ähnlichkeit vorgeworfen wurde. Er hat niemals Porträts gearbeitet, es sei denn in gelegentlichen Zeichnungen, die nur als Studien zu betrachten sind. Die individuellen Formen eines Menschen schienen ihm nicht umfassend genug, um das auszudrücken, was er in eine Arbeit hineinlegen mußte, wenn diese ihn zur Vollendung reizen sollte. Und so, wie er die ganze Gestalt hier in höheren Formen zeigte, bildete er auch den Kopf unabhängig von den individuellen Zügen als einen Teil seines neuerschaffenen Menschen.
Bei Giuliano fehlt am Gesicht die letzte Arbeit. Während Lorenzos aufstrebendes Haupt unbedeckt erscheint, trägt Giuliano einen Helm von antiker Form, entsprechend der römischen Rüstung, in der auch er steckt. Diese aber entbehrt der Zieraten. Die Gestalt hat etwas Schweres, Ruhendes. Der linke Ellenbogen steht auf der vorspringenden niedrigen Lehne des Sessels auf, und mit dem ausgestreckten, leicht gebogenen Zeigefinger berührt er die Lippen, als stütze er den gesenkten Kopf ein wenig damit. Der andere Arm ist mit dem Rücken der geknickten Hand auf den Schenkel aufgepflanzt, daß sich der Ellenbogen nach außen wendet; das Bein aber tritt vom Knie abwärts quer nach der andern Seite hinüber, so daß die Füße, ein wenig unter den Sessel gezogen, einer hinter dem andern, nah zusammenstehen. Die Knie sind nackt, wie bei Lorenzo, und das kurze mit Troddeln und Streifen überhangene Panzerhemde fällt zwischen ihnen schwer in den Schoß herab.
Michelangelo, in dessen Natur etwas Überströmendes lag, das fast in jedem seiner Werke, so oder so, einen Ausweg suchte, weiß, wie er die Bewegung einer Gestalt bis zu losplatzender Heftigkeit zu steigern versteht, ebenso, wenn er die Ruhe darstellt, sie zu einem in die Unendlichkeit sich ausdehnenden Zustande zu erhöhen. Die Sibyllen und Propheten zeigen das bei seinen Malereien, die Statue Giulianos bei den Skulpturen. Dennoch bringt die Marmorgestalt des Herzogs von Nemours einen anderen Gedanken zum Ausdruck als die gemalten kolossalen Männer und Frauen der Sixtinischen Kapelle. Hier war das grübelnde Nachdenken dargestellt, das Zusammenströmen der Gedanken auf einen Punkt, die höchste innerliche Arbeit; bei Giuliano das Auseinanderfließen, das Versinken in ein unbestimmtes Gefühl, recht, als hätte gezeigt werden sollen, daß für ihn der Tod eine Erlösung nach langem traurigen Kränkeln war. Er sitzt, als wäre er allmählich versteinert. Er lebte unter Verhältnissen, die ihn zuzeiten kriegerisch aufzutreten zwangen; für die Familie mußte auch er sich anstrengen, seinen Mann zu stehen; die Hochzeitsreise nach Frankreich war das letzte, das er zur Vermehrung des mediceischen Glanzes zu tun vermochte. Schon damals trug er den Keim des Todes in sich. Sehnsucht nach Ruhe und die seltsame Hoffnungslosigkeit, die manchen Charakteren als ein düsteres Geschenk der Natur mitgegeben wird, waren ihm eigen. »Keine Feigheit ist es, noch entspringt es aus Feigheit, wenn ich, um dem zu entfliehen, was grausamer noch mich erwartet, das eigene Leben haßte und ein Ende ersehnte.« Dies die ersten Verse seines Sonettes zur Verteidigung des Selbstmordes, das als Gedicht nicht bedeutend, hier dennoch höheren Wert gewinnt, weil es als die einzige Äußerung dieses Geistes zurückgeblieben ist, dessen Verlust, als er starb, Freunde und Feinde beweinten, und der längst in Vergessenheit gesunken wäre, hätte ihn Michelangelo nicht unter seine Flügel genommen.
An die Söhne der beiden Herzöge ward nun nach ihrem Tode das Schicksal von Florenz gekettet. Beides uneheliche Kinder, denn von ihren fürstlichen Gemahlinnen hatte Giuliano keine Nachkommen, Lorenzo nur eine Tochter. Ippolito, der ältere, war der Sohn einer vornehmen Frau in Urbino, aus den Zeiten, wo Giuliano als Verbannter dort lebte, Alessandros Mutter dagegen von dunkler Herkunft, eine zum Palaste gehörige Mulattensklavin, die nicht einmal anzugeben imstande war, ob Lorenzo oder ein Reitknecht oder der Kardinal dei Medici selber der Vater des Kindes sei. Beide aber sind ausgezeichnete Naturen gewesen und denjenigen im Charakter ähnlich, denen sie ihr Dasein verdankten. Dem Papste genügte, daß sie vorhanden waren, mochten sie gekommen sein, woher sie wollten.
Als Leo der Zehnte den Kardinal Giulio dei Medici zum Regenten in Florenz machte, waren die Knaben noch zu jung, um selbst eine Rolle zu spielen. Längst aber stand fest im Vatikan, daß Ippolito einmal eine eigene Herrschaft erhielte, und seine Zukunft kam bei den geheimen Unterhandlungen mit Spanien und Frankreich als stehender Artikel in Betracht. In Florenz sahen die Politiker anfangs nicht so weit, bald aber sollte auch ihnen Aufklärung werden.
Im Frühjahre 24 zieht der Kardinal von Cortona als Regent und Stellvertreter des Papstes in Florenz ein, und zwei Monate später folgen ihm die beiden, in deren Namen er fortan die Stadt beherrscht, Ippolito und Alessandro, dieser noch ein Knabe, jener aber, als vierzehnjähriger Jüngling, von der Bürgerschaft für fähig erklärt, die höchsten Staatsämter zu bekleiden. Alessandro sollte später Kardinal werden, Ippolito Caterina, des Herzogs von Urbino nachgelassene Tochter, heiraten, der einst die Hälfte aller mediceischen Güter zufiel und die damals noch ganz klein war. Ippolito war im stillen dazu bestimmt, die Rolle aufzunehmen, die Lorenzo bis zu Ende zu führen durch den Tod verhindert wurde.
So standen die Dinge in Florenz, als Michelangelo an den Statuen Lorenzos und Giulianos arbeitete.